Von Mooren, Erlenwäldern und Salzwiesen
- Veröffentlicht am

Waren Sie schon einmal auf Schatzsuche? Nicht nach der alten, halb verfallenen Holzkiste mit Gold, Silber und Edelsteinen, sondern nach den Perlen der Küstenregionen Deutschlands? An der Schatzküste, die sich an der Ostsee von Rostock bis in den Westen der Insel Rügen erstreckt, könnten Sie fündig werden. Hier finden Sie alte Erlenbruchwälder, Moore, Küstenüberflutungsräume. Der Anblick von tausenden Kranichen, die über den vom Sonnenuntergang in kräftiges Rot gefärbten Himmel zu ihrem Schlafplatz ziehen, ist hier noch Normalität. Ebenso die Kiebitze in ihrem unverwechselbaren Balzflug.
Doch dieser Schatz ist in Gefahr: Viele der Lebensräume sind in einem ökologisch kritischen Zustand. Küstenüberflutungsbereiche wurden eingedeicht, Land für den Ackerbau nutzbar gemacht. Seltene Arten drohen zu verschwinden. Das will Georg Nikelski mit seinem Team verhindern. Er ist der Geschäftsführer der Ostseestiftung, die 2011 mit dem Ziel gegründet wurde, die Artenvielfalt an der Ostseeküste zu erhalten und zu fördern.
Erreichen möchten sie das mit gemeinsam mit Verbundpartnern im Projekt Schatz an der Küste, inspiriert vom und realisiert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt und dessen Philosophie. Das Vorhaben verfolgt drei wesentliche Ziele: Zum einen gilt es, zu „Verstehen und zu Beschützen“. Es beinhaltet den Ansatz, die Bürger aktiv in das Projekt einzubinden und ihre Identifikation mit den wertvollen Lebensräumen in ihrer Umgebung zu stärken. Im zweiten Ziel geht es um das „Nutzen und Erhalten“. Es umfasst die Wiederherstellung der Küstenlebensräume – der Salzwiesen, der Küstenüberflutungsräume – die Wiedervernässung, aber auch die nachhaltige Nutzung der Standorte gemeinsam mit Landwirten aus der Region. Das letzte Ziel beinhaltet das „Teilen und Genießen“. Die Menschen, Touristen wie Anwohner, sollen die Möglichkeit bekommen, die Natur zu erleben, ohne die dort heimischen Tiere oder Pflanzen zu stören. Dazu wurde im Projekt ein eigener Reise- und Gebietsführer entwickelt, der, ergänzt um verschiedene Flyer, auf die Besonderheiten der Region hinweist. All diese Ziele wurden im Konzept „Vielfalt bewahren“ präzisiert und ziehen sich als roter Faden durch die Arbeit der Ostseestiftung.
Gründliche Vorbereitung
Mit den Vorarbeiten für das Projekt begann die damals noch junge Stiftung bereits im Jahr 2012. Von Beginn an war die Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern ebenso an den Projektinhalten beteiligt wie die großen Naturschutzverbände. „Erst dadurch haben wir uns an so ein großes Vorhaben getraut“, meint Geschäftsführer Georg Nikelski rückblickend. „Einen zusätzlichen Impuls gab dann die Beteiligung der Universität Greifswald.“ So konnte das Projekt strategisch gut auf den Weg gebracht und große Hürden schon im Vorfeld ausgeräumt werden. So wurden beispielsweise die Gebiete, die renaturiert werden sollen, schon frühzeitig identifiziert und es wurde gemeinsam mit der Landesverwaltung begonnen, sie systematisch zu sichern.
Insgesamt arbeiten neben der Ostseestiftung noch acht weitere Verbundpartner gemeinsam am Projekt Schatz an der Küste, jeweils mit eigenen Schwerpunkten. Hinzu kommen außerdem noch verschiedene Akteure vor Ort, beispielsweise der Landkreis und verschiedene Gemeinden, Landwirte und Forstämter, Tourismusverbände und das Nationalparkamt Vorpommern. Die Koordination aller Beteiligten liegt bei der Ostseestiftung, genauer gesagt bei der Projektleiterin Sabine Grube. Sie bewarb sich im Jahr 2014 gezielt auf die Projektstelle. „Das Anforderungsprofil war sehr interessant: die Leitung eines Bienenstocks völlig verschiedener Menschen“, lacht sie. „Außerdem lief meine alte Projektstelle gerade aus. Das passte zeitlich gut.“
Kooperativ lernendes System
Trotzdem war die Zusammenarbeit so vieler Menschen in einem kurzen Projektzeitraum von nur sechs Jahren nicht einfach. „Uns war schon bei der Antragsstellung bewusst, dass das sehr ambitioniert ist“, meint Nikelski. „Das hat nur in Zusammenarbeit mit allen Partnern, dem Engagement der Mitarbeiter und vielen glücklichen Umständen geklappt.“ Einer dieser Glücksfälle: BfN und BMU bemühen sich, die Anforderungen an die Verbundpartner realisierbar zu halten. „Man kann das als kooperativ lernendes System verstehen“, erklärt Grube. „Wir standen in einem fachlich hochkarätigen Austausch, und so wurden fachliche Verbesserungen möglich.“
Vor allem die transparente Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Projektpartnern gelang sehr gut. „Gemeinsam haben wir es geschafft, uns den Ruf zu erarbeiten, dass wir uns mit allen interessierten regionalen Akteuren zusammensetzen, bevor es an die Planung und Umsetzung von Maßnahmen geht“, resümiert Grube.
Als besonders herausfordernd erwies sich auch der Projektbestandteil der Evaluation. Einige Verbundpartner betrachteten diesen Bereich des Projekts eher als zusätzliche Pflichtaufgabe und planten deshalb zu wenig Zeit dafür ein – ein Fehler, der bei einigen Teilprojekten zu leichten Verzögerungen führte.
Zeit fraßen auch Aufstockungsanträge. „Einige Entwicklungen im Projekt waren schlicht nicht vorhersehbar“, erklärt Grube. „Vor allem die Baukostensteigerungen haben wir in diesem Maß nicht erwartet.“ Zudem konnte im laufenden Vorhaben die Öffentlichkeitsarbeit professionell organisiert werden – auch das war mit Zusatzkosten verbunden. „Aber die Geldgeber haben hier sehr schnell, kooperativ und fair gearbeitet“, lobt Grube.
Erste Erfolge
Durch diese Kooperationsbereitschaft gelang es unter anderem, 200 ha Polderflächen zu renaturieren. Eine der Teilflächen liegt im Westen Rügens. Durch die Rückverlegung des alten Deiches werden hier ein ehemaliges Intensivgrünland und sogar eine Ackerfläche wieder an das Meer angebunden. Bei Hochwässern werden die Wiesenflächen dann wieder überspült, und Salzwiesen können neu entstehen. Schon jetzt balzen die ersten Kiebitze auf der Fläche, und in den eingesäten Bereichen sprießt das erste Grün aus dem Boden.
Aufgrund der Morphologie der Insel konnte auf einen neuen Deich nicht verzichtet werden, erklärt Rasmus Klöpper, der für die Projektsteuerung verantwortlich ist. Aber der neue Deichweg wurde so gestaltet, dass Besucher in das Gebiet schauen können, ohne die Rast- und Brutvögel zu stören. Später, wenn die Fläche komplett begrünt ist, soll sie beweidet werden. Kooperationen mit lokalen Tierhaltern gibt es bereits auf mehreren Teilflächen der Insel. „Sonst würde sich hier bald Schilf ausbreiten“, erklärt Klöpper. „Wir wollen allerdings die Entwicklung der Salzwiesen fördern, dazu ist ein aktives Weidemanagement nötig.“
Die Renaturierung alter Polderflächen und die Entwicklung von Salzwiesen sind aber bei Weitem nicht die einzigen Maßnahmen des Naturschutzes. Es gilt insgesamt, Bereiche zu schaffen, in denen die natürliche Entwicklung ihren Lauf nehmen kann, genau wie Bereiche, in denen Menschen die Natur erleben können.
Die Bodden- und Fließgewässer der Hotspotregion leiden – wie viele in Deutschland – unter zunehmender Eutrophierung, teilweise auch durch hohen Nutzungsdruck. Hier konnte im Projekt eine Nutzungslenkung der Boddengewässer umgesetzt werden. Außerdem wurde immer wieder mit Landnutzern gesprochen, um langfristig den Pestizid- und Nährstoffeintrag in die Gewässer zu reduzieren, unter anderem durch die extensive Nutzung von Äckern und Weiden.
Den Projektverantwortlichen gelang es außerdem, Techniken zu erproben und zu optimieren, die das Bewirtschaften von nassen Erlenwäldern möglich machen. Dazu wurde ein Seilkran angepasst, um die Stämme aus den unzugänglichen Flächen zu schleppen. Dies vermindert die Hemmnisse, Erlenbrüche wieder zu vernässen.
Digital entdecken
Entdeckt werden können die Naturräume des Hotspots 29 heute mithilfe der App „Schatzküste“. Mit ihr lassen sich die Lehrpfade erkunden, die im Rahmen des Projekts entstanden sind. Außerdem können auf der Webseite www.schatzküste.com/schatzlotse viele Schatzlotsen – Broschüren abgerufen werden – eine der zahlreichen Maßnahmen, um Interessierte über die verschiedenen Lebensräume im Hotspotgebiet zu informieren.
Aus Sicht der Ostseestiftung ist damit die Arbeit aber noch längst nicht abgeschlossen. Das Projektkonzept wurde bewusst mittel- bis langfristig ausgerichtet, um nachhaltige Erfolge für die Schutzgüter zu erreichen. Für das Stiftungsteam steht es deshalb außer Frage, dass sie ihr Engagement weiterführen wollen. Georg Nikelski erklärt: „Wir haben eine fantastische Naturausstattung. Da mangelt es nicht an Aufgaben!“ Ein Folgeantrag ist bereits in Arbeit, dieses Mal mit dem Schwerpunkt Biotopvernetzung. „Wenn wir es schaffen, 12 Jahre in dem Hotspot unterwegs zu sein und in dieser Landschaft sichtbare erhaltende und heilende Spuren zu hinterlassen, ist das wirklich ein Erfolg“, fasst Sabine Grube zusammen.
- Projektträger: Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee (OSTSEESTIFTUNG)
- Projektleitung: Dr. Sabine Grube;Projektsteuerung: Rasmus Klöpper
- Projektpartner: Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, WWF Deutschland, Hansestadt Rostock, Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur (Succow-Stiftung), Universität Greifswald – AG Nachhaltigkeitswissenschaft und Angewandte Geographie, Kranichschutz Deutschland gGmbH, Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) MV
- Laufzeit: 1. August 2014 bis 31. Juli 2020
- Biotoptypen: Salzwiesen, Boddenröhricht und Flachwasserbuchten, Küstenüberflutungsmoore, Dünen, Strand, Erlenbrüche, Nasswiesen.
- Finanzierung: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), Bundesamt für Naturschutz (BfN), Land Mecklenburg-Vorpommern, Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung, Ostseestiftung
- Finanzierungsumfang: ca. 10,1 Mio. €
Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee
– OSTSEESTIFTUNG –
Ellernholzstraße 1/3
17489 Greifswald
+49 3834 / 887 89 38
Mail: info@ostseestiftung.de
Website: www.ostseestiftung.de
„Wir möchten mit unserem Handeln für die Natur so viele Akteure wie möglich mitnehmen und das lokale Wissen mit einbeziehen. Nur so kann eine langfristige Wirksamkeit für Pflanzen und Tiere, Wasser, Boden, Luft und Klima erreicht werden..
Autoren
Rasmus Klöpper ist Landschaftsplaner. Bevor er die Projektsteuerung im Projekt Schatz an der Küste übernahm, war er viereinhalb Jahre Sachgebietsleiter im Nationalparkamt Vorpommern.
Georg Nikelski ist Gründungsgeschäftsführer der Ostseestiftung. Der gebürtige Greifswalder studierte Agrarökologie und Jura und hat nach einem kurzen Ausflug in die öffentliche Verwaltung überwiegend in NGOs gearbeitet.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen




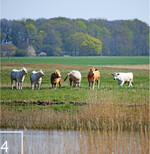















Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.