Artenhilfsprogramm für den Europäischen Schlammpeitzger
- Veröffentlicht am

Er hält sich im Verborgenen, tritt nur selten in Erscheinung. Als Jäger der Nacht bekommen ihn nur wenige zu Gesicht. Seine Beute sind Wirbellose, Insektenlarven, kleine Krebse, Schnecken und Muscheln. Er lebt dort, wo für andere Fische ein Überleben unmöglich erscheint: Im sauerstoffarmen Wasser, manchmal sogar im Schlamm trockengefallener Kleingewässer. Es sind keine Orte, an denen man einen Fisch vermuten würde, und trotzdem hat er sich auf genau diese Lebensräume spezialisiert: der Europäische Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis ).
Die Spezialisierung auf lebensfeindliche Extremhabitate hat einen Grund. „Der Schlammpeitzger ist eine insgesamt sehr konkurrenzschwache Fischart“, erklärt Dominik Bernolle, Mitarbeiter des Fachreferats für Fisch- und Gewässerökologie im Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU). „Bei einem größeren Raubfischaufkommen kann sich die Art nicht behaupten.“
Der bis zu 30 cm lange Süßwasserfisch greift deshalb auf eine besondere Überlebensstrategie zurück: Anstatt, wie die meisten Fische, nur über seine Kiemen Sauerstoff aufzunehmen, kommt er regelmäßig an der Wasseroberfläche und schluckt dort Luft, die er im Darm veratmen kann. Diese Technik ermöglicht es dem bräunlichen Grundfisch sogar, ein vorübergehendes Trockenfallen seines Lebensraumes, tief eingegraben im Schlamm, zu überdauern. Und einige Spitznamen hat ihm dieses Verhalten auch eingebracht: Regional wird er auch als „Furzgrundel“ oder „Gewitterfurzer“ bezeichnet.
Fehlgeschlagene Strategie
Seine Überlebensstrategie wird dem Schlammpeitzger heute zum Verhängnis. Seine ursprünglichen Lebensräume, vor allem stehende oder langsam fließende Auengewässer, sind weitgehend verschwunden. Er konnte zwar teilweise auf Ersatzlebensräume ausweichen – vor allem künstliche Gräben – doch hier droht die regelmäßige Zerstörung seines Habitats. „Beispielsweise der Einsatz von Grabenfräsen insbesondere auf längeren Gewässerabschnitten kann Populationen stark schädigen oder vernichten“, erläutert Bernolle die Gefahren der Grabenräumung. Diese sind deshalb inzwischen verboten, eine Arbeitshilfe des LFU gibt Tipps zur schonenden Gewässerunterhaltung (QR-Code S. 44).
Wenn jedoch gar keine Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, verlanden die Gewässer allmählich. Auch dadurch erlöschen die Bestände. Das Zusammenspiel dieser Faktoren erweist sich für diese Art nicht als Vorteil: Inzwischen gilt der Europäische Schlammpeitzger in Deutschland nach der Roten Liste als stark gefährdet, in der neuen Roten Liste Bayerns (LfU 2021) ist er sogar als vom Aussterben bedroht gelistet.
„Der Schlammpeitzger ist weitgehend unbekannt und stark gefährdet“, führt Bernolle weiter aus. „In Wielenbach haben wir einen Laichfischbestand. Darauf aufbauend konnte der Schlammpeitzger in der Teichanlage der Dienststelle Wielenbach des LfU erfolgreich nachgezüchtet werden. Nun galt es, ein geeignetes Gewässer für die Wiederansiedlung zu finden. Als das gefunden war, waren wir überzeugt, dieser stark bedrohten Art helfen zu können, die keine fischereiwirtschaftliche Bedeutung hat.“
Das Wielenbacher Team besteht aus Fischwirten und Fischökologen, außerdem sind in der Dienststelle noch drei weitere Referate des LfU mit ihren Expertenteams vertreten. Beim AHP Schlammpeitzger waren neben Bernolle insbesondere noch zwei weitere Personen beteiligt: Lukas Ittner und Martin Szyja. Ittner ist Fischbiologe, sein Kollege Szyja angehender Fischwirtschaftsmeister.
Vermehrung und Aufzucht
Szyja fiel die Aufgabe zu, die gefährdeten Fische zu vermehren. „Für mich war das auch ein Experiment“, erzählt er. Denn: Viele Erfahrungen über diese verborgen lebende Art gibt es nicht, geschweige denn ein fischzüchterisches Standardverfahren. Einige wenige Infos sind in der Literatur zu finden, doch im Wesentlichen musste Szyja sich auf seinen Instinkt verlassen. 30 Tiere standen ihm zur Verfügung, männliche und weibliche Tiere, entnommen aus dem Laichfischbestand in der Teichanlage Wielenbach.
Die Nachzucht gelang, wenn auch nicht ganz zur Zufriedenheit des angehenden Fischwirtschaftsmeisters: Die Befruchtungsrate der Eier war eher gering. Das beeinflusst nicht nur die Menge der Jungtiere, die produziert werden können. Es bedeutete auch, dass Szyja einzeln per Hand die unbefruchteten Eier aussortieren musste. „Die unbefruchteten Eier verpilzen“, erläutert er. „Um die restliche Brut zu schützen, müssen diese deshalb ausgelesen werden.“
Doch es geht nicht nur darum, die „Schlechten“ von den „Guten“ zu trennen. Auch daneben ist in der Anlage ständig für Hygiene zu sorgen: Kot und Nahrungsreste müssen entfernt werden, das Wasser muss sauber bleiben. Zu groß wären die Risiken eines Ausfalls der Nachzucht. Die schlammige Umgebung des Naturstandortes sucht man deshalb in den Aufzuchtbecken vergebens.
Wichtig ist auch die richtige Ernährung der Larven. „Es muss jederzeit genug Nahrung angeboten werden, damit optimales Wachstum und ein guter Ernährungszustand der Larven gewährleistet ist“, so Szyja. „Die ersten zwei Wochen haben wir mit Artemia-Krebsen gefüttert. Danach sind wir auf rote Zuckmückenlarven umgestiegen – zuerst gehackt, da sie noch zu groß für die Jungtiere waren, später dann im Ganzen.“
Wiederansiedlung
Das Ergebnis seiner Arbeit: 4.500 junge Schlammpeitzger, nach sieben Wochen bei optimaler Versorgung in der Zuchtanlage 4 cm groß und bereit zur Auswilderung. Einige Hundert weitere Jungtiere aus der Nachkommenschaft verbleiben in der Fischzuchtanlage für eventuelle Folgeprojekte.Die neue Heimat der Tiere: ein Grabensystem der Donau zwischen Straubing und Deggendorf. Das Gewässer weist alle Habitatstrukuren auf, die der Schlammpeitzger braucht, begonnen von der dicken Schlammauflage bis hin zur dichten Vegetation. Im Rahmen einer Elektrobefischung wurde im Vorfeld zudem festgestellt, dass keine anderen Raubfische vorkommen.
Entstanden ist das Grabensystem als Ausgleichmaßnahme für eine Deichrückverlegung an der Donau. Der von der Wasserbaulichen Infrastrukturgesellschaft mbh (WIGES) geschaffene Lebensraum wartet sogar noch mit einem weiteren Pluspunkt auf: Die Gräben werden nicht wasserbaulich unterhalten. Die Gefahr, von einer Grabenfräse zermalmt zu werden, besteht für die kleinen Schlammpeitzger also nicht.
Ausgebracht wurden die 4.500 Jungtiere an drei Besatzpunkten im Donaugraben. Nun sind sie auf sich allein gestellt. Ob die Tiere sich auch tatsächlich in ihrem Besatzgewässer etablieren, soll nun ein Monitoring zeigen. Zweimal sollen die Schlammpeitzgerbestände im Jahr 2022 mithilfe der Elektrofischerei gefangen, gezählt und vermessen werden. „Wir erhoffen uns natürlich, dass sich die Art am Standort etabliert und dann auch eine Ausbreitung stattfindet“, erklärt Lukas Ittner. Das könnte allerdings einige Zeit dauern. „Die Art ist wenig mobil“, erklärt er. Bernolle ergänzt: „Die Hauptausbreitung findet dann bei größeren Hochwässern statt, die auch die Grabensysteme erreichen können.“
Zukunftswünsche
Der Wunsch des Trios für die Zukunft ist, dass sich der Schlammpeitzger in seinem neuen Zuhause dauerhaft etabliert und eigenständig reproduziert. Damit wäre ein Grundstein für den aktiven Schutz dieser Art in Bayern gelegt, wenn zudem noch faunenschonend gepflegt wird. Falls das eintritt, könnte das Artenhilfsprogramm vielleicht sogar als Blaupause für weitere Schlammpeitzger-Projekte dienen.
Projektdaten
- Name: Artenhilfsprogramm (AHP) Schlammpeitzger(Misgurnus fossilis)
- Projektstart: November 2020, Besatz Herbst 2021, Monitoring ab Frühjahr 2022
- Maßnahmenträger: Bayerisches Landesamt für Umwelt
- Kooperationspartner: Kooperation mit Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mBH (WIGES), Fachberatung für Fischerei des Regierungsbezirks Niederbayern
- Zielart: Europäischer Schlammpeitzger(Misgurnus fossilis)
- Lebensraum: Grabensysteme der Donau zwischen Deggendorf und Straubing (Zielgewässer); im Fokus stehen die typischen Lebensräume des Schlammpeitzgers: seichte, langsam fließende bis stehende Niederungsgewässer mit dichtem Pflanzenbewuchs und schlammigem Grund wie Gräben, Altwässer, Seitengewässer und Tümpel in Feuchtgebieten oder der Aue.

Dominik Bernolle ist ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit über einem Jahr im Referat für Fisch- und Gewässerökologie tätig. Seine Schwerpunkte sind die Bearbeitung und Prozessoptimierung von Wärmelastverfahren, das Fischmonitoring und Artenhilfsprogramme.
Martin Szyja ist Fischwirt bei der zuständigen Fischzuchtanlage in Wielenbach. Ihm obliegt die Produktion von Versuchstieren und (bedrohten) Kleinfischarten und Krebsen.
Kontakt
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160
D-86179 Augsburg
E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de
www.lfu.bayern.de
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen



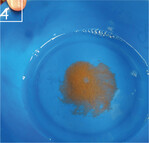

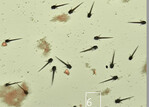














Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.