Platz für Uferschnepfe und Co!
- Veröffentlicht am
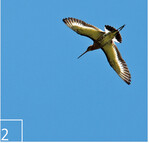
Ein heißer Sommertag, über 30 °C im Schatten. Mit meiner Kamera stehe ich am Rand einer Wiese. Sie ist noch zum Teil überflutet, was wohl auch die unzähligen Bremsen fördert, die mir deutlich zu verstehen geben, was sie von meinem Insektenspray halten. Aber ich habe es heute auf andere Flugkünstler abgesehen: Über der Wiese kreisen mehrere Uferschnepfen und sie sind es, die ich heute fotografieren will.
Heinrich Belting hat mir den Tipp gegeben, wo ich die Tiere momentan am besten finden kann. Er ist hier aufgewachsen, kennt den See und die umliegenden Flächen in- und auswendig. Mit seinem Team weiß er immer ganz genau Bescheid, wo am Dümmer See sich die Wiesenvögel gerade aufhalten. Im LIFE-Projekt „Wiesenvögel“ steht er in engem Kontakt mit den Landwirten, die die extensiv genutzten Wiesen im Naturschutzgebiet rund um den See pflegen. Es darf nur dort gemäht und geweidet werden, wo gerade keine Vögel sind.
Erste Erfahrungen
Für den Dümmer ist das LIFE-Projekt gar nichts Neues, denn das Projekt hatte hier schon zwei Vorläufer. Bereits in den Jahren 1998 und 2002 fanden hier zwei kleinere LIFE-Projekte statt, in denen die damals als Intensivgrünland genutzten Flächen rund um den See wiedervernässt wurden. Dazu wurden 2.500 ha Land angekauft, es gab sechs Flurbereinigungsverfahren und drei Höfe wurden umgesiedelt. In einem der alten Höfe ist heute die Naturschutzstation untergebracht – für Belting ideal, denn so konnten die neuen alten Bewirtschaftungsformen und sämtliche Wiedervernässungsmaßnahmen direkt am Ort des Geschehens gesteuert werden. 50 Wehre, 80 km Gräben und 20 km Sammelgräben sorgen nun gemeinsam mit drei elektrischen Pumpen und drei Windpumpen dafür, dass die Wiesen im Winterhalbjahr geflutet werden können. Zudem wurden 20 Jahre lang die Flächen Stück für Stück ausgehagert.
Und das mit Erfolg: Dank der extensiven Bewirtschaftung, der gezielten Aushagerung und weiterer Offenhaltungsmaßnahmen haben sich die Wiesen am Dümmer ganz im Sinn des Naturschutzes entwickelt: zu offenen Feuchtwiesen mit niedriger, lückiger Vegetation und hohen Wasserständen. „Tatsächlich haben wir das einzige Gebiet in Niedersachsen, wo sich die Wiesenvögel prächtig entwickelt haben“, betont der Biologe Belting und legt die Monitoringzahlen vor, um die positive Entwicklung zu unterstreichen. So rasten heute am Dümmer wieder mehr als 15.000 Kiebitze – 30 Jahre zuvor wurden oft nur wenige Tausend verzeichnet. Dazu kamen zahlreiche verschwundene Arten zurück, um am Dümmer zu brüten. Unter ihnen sind die Sumpfohreule, das Tüpfelsumpfhuhn und der Wachtelkönig. Und auch die Zahl der Brutpaare ist stark angestiegen – so hat sich die Zahl der brütenden Uferschnepfen am Dümmer innerhalb von 20 Jahren verdreifacht.
Voneinander lernen
„Es war nur logisch, die Erfolge vom Dümmer auch auf andere wertvolle Flächen in Niedersachsen zu exportieren“, meint Heinrich Belting. Und so ist in diesem Fall die Dümmer-Region nur eine von insgesamt zwölf Projektflächen. Ausgewählt wurden diese Kernzonen anhand alter Bestandslisten der Uferschnepfe. Sie ist die Leitart, auf deren Ansprüche sich die Maßnahmen konzentrieren. „Prinzipiell helfen wir aber allen Arten dieses Lebensraums, wenn wir etwas für die Uferschnepfe tun“, ergänzt der Biologe. Jede der Flächen hat einen eigenen Gebietsbetreuer, der für die Erreichung der Projektziele verantwortlich ist.
Doch dabei sind die Mitarbeiter im Projekt nicht auf sich allein gestellt. Sie können zum einen auf die Erfahrungen zurückgreifen, die durch die beiden LIFE-Projekte am Dümmer See bereits gemacht wurden. Zum anderen organisieren die Projektverantwortlichen regelmäßig Expertenbereisungen in die verschiedenen Gebiete. „Da kriegen die Gebietsbetreuer manchmal die Augen geöffnet“, schmunzelt Belting. „Das liefert schon wertvollen Input, was alles machbar ist.“
Ungleiche Voraussetzungen
Vom Erfolg am Dümmer lässt sich aber nicht automatisch auf Erfolg in den anderen elf Projektgebieten schließen, denn die Ausgangsvoraussetzungen sind äußerst verschieden und jeder Gebietsbetreuer muss sich mit ganz eigenen Herausforderungen auseinandersetzen.
Ein wesentlicher Faktor ist der Zustand, in dem die Gebiete zum Projektstart waren. Die Dümmer-Region hat durch das jahrelange Management bereits einen weiten Vorsprung vor anderen, bei denen oft noch klassische Grünlandbewirtschaftung vorliegt. „Manche der Gebiete sind bislang nicht einmal als Naturschutzgebiet ausgewiesen“, erzählt Belting. „Ohne Flächenankauf ist das ein Kampf gegen Windmühlen.“ Auch ist hier die Flächensituation eine andere: Die Flächen am Dümmer wurden vor 20 Jahren aufgekauft, als das Land noch verhältnismäßig günstig zu erwerben war. „Heute haben sich die Preise verdoppelt oder gar verdreifacht“, stellt der Biologe fest. Viele Grundbesitzer wollen auch nicht verkaufen. Intensive Kommunikation und eventuell auch Tauschangebote sind vonnöten, um die Flächenvoraussetzungen für eine erfolgreiche Wiedervernässung zu schaffen.
Eine weitere Herausforderung schließt sich direkt an den Flächenerwerb an: Es gilt nicht nur, die Flächen zu besitzen und zu vernässen. Sie müssen auch auf Dauer gepflegt werden. Doch durch die Ausmagerung sind die Flächen ertragsarm und durch Brutzeiten der Bodenbrüter und die Winterüberschwemmungen sind die Mahd- und Weidezeiten stark eingeschränkt. Am Dümmer hat Belting mit seinem Team einen Ansatz entwickelt, um den Landwirten einen größeren Anreiz zu bieten, die Wiesen zu beweiden: Die Naturschutzstation ließ feste Weidezäune installieren, um den Landwirten die Kosten und den Aufwand des Errichtens mobiler Zäune zu ersparen. Bisher mit Erfolg: Auf verschiedenen Flächen weiden in geringer Besatzdichte Rinder, immer in enger Absprache mit den Flächeneigentümern, um die Brutvögel nicht zu stören.
Kommunikation ist auch das Stichwort, um Akzeptanz für die Veränderung der Schutzgebiete in der Bevölkerung zu generieren. „Gerade bei der Gehölzentnahme gibt es schnell einen großen Aufstand“, weiß Belting aus seiner Erfahrung zu berichten. Für viele Erholungsuchende sind Gehölze gleichbedeutend mit Natur. Die Ansprüche der Wiesenvögel sind jedoch ganz andere. Eine stete Kommunikation kann hier helfen, die Naturschutz- ergebnisse zu sichern, bekräftigt Belting.
Achtung, Fraßfeind
Neben den Anforderungen an Offenheit und Lückigkeit der Vegetationsbestände ist es vor allem auch der niedrige Prädationsdruck, von dem die Vögel profitieren. Die Prädatoren können dabei je nach Gebiet sehr unterschiedlich sein. Oft sind es Fuchs, Iltis, Hermelin und Steinmarder, die während der Brutzeit viele Tiere reißen. Am Dümmer werden ihre Bestände gering gehalten. Doch hier hat sich ein anderer Beutegreifer auf die Vögel spezialisiert: der Mäusebussard. „Durch die Überschwemmungen im Winter gibt es hier nur wenige Mäuse“, erklärt Belting. „Die Bussarde suchen also andere Beute.“ Jungvögel, die noch nicht flügge sind, werden da schnell zum Opfer..
Doch es sind nicht immer die klassischen Beutegreifer, die den Bruterfolg gefährden. Auf der Insel Borkum sind es auch verwilderte Hauskatzen – und Igel. Erstere reißen Jungvögel und brütende Altvögel, für Letztere – eigentlich überwiegend Insektenfresser – sind die Gelege ein gefundenes Fressen. „Gegen die Katzen können wir nicht viel machen“, gibt Belting zu. „Da haben wir beinahe Schiffbruch erlitten. Die Tierschutzorganisationen haben da sehr schnell Alarm geschlagen.“ Bei der Igelpopulation auf der Insel sieht das schon anders aus: Die Tiere werden am Naturschutzgebiet abgefangen und aufs Festland verbracht. Eine Sisyphosaufgabe, denn es kommen immer neue Individuen nach.
Auch wenn die Herausforderungen variieren, die Kernaufgabe ist in allen Gebieten die Gleiche: „Die Vernässung ist immer der Schlüsselfaktor“, betont Belting. Fanggräben um die Flächen verhindern, dass angrenzende Felder oder Siedlungsflächen überflutet werden, Einstaubauwerke, Spundwände und Windpumpen sorgen für die Wasserversorgung der Gebiete. Erst wenn diese Grundvoraussetzung geschaffen ist, können die Lebensräume durch Mahd, Beweidung und Gehölzentnahme optimiert werden.
Flugüberwachung
Ob die Bemühungen auch tatsächlich erfolgreich sind, zeigt das Monitoring, das an das Projekt angegliedert ist. Dazu erfolgen regelmäßige Kartierungen, außerdem werden die Tiere besendert, um ihre Flugrouten nachvollziehen zu können. Das klingt allerdings einfacher, als es ist, denn der Zeitpunkt zum Fangen der Tiere muss genau erkannt werden. „Das muss wirklich eine Punktlandung sein. Die Jungvögel müssen schon fliegen können, aber eben noch nicht zu viel“, erklärt der Biologe. Das Zeitfenster beträgt oft nur einen halben Tag. Hilfe erhalten die Mitarbeiter dabei von niederländischen Kollegen. Die haben einfach größere Erfahrung und können tatkräftig unterstützen.
Überwacht werden können die Flugrouten dann am Computer. Im Portal „King of the meadows“, das über die Projekthomepage zu finden ist, kann jeder Einzelvogel ausgewählt und seine Flugrouten nachvollzogen werden. Das soll helfen, das Verhalten der Tiere besser zu verstehen und die Maßnahmen zu optimieren.
Die seltenen Uferschnepfen sind, auch wenn sie als Leitart im Fokus stehen, nicht die Einzigen, die von dem Projekt profitieren. Auch Schafstelzen, verschiedene Gänse, Schwäne, Störche – sie alle werden durch die extensive Pflege der Wiesen gefördert. Doch so hoch die Qualität der Flächen auch sein mag – die Tiere verbringen hier nur die Sommermonate, im Winter ziehen sie gen Süden.
Belting arbeitet daher intensiv an einer Kooperation mit den Fachkollegen im Senegal, wo die Uferschnepfen ihre Winterquartiere aufsuchen. „Im Augenblick tun die dort noch nicht sehr viel, aber das wesentliche Problem derzeit sind die Brutgebiete“, erklärt er. Dieser Zustand könnte sich aber bald umkehren, denn mit der Veränderung der Landwirtschaft in dem afrikanischen Land rückt der Reisanbau zunehmend in den Vordergrund – mit verheerenden Auswirkungen auf die derzeit naturschutzfachlich hochwertigen Feuchtgebiete. Die Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort, mit Nationalparks, Reservaten und Wissenschaftlern, ist dem Biologen ein wichtiges Anliegen.
Projektdaten
- Projektträger und Zuwendungsempfänger: Land Niedersachsen vertreten durch das Niedersächsische Umweltministerium
- Projektbetreuung: Heinrich Belting, NLWKN
- Laufzeit: 2011 - 2020
- Finanzierungsumfang: 40 Mio. € (inkl. Komplementärmittel)
- Finanzierung: 60 % EU, 40 % Land Niedersachsen mit Unterstützung durch Landkreis Leer und Umweltstiftung Landkreis Emsland
- Mitarbeiter: 20
Philosophie
Wir möchten in den Kerngebieten der Wiesenvogelverbreitung die Schlüsselfaktoren konsequent umsetzen. Das betrifft die gesamte Region einschließlich der Zug- und Überwinterungsgebiete. Wir müssen den Gesamtzyklus betrachten und eine enge Kooperation mit den Landwirten pflegen.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen





















Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.