Die Gelbbauchunke
Die Rubrik „Naturschutz- und Planungsrecht“ behandelt praxisrelevante Rechtsgrundlagen und berichtet über Entwicklungen aus Rechtsprechung und Gesetzgebung.
Für Anregungen zu dieser Ausgabe bedanken wir uns bei Prof. Dr. Martin Dieterich (Universität Hohenheim / Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz Südwest).
- Veröffentlicht am

Die Gelbbauchunke, einer der erdgeschichtlich ältesten heute noch vorkommenden Froschlurche, gehört zu den Intensivpatienten auf der Naturschutzstation. Ihr Erhaltungszustand ist schlecht, mit einer starken Tendenz zu einer noch weiteren Verschlechterung. Man findet die Art heute fast nur noch in isolierten Abbaugebieten sowie in bewirtschafteten Wäldern. Ob diese kleine, konkurrenzschwache Pionierart, die austrocknungsgefährdete Kleinstgewässer nutzt, in ihren von Menschen genutzten Sekundärbiotopen existieren darf, entscheidet sich vornehmlich in Mittel- und Süddeutschland. Wir tragen für den Erhalt dieser Art eine entscheidende Verantwortung, weil Deutschland im Zentrum des Hauptverbreitungsgebietes liegt und einen Großteil des globalen Vorkommens der Gelbbauchunke beherbergt.
1. FFH-Verträglichkeitsprüfung
Die Gelbbauchunke ist in Anhang II der FFH-Richtlinie gelistet, sodass für sie FFH-Gebiete ausgewiesen worden sind. Wurde die Gelbbauchunke als artbezogenes Erhaltungsziel eines FFH-Gebietes festgelegt, dürfen Pläne und Projekte dieses Erhaltungsziel nicht erheblich beeinträchtigen, was durch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung naturschutzfachlich zu belegen ist. Da Gelbbauchunken primär im Wirtschaftswald vorkommen, rückt die neue EuGH-Entscheidung zum Auerhuhn in den slowakischen Wäldern in den Fokus. Daraus ergibt sich, wie bereits aus der Entscheidung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts zum Leipziger Auwald, dass Forstwirtschaftspläne und forstliche Maßnahmen als Pläne beziehungsweise Projekte im Sinne des Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie anzusehen sind. Sie unterliegen somit der Verträglichkeitsprüfung mit den Erhaltungszielarten, soweit kein in den Forstwirtschaftsplan integrierter FFH-Bewirtschaftungsplan vorliegt (EuGH, Urteil vom 22.06.2022, Az. C-661/20, Rn. 56-77). Nur wenn ein FFH-Bewirtschaftungsplan mit einem aktiven Erhaltungskonzept für die Erhaltungszielarten in den Forstwirtschaftsplan integriert wird, bedarf es keiner FFH-Verträglichkeitsprüfung.
a) Vorprüfung
Die FFH-Vorprüfung ist die überschlägige Prüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG, ob erhebliche Beeinträchtigungen eines FFH-Gebiets mit Sicherheit bereits in offensichtlicher Weise ausgeschlossen werden können. Wegen des Kriteriums der Offensichtlichkeit dürfen geplante Milderungsmaßnahmen, wie etwa Amphibienschutzzäune, auf der Ebene der FFH-Vorprüfung noch nicht berücksichtigt werden. Gelbbauchunkenhabitate unterliegen als Grundvoraussetzung für deren ökologische Eignung einer hohen und im Idealfall zufallsgesteuerten Dynamik. Diese Dynamik ergibt sich im Forst aus der bewirtschaftungsbedingten Entstehung von Fahrspurpfützen auf Rückegassen. Eine räumliche Festlegung von Reproduktionsgewässern ist für diese Dynamikart daher eher großräumig auf zu Vernässung neigenden Standorten möglich. Die Lebensweise der Dynamikart „Gelbbauchunke“ ist außer auf Ortstreue auch auf Wanderung ausgerichtet (Laichwanderung, Ortsbewegung zwischen verschiedenen Kleingewässern und Ausbreitungswanderung). Wegen der Bedeutung der Wanderung und der bevorzugten Besiedlung neu entstandener Rohbodengewässer ergeben sich für diese Pionierart in der Praxis auch Schutzanforderungen bei Projekten im Umfeld von FFH-Gebieten. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen auch außerhalb von FFH-Gebieten ist ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren ohne Umweltprüfung tendenziell nicht möglich. Darauf hat das OVG NRW anlässlich eines FFH-Gebiets, welches unter anderem dem Schutz der Gelbbauchunke dient, jüngst hingewiesen, als es den Bebauungsplan „An der alten Kläranlage“ der Stadt Erwitte auf Antrag des BUND für unwirksam erklärte (Urteil vom 07.04. 2022, Az. 2 D 378/21.NE, Rn. 22 ff.):
„Der Bebauungsplan … hätte nicht im beschleunigten Verfahren nach §§ 13a, 13b BauGB – ohne Durchführung einer Umweltprüfung – beschlossen werden dürfen. … Hiervon ist im Ansatz auch die Antragsgegnerin [Stadt Erwitte] ausgegangen und hat eine fachgutachterliche FFH-Vorprüfung im Hinblick auf die jeweils weniger als 100 m vom Plangebiet entfernten FFH- bzw. VGS-Gebiete durchführen lassen. Diese kam indes zu dem Ergebnis, dass Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes ‚Manninghofer Bach sowie Gieseler und Muckenbruch‘ nicht auszuschließen seien und mithin eine FFH-Vollprüfung erforderlich sei – mit der Folge, dass zugleich das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB ausscheidet, weil diese FFH-Prüfung als Umweltprüfung im Regelverfahren zu erfolgen hat. … jedenfalls ist das von der Antragsgegnerin [Stadt Erwitte] gewählte Vorgehen nach der eindeutigen … Rechtsprechung des EuGH in seinem Urteil vom 12. April 2018 – C-323/17 (People over wind) von vornherein unzulässig. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen („Abschwächungsmaßnahmen“) i. S. v. Art. 6 Abs. 3 der Habitatrichtlinie sind danach allein im Rahmen der vertieften Natura-2000-Prüfung berücksichtigungsfähig, nicht aber auf der vorgelagerten Ebene, ob eine solche überhaupt durchzuführen ist. … Der damit hier festzustellende Fehler in der Verfahrenswahl ist nach § 214 Abs. 2a BauGB auch beachtlich und führt notwendig zur Gesamtunwirksamkeit des angegriffenen Bebauungsplans.“
Nusser (2021) ermittelte in ihrer Masterarbeit an der Universität Hohenheim durchschnittliche Wanderdistanzen von 500 m, mit Maximaldistanzen innerhalb einer Aktivitätsperiode von über 2.000 m bei Männchen beziehungsweise 2.500 m bei Weibchen, so dass der eine Verträglichkeitsprüfungspflicht auslösende Umgebungsschutz für ein FFH-Gebiet mit der Gelbbauchunke als Erhaltungszielart bei mindestens 500 m liegt.
b) Hauptprüfung
Pläne und Projekte sind gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig, wenn sie zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets in seinem für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen.
Das Verwaltungsgericht Stuttgart befasste sich anlässlich der Genehmigung eines Windparks mit der Frage, wie mit Gelbbauchunken als Erhaltungsziel eines FFH-Gebiets umzugehen ist, wenn die Art zwar im Vorhabengebiet vorkommt, sich die bekannten Habitate aber außerhalb der Bauflächen (Windenergieanlagen) befinden. Die Richter verneinten eine Beeinträchtigung im Sinne von § 34 Abs. 2 BNatSchG, wenn die folgenden zwei Punkte in dem Genehmigungsbescheid festgelegt werden: Befinden sich relevante Habitaträume der Gelbbauchunke außerhalb der Bauflächen, so sind diese Bereiche mit Amphibienschutzzäunen mit Überhangschutz vom Baufeld abzugrenzen und über die Ökologische Baubegleitung auf Funktionsfähigkeit zu kontrollieren. Die Bildung großer Pfützen und Mulden im Bereich der befahrenen, geschotterten Bauflächen, die eine potenzielle Laichstelle für Gelbbauchunken darstellen können, sind zu vermeiden; entstandene Mulden sind unverzüglich mit Schotter aufzufüllen, damit keine geeigneten Habitatbedingungen für diese Pionierart entstehen (Beschluss vom 23.10.2019, Az. 13 K 1922/19, Rn. 70).
2. Artenschutzrecht
Als Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie unterfällt die Gelbbauchunke nicht nur dem FFH-Gebietsschutz, sondern auch dem Schutzregime des besonderen Artenschutzes nach §§ 44, 45 BNatSchG. Die Auswertung der juristischen Rechtsprechungsdatenbanken ergibt insoweit den Befund, dass das Artenschutzrecht hinsichtlich der Gelbbauchunke in Betriebsplanverfahren für Steinbrüche wohl keine Probleme mehr aufwirft. Wissend, dass diese Pionierart auf Sekundärbiotope mit einem regelmäßigen Pflege- und Störungsregime angewiesen ist, scheinen die verbreiteten Kooperationsvereinbarungen zwischen den Branchen- und Naturschutzverbänden gut zu wirken.
Hinsichtlich der Forstwirtschaft gilt gemäß § 44 Abs. 4 Satz 1 und 2 BNatSchG, dass kein Verstoß gegen das Tötungsverbot und den Lebensstättenschutz vorliegt, soweit sich der Erhaltungszustand der lokalen Population durch die Bewirtschaftung nicht verschlechtert. Anders als in Genehmigungsverfahren bildet hier die lokale Population den Referenzmaßstab für einen Verstoß gegen das Artenschutzrecht. Die FFH-Richtlinie verwendet den normativen Begriff „lokale Population“ jedoch nicht. Als Referenzmaßstab für die Zugriffsverbote ist dies in Bezug auf die Anhang-IV-Arten mit dem höherrangigen Europarecht nicht mehr vereinbar, nachdem der EuGH vergangenes Jahr klargestellt hat, dass die Durchführung der in Art. 12 Abs. 1 FFH-Richtlinie vorgesehenen Artenschutzregelungen nicht davon abhängt, dass eine Maßnahme mit dem Risiko verbunden ist, sich negativ auf den Erhaltungszustand der betroffenen Tierart auszuwirken (EuGH, Urteil vom 04.03.2021, Az. C-473/19 und C-474/ 19, Rn. 57 und 86). So sind in der Praxis zugleich die Individuen und einzelne Lebensstätten in den Blick zu nehmen, was im Hinblick auf den sehr schlechten Erhaltungszustand und die deutsche Verantwortung für die Art auch angemessen ist. Bei der Gelbbauchunke wird laut den Empfehlungen des LANUV ohnehin bereits die einzelne Fortpflanzungsstätte aufgrund der regelmäßigen Kleingewässerwechsel weit abgegrenzt; der Bereich zwischen den Gewässern ist Teil der Fortpflanzungsstätte.Um den Erhaltungszustand eines Vorkommens zu sichern, empfiehlt der neue Praxis-Leitfaden der Universität Hohenheim (Dieterich & Schrell 2022) die Anlage kleinräumiger Dynamisierungsflächen nach dem Prinzip von Wildäckern in Kombination mit der Zulassung von Fahrspurpfützen auf Rückegassen. Daraus könnte sich eine Symbiose von Forstwirtschaft, Jagd und Naturschutz ergeben.
Literatur
Dieterich, M. & Schrell, F.: Entwicklung nachhaltiger Schutzkonzepte für die Gelbbauchunke (Bombina variegata L.) in Wirtschaftswäldern als Leitfaden zum angewandten Gelbbauchunkenschutz in der Forstwirtschaft, hrsg. von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück 2022 (im Erscheinen).
Nusser, K.: Das Wanderungsverhalten der Gelbbauchunke (Bombina variegata L.) am Beispiel der Population des Talwaldes bei Kirchheim unter Teck. Masterarbeit an der Universität Hohenheim 2021.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen










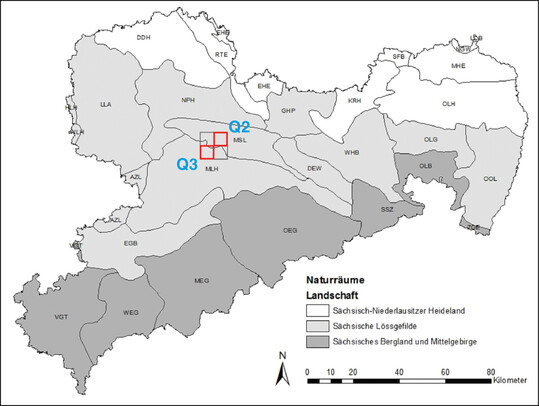
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.