
Was sind die optimalen Bedingungen für stabile Bestände?
Anzahl, Größe, Umgebung und Wasserstand: Erstmals gibt es quantitative Empfehlungen der Wissenschaft, wenn es um den Aufbau neuer ökologischer Infrastrukturen für den Amphibienschutz geht. Ein Team von Forschenden der Eawag, der WSL und der info fauna karch hat die optimalen Bedingungen für das Leben zwischen Wasser und Land analysiert.
von Eawag/Red erschienen am 23.05.2024Im Rahmen der Forschungsinitiative Blau-grüne Biodiversität suchten Forschende des Wasserforschungsinstituts Eawag, der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL und des Informationszentrums der Schweizer Fauna info fauna karch nach einfachen Messgrößen und konkreten Empfehlungen, um der Praxis nützliche Instrumente für die Planung und den Aufbau neuer ökologischer Infrastrukturen durch den Bau von Teichen an die Hand zu geben.
Zwei bis vier besiedelte Teiche pro Quadratkilometer
„Wenn man einen Standort für einen neuen Teich sucht, sollten in einem Umkreis von rund 560 m bereits zwei bis vier Teiche oder Feuchtgebiete vorhanden und von der Art, die man fördern will, besiedelt sein“, fasst Helen Moor, Leiterin der Eawag-Forschungsgruppe Ökologische Modellierung, die wichtigste Empfehlung zusammen. „Dann sind die Chancen sehr groß, dass die gewünschten Amphibien in den neuen Teich zuwandern und ihn auch langfristig als Lebensraum annehmen.“
Mindestens 100 m2 Wasserfläche und gelegentliches Austrocknen
„Neue Teiche oder Feuchtgebiete sollten eine Wasserfläche von mindestens 100 m2 haben. Dann sind sie gute Laichgebiete für die meisten Amphibien“, ergänzt Helen Moor. Das kann ein größerer Teich sein, besser sind jedoch mehrere kleine Teiche in unmittelbarer Nähe. Die individuellen Bedürfnisse können von dieser allgemeinen Empfehlung abweichen. „Unser Sorgenkind, die Kreuzkröte, die in der Schweiz sehr selten geworden ist, fühlt sich in Amphibienlaichgebieten besonders wohl, wenn mehr als 1.000 m2 vorhanden sind.“ Hilfreich für die gefährdete Krötenart wären Flächen, die immer wieder großflächig überschwemmt werden, im Sommer aber auch wieder austrocknen.
Teiche, die gelegentlich austrocknen, sind für viele Amphibienarten vorteilhaft, da Fressfeinde wie Libellenlarven oder Fische dort nicht überleben. „Neue Teiche sollten so konstruiert werden, dass der Wasserstand schwankt und manchmal auch auf null fällt“, so Helen Moor. Wo natürliche Grundwasserschwankungen dies nicht zulassen, kann man zum Beispiel Ablassvorrichtungen in einen Teich einbauen.
Offene, leicht bewaldete Umgebung
„Die Umgebung der neuen Teiche sollte offen und nicht mehr als ungefähr zu 50 % bewaldet sein“, ergänzt Helen Moor ein weiteres Kriterium. Wälder sind einerseits wichtige Lebensräume für die Amphibien, sobald sie das Wasser verlassen haben. Andererseits brauchen einzelne Arten wie die Geburtshelferkröte in der Nähe des Gewässers sonnige Böschungen mit sandigem, grabbarem Boden, Steinhaufen oder Trockenmauern. Diese Krötenart paart sich an Land bei einer selbstgebauten, feuchtwarmen Wohnhöhle des Männchens. Die Männchen wickeln die Gelege anschließend um ihre Hinterbeine und tragen sie erst dann zum Gewässer, wenn die Eier reif sind. Kurze Zeit nach dem Wasserkontakt schlüpfen dann die Kaulquappen. Eine diverse Landschaft in der Umgebung der Feuchtgebiete ist daher für das Leben zwischen Wasser und Land optimal.
Bitte keine Goldfische!
„Mit den konkreten Empfehlungen für den Bau von ökologischen Infrastrukturen wie Netzwerken von Teichen wollen wir die Praxis unterstützen, die Vielfalt an Amphibienarten zu fördern“, sagt Helen Moor. Neue blau-grüne Lebensräume anzulegen, ist eine sehr effiziente Maßnahme, um der lokalen Biodiversität insgesamt etwas Gutes zu tun. Auch andere Tiere und Pflanzen profitieren vom Nass – sei es als Quelle für Wasser und Nahrung, als Rückzugsort oder als Lebensraum.
Kleine Gewässer sind außerdem relativ einfach zu bauen und können mit wenig Aufwand in intensiv genutzte Landschaften integriert werden. „Ähnlich wie Hecken lassen sich Teiche einfach am Rande von Ackerflächen einfügen“, sagt Helen Moor. „Oder auch im Siedlungsraum in Parks und Gärten. Aber bitte keine Goldfische im Teich! Die lieben Froschlaich und fressen die Gewässer nur wieder leer.“
Wichtig für die lokale Biodiversität ist zudem, möglichst verschiedene Teichtypen zu bauen, permanent und temporär, von unterschiedlicher Größe und in unterschiedlicher Umgebung. Eine vielfältige Landschaft fördert eine vielfältige Artenzusammensetzung und nicht zuletzt auch vielfältige Ökosystemfunktionen für Mensch und Umwelt.
Datengrundlage der Studie
Die Grundlage der Studie war die langjährige Datenreihe eines Monitoring-Programms des Kantons Aargau, das den Bau von hunderten von Teichen seit über 20 Jahren begleitet. Beobachtet werden zwölf Amphibienarten: Geburtshelferkröte, Teichmolch, Kammmolch, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Laubfrosch, Wasserfrosch, Bergmolch, Teichmolch, Erdkröte, Grasfrosch und Seefrosch, wobei die sieben erstgenannten Arten stark vom Rückgang betroffen sind. Die Behörden reagierten Ende der 1990er Jahre auf den Rückgang mit einem umfangreichen Teichbauprogramm, das sich auf fünf Regionen mit bedeutenden Restpopulationen der gefährdeten Arten konzentriert. Das Forscherteam dankt allen Freiwilligen im Feld für ihre unschätzbare Arbeit und dem Kanton Aargau für die Erlaubnis, die Daten zu verwenden.









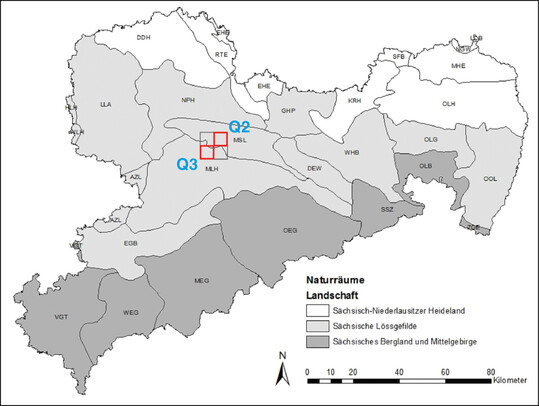
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.