
Auf feuchten Böden sinnvoll wirtschaften
Das Unternehmen mera Rabeler hat ein neuartiges Kettenfahrzeug für die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten und sensiblen Bereichen entwickelt. Gemeinsam mit der Universität Greifswald werden die Einsatzmöglichkeiten dieses Fahrzeuges in verschiedenen Projekten zur Bewirtschaftung von Paludikulturen getestet. Sondermaschinenbauer Christian Wentzien (mera Rabeler) und Josephine Neubert (Uni Greifswald) stellen das Projekt vor.
von Julia Schenkenberger erschienen am 08.05.2024
mera Rabeler GmbH & Co. KG Lindenstraße 3 21435 Stelle – Ashausen Tel.: +49(0)1515/1479177 Web: www.mera-rabeler.de










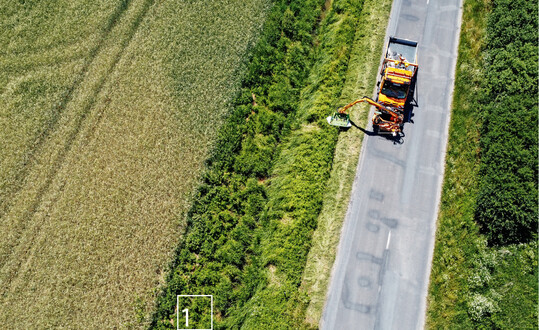



Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.