Firmengelände – aber naturnah!
- Veröffentlicht am

„Wir Menschen haben uns selber vergessen!“ Dies ist einer der ersten Sätze, die ich von Anton Robl höre. Gefragt hatte ich nach der Projektidee des LIFE-Projekts über naturnah gestaltete Firmengelände, an dem er beteiligt ist. Robl ist Landschaftsarchitekt. Aber einer, für den nicht die Planung im Fokus steht. Sondern der Mensch. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich ein grünes Umfeld positiv auf das Wohlergehen und somit auf die Gesundheit auswirkt“, betont er. „Es geht um das Potenzial naturnahen Grüns im urbanen Raum, in den Gewerbe- und Industriegebieten, an sozialen und medizinischen Einrichtungen – und zwar für die Beschäftigten, für die Pflanzen und die Tiere.
„Warum fehlt dann das Grün gerade dort, wo wir uns täglich aufhalten? Kreativität kann doch nur dann entstehen, wenn es auch dem Menschen gut geht!“ So lassen sich die eigenen Potenziale nicht entwickeln, meint er. „Nur wenn der Mensch sich in seiner Umwelt wohlfühlt, entspricht er auch in seinem Handeln dieser wohltuenden Lebensvielfalt.“ Robl spricht deshalb auch von der „Mitwelt“ – einer Gesamtheit, die den Menschen in die Umwelt mit einbezieht. Und ein hohes Maß an Naturnähe in der Arbeitsumgebung fördert in seinen Augen auch langfristig die Produktivität der Mitarbeiter.
Diesen Ansatz hat er auf seine Planungen übertragen. Nicht er ist hier der Ideengeber. „Ich kann nur gemeinsam mit dem Bauherrn und im Bewusstsein der Präsenz des Ortes gut planen“, erklärt er. Die Idee entsteht dann im intensiven Dialog. Das „Wesen des Ortes“ bezieht der Landschaftsarchitekt in den Prozess der Entwurfsentwicklung ebenso mit ein wie die Bedürfnisse der Menschen, die sich dort aufhalten. Robl hat ganz eigene Ansätze, scheut sich auch nicht, seine Kunden im Gesprächsverlauf zu fordern.
Interaktive Planung
So ging es auch Reinhard Schiegl, Geschäftsführer von IRS, einem Unternehmen für Mess- und Prüftechnik. 1998 beschloss Schiegl, seinen Firmensitz etwas außerhalb der bayerischen Gemeinde Brennberg zu bauen, auf dem Land seines Vaters, sozusagen auf der „grünen Wiese“. Ein Nachbar empfahl Anton Robl für die Planung der Außenanlagen. „Ich bin egoistisch“, scherzt Schiegl. „Für mich war es wichtig, dass ich mich hier wohlfühle.“ Dass eine ansprechende Gestaltung auch seinen Mitarbeitern zugutekommt, war ein weiterer Faktor, der ihn überzeugte, das Projekt Außenanlagen in einer zur Landschaft stimmigen und natürlich gestalteten Weise anzugehen.
Schiegl denkt sehr rational, eher technisch. Da war der Dialog mit dem Planer Robl etwas Neues. „Er bringt vieles von der rationalen Ebene auf eine Gefühlsebene“, meint Schiegl. „Wir leben zum Teil in anderen Welten, aber genau das macht es spannend.“ Diskussionen gab es viele, doch am Ende entstand ein Produkt, das nicht dem typischen Bild eines Firmengeländes entsprach: Eine Planung, die sorgfältig mit dem Bestand umgeht, erhält, was erhaltenswert erscheint, aber auch Elemente hinzufügt, wo es nötig ist. Und so ist es hier ungewöhnlich grün, mit natürlich anmutenden Wiesen, alten Eichen und großen Granitfelsen im Bestand, oft dicht von Moosen und Flechten überzogen.
Inzwischen ist der Betrieb mehrfach gewachsen, von damals zehn Mitarbeitern auf heute gut 70. Mit den Erweiterungen wurde auch das Gelände mehrfach angepasst. Immer standen die betrieblichen Funktionen, aber auch die Menschen gemeinsam im Fokus: Wie kann das Gelände gestaltet werden, damit die Angestellten direkten Zugang zu Grün haben? Wie kann eine Standortvielfalt geschaffen werden, um mehr Artenvielfalt zu ermöglichen? Wie kann die Morphologie den betrieblichen Anforderungen an Lagerhallen, Werkstätten, Anlieferung und Parkplätze angepasst werden, ohne den Bezug zur Landschaft zu verlieren?
Heute wirkt das Gelände wie natürlich gewachsen, Büro- und Betriebsgebäude und gestaltete Außenanlagen fügen sich harmonisch ineinander. Die Wiesenflächen sind krautreich, hier blühen Margeriten, Wiesenfuchsschwanz, Wiesen-Salbei und Glockenblumen. Felsen und Bänke bieten Sitzmöglichkeiten. Bodentiefe Fenster öffnen den Innenraum direkt in die Landschaft. Trotz dieses natürlichen Charakters wirkt die Fläche gepflegt. Stauden säumen den Weg zum Haupteingang und gehen fließend in die Wiesenbereiche über. Höhenunterschiede werden mit Mauern aus demselben Gestein abgefangen, das bei den Erdbewegungen mit ausgegraben wurde. Hier tummeln sich Eidechsen, und auch sonst zwitschert und summt es überall.
Firmengelände mit Vorbildcharakter
Das Gelände von IRS ist heute Vorbildunternehmen und Referenzprojekt des LIFE-Projekts BooGI-BOP in ganz Europa. Die Abkürzung steht für die englische Projektbezeichnung „Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-Oriented Design of Business Premises“. Sowohl Anton Robl als auch Projektleiter Sven Schulz von der Bodensee-Stiftung hatten schon Erfahrungen gesammelt in der biodiversitätsfördernden Gestaltung. „Nachhaltige Wirtschaftsweisen bewegen uns“, erklärt Schulz. „Das liegt in unserer DNA.“ Schnell tat er sich mit der Schweizer Stiftung Natur und Wirtschaft zusammen, um ein erstes regionales Projekt durchzuführen. Im Fokus immer die Frage: Wie können mehr Natur und Lebensvielfalt in Gewerbegebiete gebracht werden? Was auf regionaler Ebene begann, sollte sich dann schnell vergrößern und europaweit greifen. „Das ist sozusagen eine Initialzündung für ganz Europa“, erklärt Robl. „Wir wollen den Leuten den Mehrwert aufzeigen, der sich ergibt, wenn Ökologie, Ökonomie und Soziales zusammen gedacht werden. Das stärkt das Bewusstsein für unsere Grundbedürfnisse und zeigt auf, wie zukunftsorientierte Gewerbeflächen aussehen können.“
Dabei muss es nicht immer eine vollständige Umgestaltung des Geländes sein. „Naturnähe fängt schon im Kleinen an“, betont Schulz. „Und wenn es erst einmal nur ein Nistkasten ist.“ Ihm geht es darum, die Potenziale des einzelnen Unternehmens auszuloten und dann über einen niederschwelligen Einstieg Naturnähe zu fördern. Ein weiteres Ziel im Projekt ist, möglichst viele Architekten, Ingenieure, Facility Manager und Kommunen über die Möglichkeiten der Förderung der Artenvielfalt im urbanen Raum aufzuklären.
Dieses Umdenken fokussiert sich im Projekt vor allem auf die Stärkung der Grünen Infrastruktur und wirkt somit der laufenden Fragmentierung der Landschaft entgegen. Die Projektpartner verfolgen den Ansatz, die auf Firmenarealen entstehenden Lebensräume als Trittsteine zu vernetzen und für heimische Arten der Flora und Fauna auszubauen – ganz im Sinne der EU-Biodiversitätsstrategie. „Natürlich werden wir damit kein Naturschutzgebiet ersetzen“, gibt Schulz zu. „Aber auch im kleinen Rahmen können Sie viel erreichen.“
Weit gesteckte Ziele
Dabei haben sich die Projektpartner ambitionierte Ziele gesteckt: Innerhalb von drei Jahren wollen sie 20.000 kleine und mittlere Unternehmen sowie Konzerne erreichen. Es gibt ein Kontingent für Erstberatungen interessierter Unternehmen. Zusätzlich wird zum Zwecke der Information über die Ansätze naturnaher Gestaltung sowie zur Vermittlung von Kontaktadressen für Planung, Bau und Pflege die europäische Plattform www.biodiversity-premises.eu aufgebaut. Daraus erhoffen sie sich, dass mindestens 50 dieser Betriebe ihr Firmengelände wie Schiegl nach den Ansätzen naturnaher Gestaltung umgestalten und zum Teil auch die Pflege ihrer Anlagen darauf anpassen.
Derzeit arbeitet Anton Robl neben seiner Tätigkeit als Landschaftsarchitekt intensiv an diesem Ziel, indem er bei verschiedenen Veranstaltungen über das Projekt berichtet und den Projektgedanken weiterträgt. Zudem steht umfangreiches Informationsmaterial in Form von Roll-Ups, Broschüren und Datenträgern zur Verfügung.
Bis zum Ende der Projektlaufzeit Ende 2021 planen die Partner, ein europaweites Netzwerk aufzubauen, um biodiversitäts- und bedürfnisorientierte Gestaltungsansätze stärker zu bewerben. Derzeit sind bereits Partner aus vier verschiedenen Ländern eingebunden, das Team um Schulz möchte dies aber auf mindestens sechs Länder und 20 Organisationen ausweiten.
Ein Monitoring soll die Projekterfolge begleiten. „So können wir eine starke Evidenz generieren“, meint Schulz. Die Möglichkeit, eine Anreicherung der Artenvielfalt durch Standortvarianten auch in urbanen Umgebungen zu erzielen, sei durchaus bekannt, man müsse sie aber detailliert belegen. Außerdem könne das Monitoring dabei helfen, die Grünpflege optimal auszugestalten, denn im Rahmen des Projekts übernimmt die Pflege die Steuerungsfunktion zur Entwicklung artenreicher Lebensräume.
Mehr als eine Sprache
Doch das Monitoring ist keine ganz einfache Aufgabe, wie Robl feststellt: Die wissenschaftliche Herangehensweise der Projektpartner an der Universität Madrid, die das Monitoring entwickeln, ist für den praktischen Landschaftsarchitekten durchaus ungewohnt. Dass sie ökonomische, ökologische und soziale Gesichtspunkte nicht auf Firmengrundstücke beschränken, sondern darüber hinaus für eine gesellschaftsrelevante Dimension erkennbar machen, halten die Partner aller beteiligten Länder jedoch für ein sehr gutes Konzept. Denn alle erkennen: „Es geht hier nicht nur um Artenentfaltung vor und nach der Umgestaltung“, erklärt er. „Die Mitwelt muss ganzheitlich betrachtet werden.“ Das Team wächst gerade zusammen und es klären sich allmählich die unterschiedlichen Ansätze und Denkweisen der Beteiligten. „Wir kommen uns dadurch symbolisch und auch faktisch näher in Europa.“
Alle Partner haben ein hohes Maß an Autarkie im Projekt. Deshalb sieht Projektleiter Sven Schulz auch kein Konfliktpotenzial in den unterschiedlichen Denkweisen. Stattdessen betont er sogar die Notwendigkeit der unterschiedlichen Ausgestaltung der Inhalte in den verschiedenen Ländern. „Das beginnt schon bei den Erstberatungskonzepten“, erklärt er. „Da muss jedes Land seinen eigenen Weg finden.“ Ursache dafür sind beispielsweise unterschiedliche kulturelle Hintergründe. So ist beispielsweise die Farbe Gelb in Spanien ein Niedergangssymbol. Solche Unterschiede und Differenzen muss Schulz im Projekt herausarbeiten. Ihm und der Bodensee-Stiftung fällt es nämlich zu, die Projektpartner zusammenzuhalten und für eine gelungene Kommunikation zu sorgen – sowohl innerhalb des Projekts als auch nach außen. Darüber hinaus werden die Leitfäden für die Beratung von Unternehmen hier entwickelt, in die verschiedenen Sprachen übersetzt und weitergegeben. „Wir entwickeln gemeinsam Ansätze und Werkzeuge“, so Schulz. „Die Partner in den Ländern müssen diese dann für sich anpassen und anwenden.“
Unabhängig vom Monitoring zeichnet sich ein Erfolg bereits deutlich ab: Das Team um Projektleiter Schulz konnte die Deutsche Bahn als Unternehmen für das Projekt gewinnen. „Für die Bahn ist biologische Vielfalt entlang der Trassen bereits ein bekanntes Thema“, erläutert er. „Nun lotet sie aus, was auf den anderen Liegenschaften erreicht werden kann.“ Für das Projekt könnte das Unternehmen zum Zugpferd werden, um einen größeren Bekanntheitsgrad zu erreichen.
Projektpartner:
- Bodensee-Stiftung – Leadpartner, Projektleitung: Sven Schulz
- Amt der Vorarlberger Landesregierung
- Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, S.L.
- Ekopolis Foundation
- Global Nature Fund
- Universidad Politécnica de Madrid
- Institut für lebensbezogene Architektur e.¿V. – Anton Robl
Projektgebiet: Europa
Laufzeit: Juli 2018 bis Dez. 2021
Finanzierung: EU (60 %), Cofinanzierung (40 %)
Finanzierungs-Umfang: 1,7 Millionen Euro
Wir wollen europaweit Wege für eine Praxis der Entwicklung und Förderung naturnaher und bedürfnisorientierter Firmengelände aufzeigen. Unternehmen für die Einbindung von Biodiversität in Management und Entscheidungsfindung sensibilisieren. Potenziale für eine ökologische Flächengestaltung aufdecken und somit einer Grünen Infrastruktur zu einer möglichst hohen Anwendungsverbreitung verhelfen.
Zur Projekthomepage von BooGI-BOP gelangen Sie über den QR-Code oder über den folgenden Link: www.biodiversity-premises.eu
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen









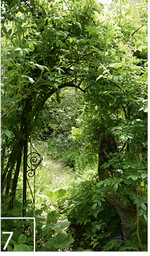











Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.