Pauschalverbot für Windenergie im Wald ist nichtig
- Veröffentlicht am

1. Verbote für Windenergie im Wald
Gut ein Drittel der Fläche von Thüringen sind Waldflächen. § 10 Abs. 1 Satz 2 des im Dezember 2020 in Kraft getretenen Thüringer Waldgesetzes verbot ausnahmslos die Änderung der Nutzungsart von Waldgebieten zur Errichtung von Windenergieanlagen. Das Verwaltungsgericht Gera kam in seinem Urteil vom 24.06.2021 (Az. 5 K 978/20) im Rahmen einer inzidenten Prüfung des Teilplans Windenergie des Regionalplans Ostthüringen noch zu dem Ergebnis, dass durch das Thüringer Waldgesetz kein unüberwindliches Hindernis für die räumliche Gesamtplanung geschaffen worden sei (vgl. die Urteilsbesprechung in NuL 3/2022). Nunmehr entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Verbotsregelung ein ungerechtfertigter Eingriff in den verfassungsrechtlich garantierten Schutz des Eigentums zulasten der Privatwaldeigentümer sei (Beschluss vom 27.09. 2022, Az. 1 BvR 2661/21):
Der Eingriff lässt sich nicht rechtfertigen, weil die angegriffene Regelung formell verfassungswidrig ist. Den Bundesländern fehlt es hierfür an der Gesetzgebungszuständigkeit. Das Grundgesetz benennt das Waldrecht nicht als eigenständige Rechtsmaterie. Daher musste das Bundesverfassungsgericht prüfen, ob die Regelung schwerpunktmäßig dem Bodenrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG) oder dem Naturschutzrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG) zuzuordnen ist. Während im Naturschutzrecht abweichende Landesregelungen nach Art. 72 Abs. 3 Nr. 2 GG teilweise möglich sind, hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit für das Bodenrecht durch das Baugesetzbuch abschließend Gebrauch gemacht, sodass die Länder von der Gesetzgebung ausgeschlossen sind.
Laut Bundesverfassungsgericht liege eine Zuordnung des Pauschalverbots von Windenergie im Wald zur Materie des Naturschutzes nicht fern, weil die Regelung die Erhaltung von Waldflächen betrifft. Die Regelung greife jedoch keinen spezifischen Schutzbedarf von in ihrer Lage konkret schutz- und entwicklungsbedürftigen Waldflächen auf, sondern schütze alle Waldgebiete ausnahmslos vor Bebauung durch Windenergieanlagen und sei so eine bodenrechtliche Regelung zur Freihaltung von Außenbereichsflächen. Um der Gesetzgebungszuständigkeit für Naturschutz zugeordnet werden zu können, müssten gebietsbezogene Regelungen hingegen über den generellen Bedarf nach unbebauter Natur und Landschaft hinaus einem spezifischeren Bedarf dienen, konkrete Bestandteile von Natur und Landschaft zu erhalten oder zu entwickeln.
Waldflächen sind meist Außenbereichsflächen. Bodenrechtlich wird in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB die bauplanungsrechtliche Privilegierung der Windenergie im Außenbereich normiert, welche deren Genehmigungsfähigkeit erheblich erleichtert. Dieses Flächennutzungsregime wird durch § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ergänzt, wonach im Wege der sogenannten Konzentrationszonenplanung auf bestimmten Flächen andere Bereiche des Plangebiets von Windenergieanlagen freigehalten werden können. Es weise laut dem Bundesverfassungsgericht nichts darauf ersichtlich, dass das Baugesetzbuch daneben bodenrechtliche Regelungen der Länder zulassen wollte, welche die Flächennutzung zur Errichtung von Windenergieanlagen im Wald und damit typischerweise im Außenbereich ausschließen. Zwar erlaubt § 249 Abs. 3 Satz 1 BauGB den Ländern gewisse Sonderregelungen, welche die Abstände zwischen Windenergie und Wohnbebauung betreffen. § 10 Abs. 1 Satz 2 ThürWaldG ist trotz ähnlicher, die Errichtung von Windenergieanlagen ausschließender Wirkweise jedoch offensichtlich nicht von dieser Ermächtigung für landesrechtliche Regelungen gedeckt, da es sich nicht um eine Abstandsregelung, sondern um ein waldflächenbezogenes Errichtungsverbot handelt.
Am Ende des Beschlusses (Rn. 79) bei der Frage, ob das Waldrecht die baurechtliche Außenbereichsprivilegierung von Windenergieanlagen durchbrechen könne, machen die Karlsruher Richter deutlich, dass das Zwei-Grad-Ziel verfassungsrechtlich maßgeblich sei und der Ausbau der Windenergie dazu besonders beitrage:
„Inhaltlich spricht gegen eine Durchbrechung …, dass der Ausbau der Nutzung der Windkraft einen faktisch unverzichtbaren Beitrag zu der verfassungsrechtlich durch Art. 20 a GG und durch grundrechtliche Schutzpflichten gebotenen Begrenzung des Klimawandels leistet. Um das verfassungsrechtlich maßgebliche Klimaschutzziel zu wahren, die Erderwärmung bei deutlich unter 2,0 °C, möglichst 1,5 °C anzuhalten, müssen erhebliche weitere Anstrengungen der Treibhausgasreduktion unternommen werden, wozu insbesondere der Ausbau der Windkraftnutzung beitragen soll. Zugleich unterstützt dieser Ausbau die Sicherung der Energieversorgung, die derzeit besonders gefährdet ist.“
Wie passt das zu einemAktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz , das neben den Mooren die Wälder in den Mittelpunkt stellt? Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts enthält den auf für die Eigentumsbetroffenheit bei Privatwald relevanten Hinweis, dass die Festlegung weiterer schutzwürdiger Waldkategorien durch die Länder möglich wäre, womit Umwandlungsverbote einhergehen können (Rn. 84).
2. Intertemporale Freiheitssicherung
Letztlich entscheidend dafür, ob das Zwei-Grad-Ziel erreicht wird, ist die Menge an CO2-Emissionen, die bis zum Erreichen der Treibhausgasneutralität in die Atmosphäre noch ausgestoßen wird. In seinem historischen Klimaschutz-Beschluss vom 24. März 2021 (Az. 1 BvR 2656/18 u.a.) hielt das Bundesverfassungsgericht Regelungen des Klimaschutzgesetzes (KSG) 2019 insofern mit Grundrechten für unvereinbar, als hinreichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 bis zum Erreichen der Klimaneutralität fehlten. Das für Deutschland bestehende Emissionsbudget wurde durch die im damaligen KSG 2019 zugelassenen Emissionen bis zum Jahr 2030 weitgehend aufgebraucht. So gibt es zwar kein Grundrecht auf Klimaschutz, aber einen Anspruch auf intertemporale Freiheitssicherung, der sich aus den bürgerlichen Freiheitsgrundrechten, insbesondere aus Art. 2 Abs. 1 GG (jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit) sowie aus der staatlichen Schutzpflicht nach Art. 20a GG (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) herleiten lässt. Dieser Anspruch wird bei zu mäßigen Klimaschutzvorgaben zulasten der jungen Generation verletzt, die ansonsten mit zu massiven Freiheitsbeschränkungen während der Reduktionsphasen ab 2030 bis zum Erreichen der Treibhausgasneutralität leben müsste, sodass„nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens ... von drastischen Einschränkungen bedroht sind“ . Dies erfordert, mit den Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen, dass„nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten“ . Das Fehlen einer Regelung über die Fortschreibung der Klimaschutzziele für Zeiträume ab dem Jahr 2031 war daher verfassungswidrig. Ob die im Nachgang des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts im neuen KSG um 6,5 % reduzierten Emissionsmengen bis 2030 genügen, um der intertemporalen Freiheitssicherung zu entsprechen, ist in Auseinandersetzung mit dem sechsten IPCC-Sachstandsbericht umstritten.
3. Letzte Generation?
Vor diesem Hintergrund wird von der „Letzten Generation“ zum friedlichen, zivilen Widerstand aufgerufen. Speziell die junge Generation hatte das Bundesverfassungsgericht im Blick, als es den Anspruch auf intertemporale Freiheitssicherung anerkannte und eine eingriffsähnliche Vorwirkung für deren Leben im Zeitalter des Klimawandels feststellte. Ihr Protest kann sich darauf berufen. Peter Gauweiler hat es im Interview mit der FAZ (vom 26.11.2022), wie ich persönlich finde, pointiert auf den Punkt gebracht: Der Staat müsse„gegen die Klimaaktivisten nicht den Hulk“ geben.„Obrigkeitliche Selbstbeherrschung kann auch etwas Elegantes haben.“ Wer, wie die „Letzte Generation“ auf ihrer Homepage,„den fossilen Wahnsinn unserer Gegenwart“ brandmarkt, muss aber erklären, wie in sonnen- und windarmen Wintern in einem dekarbonisierten Deutschland gewinnbringend produziert und bezahlbar geheizt werden soll.
SAVE THE DATE
Die Bundesfachtagung Naturschutzrecht 2023 des Bundesverbandes Beruflicher Naturschutz (BBN) findet am 28. und 29. September an der Universität Kassel statt. Sie widmet sich dem Leitthema „Naturschutzrecht in Zeiten der Energie- und Biodiversitätskrise“. Freuen Sie sich auf spannende Referate und Diskussionen, etwa mit Dr. Christoph Sobotta zu den unionsrechtlichen Maßnahmen zugunsten des beschleunigten Ausbaus der erneuerbaren Energien.Autor

Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


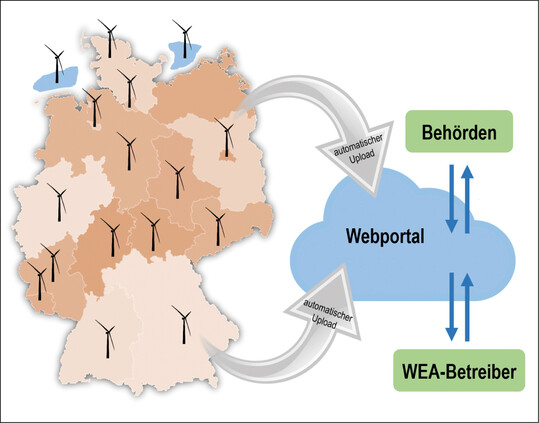





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.