Entspricht die FFH-Richtlinie den Lebensraumansprüchen von Tieren?
Abstracts
Eine vorrangige Ursache für den Rückgang der Insekten in Deutschland ist die Eutrophierung der Landschaft und die dadurch verursachte zu weit fortgeschrittene Sukzession der Vegetation in vielen Habitaten. Viele Insekten sind wärmebedürftig und können daher in ihrem Lebensraum nicht allein durch den Schutz einer Pflanzengesellschaft erhalten werden. Sie brauchen ein frühes Sukzessionsstadium des Habitats mit niedrigwüchsiger Vegetation, Störstellen und einem hohen Offenbodenanteil, der für ein warmes Mikroklima am Erdboden sorgt. In diesem Beitrag wird untersucht, ob die Habitatcharakteristika, nach denen die meisten Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie definiert sind, ausreichen, um den Habitatanforderungen spezialisierter und damit gefährdeter Tierarten zu entsprechen. Es wird festgestellt, dass die Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie deutlich stärker auf die Erhaltung von Pflanzenarten ausgerichtet sind und sich weniger an den Habitatbedürfnissen der Tierarten orientieren. Dies wird an zwei Schmetterlingsarten verdeutlicht: dem Thymian-Ameisenbläuling (Maculinea arion ) und dem Randring-Perlmutterfalter (Boloria eunomia ).
Comparison of the characteristics of Habitats Directive habitat types with the habitat needs of endangered animal species
A primary cause of the decline in insects in Germany is the eutrophication of the landscape and the resulting excessively advanced succession of vegetation in many habitats. Many insects need warmth and therefore cannot be preserved in their habitat by protecting a plant association alone. They need an early succession stage of the habitat with low-growing vegetation, disturbance, and a high proportion of bare soil, which ensures a warm microclimate on the ground. This article examines whether the habitat characteristics, according to which most of the Habitats Directive habitat types are defined, are sufficient to meet the habitat requirements of specialized and thus endangered animal species. It was found that Habitats Directive habitat types are much more oriented towards the conservation of plant species and are less oriented towards the habitat needs of animal species. This is shown detail with two butterfly species: the Large Blue (Maculinea arion ) and the Bog Fritillary (Boloria eunomia ).
- Veröffentlicht am

Von Werner Kunz und Zoé Therese Brosig
Eingereicht am 07. 01. 2021, angenommen am 21. 02. 2021
1 Das Natura-2000-Netz
Natura 2000 ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten. Es setzt sich zusammen aus den Schutzgebieten der Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) und den Schutzgebieten der Fauna-Flora-Habitat- (FFH-)Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG). Die FFH-Richtlinie ist eine EU-Richtlinie und damit im Europarecht ein Rechtsakt der Europäischen Union, der kein förmliches Gesetz ist, sondern erst von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgewandelt werden muss. Die Mitgliedstaaten sind angewiesen, den notwendigen Schutz der Natura-2000-Gebiete zu gewährleisten, indem sie Gebiete als FFH-Gebiete rechtlich sichern.
In Deutschland gibt es über 4.500 FFH-Gebiete und über 740 Vogelschutzgebiete, die sich zum Teil überschneiden. Insgesamt sind über 15 % der deutschen Landfläche durch Natura-2000-Schutzgebiete abgedeckt (BMU 2016). Ziel der FFH-Richtlinie ist die Erhaltung der „natürlichen“ Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Europäische Union 1992). Dazu werden im Anhang I insgesamt 231 „natürliche“ Lebensraumtypen (LRT, davon 92 in Deutschland vorkommend) aufgelistet, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete auszuweisen sind. Alle LRT tragen einen vierstelligen Natura-2000-Code. Die definierenden Charakteristika aller LRT werden im „Interpretationshandbuch der Lebensräume der Europäischen Union“ Vers. EUR 28, 2013 („Interpretation Manual of European Union Habitats“) detailliert beschrieben (European Commission 2013). Jeder LRT ist durch folgende Kriterien definiert: eine generelle Beschreibung der Vegetation und der abiotischen Eigenschaften des Habitats (Punkt 1), durch Untergruppierungen der Habitate wie Zonierungen, Mosaike oder Sukzessionsstadien (Punkt 4) sowie durch eine Auflistung der Pflanzen- und Tierarten, die den LRT charakterisieren (Punkt 2).
Angesichts der großen Zahl der FFH-Gebiete bedarf es einer Erklärung, warum der Rückgang vieler Arten gegenwärtig trotzdem weiter anhält (Filz et al. 2013, Rada et al. 2019, Seibold et al. 2019). Es stellt sich die Frage, ob die Ausweisung von Lebensräumen zu Natura-2000-Gebieten den Rückgang vieler gefährdeter Arten tatsächlich erfolgreich mildern kann. So stellen Rada et al. fest (2019): „… the current negative trend in butterfly species richness across Germany is not mitigated by the European Natura-2000 network“.
Überprüft man die durch die Ämter für Natur- und Umweltschutz der einzelnen Bundesländer vorgelegte Zuordnung bestimmter spezialisierter und daher bedrohten Tierarten zu bestimmten FFH-Lebensraumtypen, so stellt man an vielen Beispielen fest, dass zwar die entsprechenden Lebensräume im heutigen Deutschland noch weit verbreitet vorhanden sind (BfN 2019), die Tierarten jedoch, die diesen LRT zugeordnet wurden, in vielen dieser Lebensräume fehlen. Es handelt sich dabei oft eher um Tierarten, die man sich dort erwünschen würde. Das gilt besonders für Tagfalter (Reinhardt et al. 2020). Viele der vorhandenen Lebensräume scheinen zwar der FFH-Richtlinie zu genügen, nicht jedoch den prioritären Habitatansprüchen bestimmter Tierarten. Dies wird in diesem Beitrag am Beispiel von zwei ausgewählten Tagfalterarten erläutert.
2 Die definierenden Charakteristika der Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie
2.1 Abiotische Faktoren
Punkt 1 in den Definitionen vieler terrestrischer Natura-2000-Lebensräume (European Commission 2013) ist darauf fokussiert, ob es sich um Silikat- oder Kalkböden handelt. Daraus kann dann auf den Vegetationstyp geschlossen werden, jedoch nicht so sehr auf die dort lebende Fauna. Für viele Tierarten sind oft andere, mehr physische Strukturelemente des Lebensraumes ausschlaggebend, beispielsweise der Windschutz durch Gehölze oder Bahn- und Straßentrassen am Habitatrand, Sonnenexponiertheit, eine insgesamt niedrigwüchsige und lückige Vegetation, eine Limitierung der Strauchhöhe und des Strauchabstands oder das Vorhandensein von Sandflächen und Sitzwarten.
2.2 Pflanzengesellschaften
In Punkt 2 der Natura-2000-LRT-Definitionen des „Interpretation Manuals“ werden die Tier- und Pflanzenarten aufgelistet, die die jeweiligen Habitate charakterisieren (European Commission 2013). Dabei fällt auf, dass die terrestrischen LRT überwiegend durch die in ihnen vorkommenden Pflanzengesellschaften definiert sind. Die Liste der typischen Pflanzenarten ist vergleichsweise lang, während den meisten LRT überhaupt keine Tierarten zugeordnet sind. Das Vorkommen charakteristischer Pflanzengesellschaften in einem Habitat bestimmt die endgültige Einteilung in die verschiedenen FFH-Lebensraumtypen. Das bedeutet, dass der „günstige Erhaltungszustand“ (den die FFH-Richtlinie vorschreibt) überwiegend durch das Vorhandensein spezieller Pflanzengesellschaften definiert wird. Auf die Bedürfnisse vieler Tierarten sind die Natura-2000-LRT weniger zugeschnitten.
Beispielsweise enthält die LRT-Gruppe 9 (Wälder) 72 verschiedene Lebensraumtypen. Darunter sind aber nur für drei überhaupt Tierarten angegeben; allen übrigen LRT der Gruppe 9 werden ausschließlich Pflanzenarten zugeordnet. Bei der Beschreibung der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt (LAU 2002) heißt es auf Seite 11: „Die vegetationskundliche und strukturelle Zuordnung der Lebensraumtypen erfolgt nach der vorrangig von Braun-Blanquet entwickelten Vegetationsklassifizierung“ und weiter: „In ihr werden die Pflanzengesellschaften zusammengefasst, die sich durch gleiche charakteristische Arten(gruppen)kombinationen auszeichnen“. Damit kommt zum Ausdruck, dass die Lebensraumtypen in erster Linie pflanzensoziologisch verstanden werden.
Manchmal sind den LRT nicht Tierarten, sondern von vornherein höhere Taxa zugeordnet, wie etwa „Odonata“ dem LRT 3160: dystrophe Seen und Teiche. In nicht wenigen Fällen sind den LRT auch Tierarten zugeordnet, die zwar in diesen Habitaten nachgewiesen wurden, aber auch in vielen anderen Habitaten vorkommen und daher nicht auf das beschriebene Habitat angewiesen sind, wie zum Beispiel Schwalbenschwanz oder Segelfalter als einzige Lepidoptera für den LRT 6210 (Kalk-Trockenrasen) (European Commission 2013). Oder es werden Habitatgeneralisten genannt, die fast überall vorkommen, sodass ihre Bestände auch dann nicht gefährdet wären, wenn der entsprechende Lebensraumtyp unzureichend geschützt würde, so etwa Stockente und Höckerschwan, die dem LRT 1650 (Buchten des borealen Baltikums) zugeordnet sind.
Vor dem Problem, den Natura-2000-LRT feste Tierarten zuzuordnen, stehen auch die Ämter für Natur- und Umweltschutz der einzelnen Bundesländer. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) beschreibt jeden LRT in einem als PDF abrufbaren Steckbrief, in dem die Merkmale des LRT, seine landesweite Verbreitung und die den LRT kennzeichnenden Pflanzengesellschaften und Pflanzenarten aufgelistet sind. In diesen Steckbriefen werden jedoch von vornherein keine Tierarten genannt (LUBW o. J.).
Andere Landesämter fügen zur Darstellung der in ihrem Land vorkommenden FFH-Lebensraumtypen zwar auch Tierartenlisten hinzu, diese Arten sind aber oft nicht spezifisch auf die jeweiligen LRT angewiesen, weil sie auch in anderen Lebensraumtypen anzutreffen sind (LANUV 2004, Landesamt für Umwelt – Abteilung Naturschutz und Brandenburger Naturlandschaften 2014, NLWKN 2020). Mehrfach sind dort gerade bedrohte Arten bestimmten LRT zugeordnet; diese sind dann aber in den betreffenden Bundesländern von den genannten Tierarten kaum noch besiedelt. So ist der LRT 6210 (Kalk-Trockenrasen) mit den Pflanzengesellschaften, die diesen LRT definieren, in Nordrhein-Westfalen noch an 40 Stellen vorhanden, aber die dort genannten Charakterarten Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia ), Thymian-Ameisenbläuling (Maculinea arion ) und Kreuzenzian-Ameisenbläuling (Maculinea rebeli ) (LANUV 2004) besiedeln seit dem Jahr 2000 in NRW nur noch Bereiche in ein bis drei Messtischblättern (Reinhardt et al. 2020). Das legt nahe, dass die LRT in diesen Ländern die Habitatbedürfnisse für diese Tierarten gar nicht erfüllen. Sonst wäre nicht erklärbar, dass die Habitate immer noch existieren, obwohl die dort „erwünschten“ Tierarten längst verschwunden sind.
Ein pflanzensoziologisch definierter Lebensraum ist nicht automatisch auch ein ideales Habitat für viele Tierarten. Denn für Tierarten ist oft nicht die Pflanzengesellschaft von Bedeutung, sondern vielmehr ihre Struktur (Fartmann 2017, Fartmann et al. 2019, Kunz 2021). Lückige Vegetation, offene Bodenstellen und das Vorhandensein von Störstellen wie Maulwurfshügel oder Stein-, Metall- oder Holzplatten können wichtiger sein als die Pflanzengesellschaft. Fartmann und Hermann beschreiben das für die Larvalhabitate von Tagfaltern folgendermaßen: „Die [Habitate müssen] folgende Eigenschaften aufweisen: ein geeignetes Mikroklima, … eine angemessene Bewirtschaftung bzw. ein adäquates Störungsregime, geringen Konkurrenz-, Prädations- bzw. Parasitoidendruck … Die Raumstruktur und damit verknüpft das Mikroklima spielen eine herausragende Rolle für die Auswahl von Eiablageplätzen“ (Fartmann & Hermann 2006).
Den Raupen mancher Schmetterlinge genügt nicht allein das Vorhandensein der Fraßpflanze, sondern die Pflanzen müssen die erforderliche Dichte und Wuchshöhe haben, damit sich die Raupen gegen Sonne und Wind exponieren oder verkriechen und je nach Witterung zu jeder Zeit ein günstiges Mikroklima aufsuchen können (Schorr 2012). Trockenrasen sind in den letzten Jahrzehnten für viele gefährdete Insektenarten unbewohnbar geworden, nicht weil sich die Pflanzengesellschaft dort geändert hat, sondern weil der Deckungsgrad des Gebüschaufwuchses zu dicht geworden ist (Landesamt für Umwelt – Abteilung Naturschutz und Brandenburger Naturlandschaften 2014).
Der Kreuzdorn-Zipfelfalter (Satyrium spini ) ist zum Beispiel auf Kreuzdornarten (Rhamnus spp.) als Raupenfraßpflanze angewiesen. In Deutschland gibt es viele Trockenhänge mit Kreuzdorn, aber nur wenige sind für den Falter geeignet, denn die Raupen benötigen das richtige Sukzessionsstadium der Vegetationsbedeckung. Der Falter legt seine Eier nur auf kleinwüchsige bis krüppelige (am besten kniehohe) Kreuzdornsträucher ab, die eine Höhe von 1,30 m nicht überschreiten dürfen und zudem noch einen deutlichen Abstand voneinander haben müssen (Helbing et al. 2015, Löffler et al. 2013). Außerdem müssen die Sträucher auf Fels, Geröll oder weitgehend unbewachsener Erde stehen. Alle diese Faktoren charakterisieren das Habitat des Kreuzdorn-Zipfelfalters viel enger, als es durch die Definition einer Pflanzengesellschaft vorgegeben wäre. Entsprechend gibt es keinen Natura-2000-LRT, dessen Verbreitung in Deutschland (BfN 2019) sich mit der Verbreitungskarte vonSatyrium spini deckt (Reinhardt et al. 2020).
2.3 Naturnähe
Die FFH-Richtlinie (Europäische Union 1992) betont ausdrücklich, dass sie das Ziel verfolgt, durch die Erhaltung der „natürlichen“ Lebensräume die Bewahrung der Artenvielfalt der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten zu bewirken (Artikel 2 der „Begriffsbestimmungen“). „Natürliche Lebensräume“ sind nach Artikel 1 der „Begriffsbestimmungen“ der FFH-Richtlinie „durch geographische, abiotische und biotische Merkmale gekennzeichnete völlig natürliche oder naturnahe terrestrische oder aquatische Gebiete“.
„Natürliche Gebiete“ bedeutet daher, dass die EU-FFH-Richtlinie nicht die Erhaltung künstlich geschaffener Habitate beabsichtigt. Entsprechend werden unter den Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie auch keine Habitate wie etwa Ackerflächen, bewirtschaftete Weinberge, Obstwiesen, Militärgelände, Kiesgruben, Steinbrüche, Tagebaufolgelandschaften, Industrie-Ruderalflächen, stillgelegte Güterbahnhöfe, Bahntrassen, Steinmauern, Siedlungen, Ruinen oder Kulturbrachen aufgelistet. Dort aber leben in Deutschland viele der Rote-Liste-Arten (Kunz 2017a).
Die FFH-Richtlinie beschränkt sich auf die biologische Vielfalt in natürlichen und naturnahen Lebensräumen. Für eine erhebliche Zahl von Arten sind die Lebensräume im Anhang I der FFH-Richtlinie nicht zugeschnitten. Dazu gehören gebäudebrütende Vogelarten wie Haussperlinge oder Mauersegler, aber auch der gegenwärtig in den westlichen Bundesländern aussterbende Steinschmätzer, der im deutschen Binnenland fast ausschließlich auf Kunstbiotopen brütet (wie Lesesteinhaufen, Rohstoffabbauflächen, Gleisbereichen, Sägewerken oder Trümmerlandschaften – Grüneberg & Sudmann 2013, Kämpfer & Fartmann 2019). Aber auch manche gefährdete Pflanzenarten sind auf Siedlungsräume angewiesen, etwas die Arten der mitteleuropäischen Dorfvegetation (Wittig 2005).
Es gibt daher bereits Ansätze, zusätzlich zu den LRT der FFH-Richtlinie neue Lebensräume einzuführen, die im Anhang I der FFH-Richtlinie nicht enthalten sind. Das Online-Portal „Deutschlands Natur“ beschreibt in Ergänzung zu den neun Gruppen der „natürlichen Lebensraumtypen“ der FFH-Richtlinie eine zehnte Gruppe: „Lebensräume in Siedlungen und Siedlungsnähe“ mit neun Lebensraumtypen (Manderbach 2020). Schorr spricht von „faktischen Natura-2000-Gebieten“, womit er Lebensräume mit hoher Artenvielfalt meint, die keinem der Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie entsprechen, weil es sich nicht um natürliche Gebiete handelt (sondern um ehemalige Militär-, Industrie- oder Verkehrsgelände) (Schorr 2012). Das wiederum beinhaltet die Gefahr, dass manche Habitate, die Rote-Liste-Arten beherbergen, von den Behörden nicht als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen werden. Sie werden nicht als Natur empfunden, da es sich um Nebenprodukte einer Landschaftsgestaltung mit verkehrspolitischer, industrieller oder militärischer Zielsetzung handelt.
Das Problem mit der Erhaltung „völlig natürlicher oder naturnaher Gebiete“ gemäß FFH-Richtlinie (Seite 4) ist, dass viele solche Habitate zwar als „natürliche“ Habitate im Norden oder Osten Europas oder in den Höhenlagen der Gebirge existieren, aber in Mitteleuropa in tieferen Lagen sind genau diese Habitate keine „natürlichen“ Habitate. Dort wurden sie seit Jahrhunderten allein durch den Menschen und seine Haustiere geschaffen, eben weil der Mensch die natürliche Entwicklung verhindert hat, indem er in die Natur eingegriffen hat (Kunz 2017b, 2019).
Dafür zwei Beispiele:
(1) Der LRT 4030 (trockene europäische Heiden) ist in Nordeuropa ein „natürlicher Lebensraum“, in Deutschland dagegen ist dieser Lebensraum nicht „natürlich“, sondern erst durch Schafbeweidung, Plaggenstich oder Brand entstanden. In Deutschland kann dieser LRT nicht durch Schutz der Natur, sondern nur durch Fortsetzung der traditionellen Nutzung erhalten bleiben (Borchard et al. 2013).
(2) Den LRT 6410 (Pfeifengraswiesen) gäbe es in Deutschland gar nicht, wenn der Mensch ihn nicht durch Streumahd geschaffen hätte, und dieser LRT würde schnell durch Verbuschung verschwinden, wenn die Mahd aufgegeben würde (LANUV 2004). Mitteleuropa besitzt viele Habitate, die nicht natürlich entstanden sind und daher auch nicht durch Bewahrung der Natur erhalten werden können.
3 Einordnung des Lebensraums des Thymian-Ameisenbläulings (Maculinea arion) in Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie
Der Thymian-Ameisenbläuling (Maculinea arion ; Abb. 1) wurde in die Rote Liste Deutschlands in die Kategorie 2 („stark gefährdet“) aufgenommen (Reinhardt & Bolz 2011). Zudem istM. arion im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt (Europäische Union 1992). Dadurch sind sowohl der Falter selbst als auch seine natürlichen Lebensräume besonders geschützt. In den letzten Jahrzehnten wird europaweit ein starker Rückgang des Tagfalters beobachtet (Dolek & Bräu 2013, Grupp 2009). Um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken, bedarf es der Erhaltung der fürM. arion geeigneten Habitate (Munguira 1999). Die im „Interpretation Manual“ des Anhangs I der FFH-Richtlinie aufgelisteten LRT (European Commission 2013) entsprechen jedoch nur sehr unzureichend den lebensnotwendigen Bedürfnissen vonM. arion (siehe dazu auch LAU 2013).
Die Landesämter einiger Bundesländer für Natur und Umwelt haben Habitatbeschreibungen fürM. arion erarbeitet (NLWKN 2020), aber eine eindeutige Zuordnung der ArtM. arion zu einem bestimmten LRT ist in den Berichten der Landesämter kaum zu finden. Nur das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) ordnetM. arion eindeutig einem LRT zu, nämlich zu LRT 6210 (Kalk-Trockenrasen) (LANUV 2004), aber der Falter kommt heute in Nordrhein-Westfalen höchstens noch an vier Stellen vor, während der LRT 6210 zehnmal so häufig in NRW vorhanden ist, nämlich an 40 Stellen. Im „Naturführer für Deutschland“, in dem die LRT der FFH-Richtlinie sehr detailliert beschrieben und bebildert sind, ist das Vorkommen vonM. arion in fünf verschiedenen Lebensraumtypen genannt, jedoch sind die Artenlisten dort sehr umfangreich und enthalten auch viele Gelegenheitsbesucher, die dann auch in anderen LRT zu finden sind (Manderbach 17.11.2020).
Die meisten Quellen nennen „Kalkmagerrasen mit beginnender Verbuschung“ als Habitat vonM. arion . Jedoch ist in Europa ein Magerrasen im Norden etwas anderes als im Süden (Grupp 2009). Das gilt auch für Deutschland (Landesamt für Umwelt – Abteilung Naturschutz und Brandenburger Naturlandschaften 2014). Hier ist der Falter im vorigen Jahrhundert aus fast allen Habitaten Mecklenburgs und Brandenburgs verschwunden, während in den höher gelegenen Regionen der Mittelgebirge noch deutlich mehr Habitate besiedelt sind (Reinhardt et al. 2020). Allein das zeigt schon, dass eine Zuordnung desarion -Lebensraumes zu einem der Natura-2000-LRT (European Commission 2013) nicht möglich ist, denn der am ehesten infrage kommende LRT 6210 (Kalk-Trockenrasen) ist in Mecklenburg und Brandenburg noch ausreichend vorhanden (BfN 2019), ist dort aber nicht das gleiche Habitat wie in den mittleren und südlichen Bundesländern (Landesamt für Umwelt – Abteilung Naturschutz und Brandenburger Naturlandschaften 2014).
Ein weiterer Natura-2000-LRT, demM. arion zugeordnet werden könnte, wäre LRT 5130 (Wacholderbestände) (Grupp 2009). Hier besteht jedoch das Problem, dass dieser LRT eine Sammelbezeichnung für zwei verschiedene Habitate ist, nämlich für (1) brachgefallene Kalktrockenrasen (mit Wacholder), die an vielen Stellen in den Mittelgebirgen vom Sauerland über die Eifel bis zur Fränkischen und Schwäbischen Alb zu finden sind, und (2) Zwergstrauchheiden (Calluna -Heiden mit Wacholder), die im Emsland und in der Lüneburger Heide noch bestehen (NLWKN 2020). DieseCalluna -Heiden (LRT 5130 Typ 2) sind überhaupt nicht vonM. arion besiedelt.
Die im „Interpretation Manual“ der Habitate der Europäischen Union EUR28 zur Charakterisierung der Lebensraumtypen 6210 (Kalk-Trockenrasen) und 5130 (Wacholderbestände) aufgezählten Pflanzenarten (European Commission 2013) entsprechen nicht den vonM. arion benötigten Pflanzen. Das Wichtigste ist das Vorhandensein der Raupenfraßpflanzen Thymian und Dost (Thymus pulegioides, T. praecox undOriganum vulgare ) in ausreichender Dichte (Ulrich 2003). In höheren Lagen wird Thymian aufgrund der wärmeren Wuchsorte bevorzugt, in niederen Lagen legt der Falter seine Eier überwiegend auf Dost ab. Beide Pflanzenarten zählen nicht zu den Charakterarten der LRT 6210 und 5130 (European Commission 2013). Die Imagines vonM. arion suchen nebenT. pulegioides undO. vulgare ein breites Spektrum von Nektarpflanzen aus; daher sind die Imagines vonM. arion nicht auf die Charakterarten der LRT 6210 und 5130 angewiesen (Grupp 2009, https://www.ufz.de/tagfalter-monitoring/index.php?de=42067&nopagecache; letzter Zugriff Dezember 2020).
FürM. arion sind die Struktur der Vegetation und bestimmte abiotische Faktoren als Habitatkriterien viel wichtiger als die Pflanzengesellschaften, nach denen die Natura-2000-LRT definiert sind. Die Wuchshöhe und die Dichte der Büsche auf dem Trockenrasen sind entscheidend. Kommen sich die Büsche zu nahe, dann verschwindet der Falter (Öckinger & Smith 2006, Ulrich 2003). Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) beschreiben die Habitatbedürfnisse fürM. arion in sehr ähnlicher Weise und betonen, dass die Vegetation lückig sein und offene Bodenstellen (zum Beispiel Störstellen wie Maulwurfshügel) enthalten muss (LAU 2004) (Abb. 2; https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie/schmetterlinge/quendel-ameisenblaeuling-maculinea-arion/lokale-population-gefaehrdung.html; letzter Zugriff November 2020).
Neben dem Vorhandensein der Raupenfraßpflanzen muss das Habitat noch ein weiteres wesentliches Merkmal aufweisen, damit es vonM. arion bewohnt werden kann: Als obligatorisch myrmekophile Bläulingsart istM. arion unbedingt auf die WirtsameiseMyrmica sabuleti angewiesen (Thomas & Settele 2004). Ähnlich dem Falter handelt es sich auch bei dieser Ameise um eine xerothermophile Art, die beinahe ausschließlich an trockenen und sonnigen Standorten mit niedriger und lückiger Vegetation vorkommt und höhere Temperaturen benötigt als am gleichen Ort lebende andere Ameisenarten (Grupp 2009, Thomas et al. 1989). Der BläulingM. arion kann nur in einem Habitat leben, in dem auch die Wirtsameisenart syntop vorkommt. Das sind außerordentlich spezifische Anforderungen an das Habitat, die nur unzureichend durch die Pflanzengesellschaften vorgegeben sind, nach denen die Natura-2000-LRT definiert sind.
Die in Deutschland vonM. arion besiedelten Habitate sind alle anthropo-zoogenen Ursprungs. Die ehemaligen und noch rezentenM.-arion- Habitate in Deutschland sind durch Beweidung mit Schafen und Ziegen entstanden und auf diese Beweidung angewiesen (Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz 2011). Im Gegensatz zu einigen mediterranen Vorkommen bewohntM. arion in Deutschland keine natürlichen Lebensräume. Das gegenwärtige Verschwinden der Art ist die Folge der zurückgehenden Nutzung dieser Habitate, die durch natürliche Sukzession verändert wurden, und resultiert nicht aus zu geringer Naturnähe der Habitate.
4 Einordnung des Lebensraums des Randring-Perlmutterfalter (Boloria eunomia) in Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie
Der Randring-Perlmutterfalter (Boloria eunomia ; Abb. 3) wird in der Roten Liste Deutschlands in der Kategorie 2 („stark gefährdet“) aufgeführt (Reinhardt & Bolz 2011), ist jedoch europaweit nicht gefährdet und wird daher in der FFH-Richtlinie in den Anhängen II und IV nicht als Zielart genannt (Europäische Union 1992). Während die Art holarktisch im Norden der Halbkugel und auch in Deutschland im Alpenvorland, dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb noch weit verbreitet ist, beschränken sich die noch erhaltenen Vorkommen (seit 2001) im übrigen Teil Deutschlands auf einige Mittelgebirge (hauptsächlich Eifel, Hunsrück und Rhön) und auf ein Restvorkommen in der Schorfheide bei Angermünde (https://www.schmetterlinge-d.de/Lepi/EvidenceMap.aspx?Id=441696; letzter Zugriff 25.08.2021). Wegen der Bindung dieser Schmetterlingsart an kühles Klima und Feuchtigkeit des bewohnten Habitats muss befürchtet werden, dass der Falter (zumindest in den deutschen Mittelgebirgen) ein Verlierer der Klimaerwärmung werden könnte (Schorr 2012).
Als Lebensraum benötigtB. eunomia im mittleren Deutschland „Grünlandbrachen auf nassen, Grundwasser führenden Standorten“ (Reinhardt et al. 2020). Damit ist das Habitat vonB. eunomia nur unzureichend beschrieben; denn solche Lebensräume gibt es in Deutschland an vielen Stellen,B. eunomia aber nur an wenigen. Sehr präzise beschreibt M. Schorr das vonB. eunomia im südwestlichen Hunsrück besiedelte Habitat (Schorr 2012). Es handelt sich dabei um ein durchaus „unnatürliches“ Gebiet: kleine Feuchtwiesen im Bereich eines ehemaligen Truppenübungsplatzes, die von Autobahn und Bundesstraßen eingerahmt sind. Dort leben nach Schorr etwa 400 Individuen des in Deutschland stark gefährdeten Randring-Perlmutterfalters. Nach Thomas Schmitt (schriftl. Mitteilung) kamen dort in einigen Jahren sogar mehrere Tausend vor. Auf den Wiesen wächst die für das Überleben vonB. eunomia essenzielle Raupenfraßpflanze, der SchlangenknöterichPolygonum bistorta . Dessen Vorhandensein allein genügt allerdings nicht. Der Falter legt seine Eier nur in lockeren Beständen vonP. bistorta ab. Feuchtwiesen mit zu dichten Beständen vonP. bistorta werden vonB. eunomia nicht besiedelt (Schorr 2012).
DamitB. eunomia auf Schlangenknöterich-Feuchtwiesen leben kann, sind noch zusätzliche Bedingungen erforderlich. Die Raupen vonB. eunomia sind sehr temperaturempfindlich. Sie vertragen weder Wind noch starke Hitze und Sonneneinstrahlung. Damit die Raupen ihre Temperatur regulieren können, müssen sie ständig in einen günstigen Mikroklimabereich ausweichen können. Dazu suchen sie Pfeifengras- oder Borstgrashorste auf, in denen sie sich verkriechen können (Choutt et al. 2011). Außerdem müssen in der Nähe der Raupenfraßflächen Gebüsche vorhanden sein (zum Beispiel Grauweiden), um den heranwachsenden Raupen Schutz gegen Wind zu gewähren (Schorr 2012).B. eunomia benötigt kühles Klima. Für die Habitate im südwestlichen Hunsrück haben sich die umgebenden Straßendämme als sehr günstig erwiesen, um das Abfließen der Kaltluft zu verhindern, sodass die Standorte auch bei längeren Wärmeperioden kühl bleiben (Schorr 2012).
Den Habitatbedürfnissen vonB. eunomia einen Lebensraumtyp der FFH-Richtlinie zuzuordnen (Europäische Union 1992) gelingt indes nicht. Zwar kommen die in den deutschen Mittelgebirgen vonB. eunomia bewohnten Habitate dem LRT 6520 (Berg-Mähwiesen) sehr nahe, jedoch ist die Verbreitungskarte vonB. eunomia (Reinhardt et al. 2020) nur teilweise mit der Verbreitungskarte des LRT 6520 (BfN 2019) zur Deckung zu bringen. So sind etwa im Westerwald und Rothaargebirge, im Frankenwald und im Erzgebirge zahlreiche Berg-Mähwiesen (6520) vorhanden; diese sind jedoch nicht vonB. eunomia besiedelt. Die FFH-Lebensraumtypen entsprechen dort also nicht dem, wasB. eunomia benötigt.
Die Raupen brauchen unbedingt den Schlangenknöterich, und die Imagines benötigen überhaupt keine spezifischen Pflanzengesellschaften, sondern suchen ein ziemlich unspezifisches breites Blütenangebot auf (Ebert & Rennwald 1991). Zwar gehörtP. bistorta zu den Charakterpflanzen des LRT 6520 (European Commission 2013), jedoch entspricht dieser Natura-2000-LRT nicht in ausreichendem Maße den spezifischen Habitatanforderungen vonB. eunomia , weil die meisten der hier genannten Pflanzenarten für dessen Vorkommen unbedeutend sind, andererseits aber essenzielle Habitatbedürfnisse vonB. eunomia in der Habitatbeschreibung für LRT 6520 fehlen.
Zum gleichen Resultat führt der Versuch, den Habitatbedürfnissen vonB. eunomia weitere Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie zuzuordnen. Im Süden Deutschlands besiedeltB. eunomia Kalkflachmoore (Ebert & Rennwald 1991, Reinhardt et al. 2020). Dieses Habitat könnte man im LRT 7230 (kalkreiche Niedermoore) wiederfinden. Aber die den LRT 7230 charakterisierenden Pflanzengesellschaften enthalten nicht einmalP. bistorta . LRT 7230 im Sinne der FFH-Richtlinie ist also fürB. eunomia kein passendes Habitat. Außerdem ist LRT 7230 im nördlichen Schleswig-Holstein und in Mecklenburg an vielen Stellen vorhanden, an denen jedochB. eunomia aktuell und größtenteils auch vor 1900 nicht vorkommt oder vorgekommen ist (Reinhardt et al. 2020).
Mehrfach werden auch Pfeifengraswiesen (Ebert & Rennwald 1991, Schorr 2012) sowie Borstgrasrasen-Nasswiesen als Habitat vonB. eunomia genannt (Schorr 2012). Das entspricht den EU-Lebensraumtypen mit den Natura-2000-Codes 6410 und 6230. Aber auch hier passen die Natura-2000-LRT-Beschreibungen nicht zu den Habitaten, dieB. eunomia zum Überleben benötigt; denn beide LRT sind im Norddeutschen Flachland und in Niederbayern weit verbreitet (BfN 2019). Dort aber kommtB. eunomia nicht vor.
Weiterhin gehören Hochmoore zum Lebensraum vonB. eunomia , dort jedoch nur die feuchten Streuwiesen der Randbereiche (Ebert & Rennwald 1991), sodass die LRT 7110 und 7120 (lebende und degradierte Hochmoore) ebenso wie LRT 7140 (Schwingrasenmoore) und 7150 (Torfmoor-Schlenken) als Lebensräume fürB. eunomia nicht infrage kommen.
Die nach der FFH-Richtlinie vorgeschriebene Erhaltung aller dieser LRT ist daher unzureichend geeignet, den bedrohten Falter vor weiterem Rückgang zu bewahren. Vor allem in Vorpommern und im nordwestlichen Brandenburg ist die Art in den letzten Jahrzehnten fast ausgestorben, obwohl keiner der oben genannten LRT dort in den letzten Jahrzehnten verschwunden ist. UmB. eunomia dauerhaft in Eifel, Hunsrück oder Rhön zu erhalten, ist ein geplantes Habitat-Management erforderlich, das ganz auf die Bedürfnisse der Zielart zugeschnitten ist (Choutt et al. 2011).
Literatur
Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.
Fazit für die Praxis
- Im „Interpretation Manual“ zur FFH-Richtlinie werden Lebensraumtypen (LRT) hauptsächlich durch Pflanzenarten und Pflanzengesellschaften charakterisiert. Tierarten fehlen meist oder sind relativ unspezifisch zugeordnet, das heißt, sie kommen auch in vielen anderen LRT vor.
- Viele Tierarten sind aber eher auf strukturelle Faktoren des Lebensraums angewiesen, wie das Vorhandensein von Sandflächen und Sitzwarten, besonnten Flächen, eine insgesamt niedrigwüchsige und lückige Vegetation oder Windschutz durch Gehölze.
- Unser Vergleich von Habitatansprüchen zweier gefährdeter Tagfalterarten mit den LRT-Beschreibungen der FFH-Richtlinie legt nahe, stärker zu prüfen, ob die Charakterisierung von LRT in der FFH-Richtlinie zu sehr auf Pflanzengesellschaften abhebt und die Bedürfnisse spezialisierter und damit gefährdeter Tierarten nicht genügend berücksichtigt.
- Ferner ist stärker zu prüfen, ob die FFH-Richtlinie zu sehr auf die Erhaltung der natürlichen Lebensräume fokussiert ist, während in Mitteleuropa gerade viele gefährdete Tierarten an Habitate angepasst sind, die vom Menschen umgestaltet wurden.
Kontakt
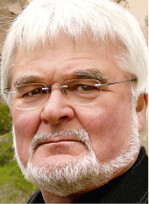
Prof. Dr. Werner Kunz studierte in Münster Biologie, Chemie und Physik und promovierte dort über Chromosomen bei Insekten. Nach zwei Jahren als Gastwissenschaftler an der Yale University in New Haven/USA arbeitete er als Professor für Allgemeine Biologie am Institut für Genetik an der Universität Düsseldorf. Er befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Arten- und Naturschutzes und hat darüber Fachartikel und Bücher veröffentlicht. Als Tierfotograf hat er alle Erdteile bereist.
> Kunz@hhu.de
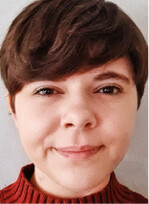
Zoé Therese Brosig studiert Biologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und erlangte im Sommer 2020 den Grad „Bachelor of Science“ mit dem Thema „Wie weit sind die Flora-Fauna-Lebensraumtypen (LRT) der FFH-Richtlinie der EU-Kommission auf die Habitatbedürfnisse einiger ausgewählter bedrohter Schmetterlings- und Vogelarten abgestimmt?“ Diese Arbeit kann online eingesehen werden unter: https://www.kunz.hhu.de/lehre.html.
> Zoe.Brosig@hhu.de
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen










Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.