Artenschutzprüfung mit dem Rechenschieber?
Abstracts
Der für die Energiewende erforderliche Um- und Ausbau der Energieleitungen in Deutschland erfolgt weit überwiegend durch Freileitungen, die vor allem für Vögel eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bewertung dieser Risiken in Hinsicht auf die Vorgaben des Arten- und Gebietsschutzes ist für die Vorhaben regelmäßig von besonderer Zulassungsrelevanz. Für die Ermittlung der naturschutzrechtlichen Erheblichkeits- beziehungsweise Signifikanzschwellen schlägt die BfN-Arbeitshilfe (Bernotat et al. 2018) eine Methodik vor, die im Wesentlichen auf einer festen Verknüpfungsvorgabe verschiedener zuvor festgelegter Bewertungskriterien beruht. Im Ergebnis soll damit eine Festlegung auf einheitliche Maßstäbe und eine verbesserte Transparenz der Bewertung erreicht werden. Auch wenn dieses Ziel im Grundsatz sehr zu begrüßen ist, werden in diesem Artikel die naturschutzfachlichen und -rechtlichen Grenzen einer auf einer starren Verknüpfungsmatrix basierenden Methode für die Bewertung komplexer ökologischer und ethologischer Sachverhalte aufgezeigt. Die Verfasser sind der Überzeugung, dass für eine fachgerechte und rechtssichere Bewertung der arten- und gebietsschutzrechtlichen Zulassungsrisiken eine stärkere verbal-argumentative Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls unverzichtbar ist. Species protection assessment with a slide rule? A critique of the BfN guidelines “Species and site protection assessment for overhead power line projects”
The transition from fossil to renewable energy sources makes the extensive development and modification of the transmission grid necessary. In Germany, this is mostly based on overhead power lines that present a conservation threat, especially for birds. The evaluation of these risks, based on the legal requirements for the protection of species and habitats, is of high relevance for construction approval. Recently, Bernotat et al. (2018) proposed a method to determine the species-specific threshold of a significant impact elicited by overhead power line projects. This method is essentially based on a fixed connection procedure of several criteria that were predetermined by the authors, not least to achieve standardization and transparency in the evaluation process. Despite the merits of their endeavour, we show that this matrix-based approach is highly inflexible and does not reflect the complex ecological and ethological processes involved in power line collision. Thus, we regard it as not suitable for evaluating the significance of the impact of overhead power lines. Instead, we are utterly convinced that only an individual case study based on expert opinion and verbal argumentation can lead to both an accurate and legally compliant evaluation of bird collision risk with power lines.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
1.1 Einführung in das Thema
Beim Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze als eines unverzichtbaren Bausteins für das Gelingen der Energiewende in Deutschland kommt der Bewertung umweltrelevanter Auswirkungen von Stromleitungen bei der Planung große Bedeutung zu. Da der Netzausbau in den Höchstspannungsnetzen aufgrund technischer und/oder wirtschaftlicher Gesichtspunkte größtenteils durch Freileitungen erfolgen soll, ist im Hinblick auf die Umweltauswirkungen dieser linearen Infrastrukturen über Tausende von Kilometern vor allem die Bewertung und Minderung des Kollisionsrisikos von Vögeln von größter Relevanz.
Nachdem bislang eine allgemein anerkannte und einsetzbare Methode fehlte, mit deren Hilfe die Bedeutung der zusätzlichen Mortalität von Tierarten bei Eingriffsvorhaben artspezifisch einschätzbar ist, wird das von Bernotat & Dierschke (2016) unter Beteiligung von Fachexperten in einzelnen Arbeitsschritten entwickelte Klassifizierungssystem für die Einstufung zusätzlicher, vorhabentypspezifischer Mortalitätsgefährdung auf Artniveau grundsätzlich begrüßt. Die Methode von Bernotat & Dierschke (2016) in Verbindung mit der BfN-Arbeitshilfe von Bernotat et al. (2018) soll eine zielgerichtete Fokussierung auf freileitungssensible Arten ermöglichen. Sie bietet im Hinblick auf das Erfordernis der Prüfung des Wirkfaktors „anlagebedingte Mortalität/Kollision“ folgende Möglichkeiten:
- qualitative Gefährdungsabschätzung,
- grundsätzlich nachvollziehbare Problemstrukturierung,
- GIS-basierte Anwendung,
- Erfordernis weniger Eingangsparameter,
- Durchführung gegebenenfalls ohne zusätzliche Kartierungen,
- Berücksichtigung einer naturschutzfachlichen Wertanalyse, populationsbiologischen Sensitivitätsanalyse und vorhabentypspezifischen Mortalitätsanalyse,
- Verbindung einer vorhabenunabhängigen Wert- und Empfindlichkeitseinstufung der Arten mit einer vorhabenbezogenen Bewertung der Gefährdungskonstellation.
Zu einigen wichtigen Aspekten besteht allerdings seitens der Autoren des vorliegenden Beitrags Kritik an der Methode von Bernotat et al. (2018) und es wird Modifizierungsbedarf für eine fachlich vertretbare Anwendbarkeit gesehen. Die zentrale Frage ist, ob rein Matrix-basierte Bewertungsverfahren komplexe biologische und naturschutzrechtliche Sachverhalte adäquat abbilden können.
1.2 Kurzdarstellung der Gesamtmethodik nach Bernotat et al. (2018)
Die Arbeitshilfe „Arten- und gebietsschutzrechtliche Prüfung bei Freileitungsvorhaben“ von Bernotat et al. (2018, BfN-Skripten 512) stellt eine Konkretisierung des von Bernotat & Dierschke (2016) vorgelegten Bewertungsrahmens und der methodischen Anforderungen bei der naturschutzfachlichen und -rechtlichen Beurteilung von Freileitungsvorhaben dar. Dabei entwickelten die Autoren die Kriterien zur Einstufung der Konfliktintensität (KI) eines Vorhabens zum Beispiel hinsichtlich seiner Leitungskonfiguration, zur Bedeutung und Betroffenheit von Gebieten und Arten in Abhängigkeit von der Lage des Vorhabens im Raum im Hinblick auf das konstellationsspezifische Risiko (KSR) praxisbezogen weiter. Mit der ergänzend dazu Ende 2019 erschienenen Arbeitshilfe „Artspezifische Wirksamkeiten von Vogelschutzmarkern an Freileitungen“ (Liesenjohann et al. 2019, BfN-Skripten 537) wurde der Methodenvorschlag komplettiert.
Die zentralen Bausteine des methodischen Ansatzes nach Bernotat et al. (2018) in Verbindung mit Liesenjohann et al. (2019) zur Beurteilung der Planungs-/Verbotsrelevanz des Vorkommens einer anfluggefährdeten Vogelart im Umfeld eines Freileitungs-Bauvorhabens sind:
- die vorhabentypspezifische Mortalitätsgefährdung der Art (vMGI),
- das konstellationsspezifische Risiko (KSR) für die Art im konkreten Fall und
- Möglichkeiten der Risikominderung durch Vermeidungsmaßnahmen.
Durch Verknüpfung von vMGI der untersuchten Art und des ermittelten KSR ist zu beurteilen, ob eine Verbotsrelevanz eintritt. Dazu definieren Bernotat et al. (2018) Schwellen, bei denen mit einer planungs- beziehungsweise verbotsrelevanten Wirkung zu rechnen ist. Je höher der vMGI einer Art, desto niedriger liegt die Schwelle des KSR eines Vorhabens für die Verwirklichung gebiets- oder artenschutzrechtlicher Verbote im jeweiligen Einzelfall. Im Rahmen der Prüfung erfolgt dabei eine Fokussierung auf die freileitungssensiblen Arten. Dazu zählen alle Arten der vMGI-Klassen A und B sowie jene der Klasse C, die regelmäßig in spezifischen Gebieten (insbesondere Feuchtgebieten) oder Ansammlungen vorkommen und bei denen daher erhöhte Betroffenheiten auftreten können. Wenn die Schwelle im Hinblick auf eine Art erreicht oder überschritten wird, liegen ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko im artenschutzrechtlichen Sinne oder eine erhebliche gebietsschutzrechtliche Beeinträchtigung vor. Entsprechend sind für das Vorhaben beziehungsweise den entsprechenden Trassenabschnitt Maßnahmen zur Vermeidung beziehungsweise Schadensbegrenzung vorzusehen (zum Beispiel Vogelschutzmarker, Verschiebung der Trasse, Nutzung bestimmter Masttypen etc.), deren Wirksamkeit wiederum artspezifisch in die Bewertung eingestellt wird.
2 Generelle Bedenken gegenüber dem methodischen Ansatz
Grundlegende Bedenken gegenüber dem methodischen Ansatz von Bernotat et al. (2018) bestehen seitens der Autoren des vorliegenden Beitrags in erster Linie bezüglich der starren Vorgaben, mit denen unterschiedliche Bewertungsindizes zu einem Endergebnis verknüpft werden, aus dem sich das Über- oder Unterschreiten der Signifikanzschwelle gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für das Tötungs- und Verletzungsrisiko für eine betrachtete Art oder Fallkonstellation unmittelbar ableitet. Das Ziel dieses Vorgehens ist es gemäß Bernotat et al. (2018), durch eine Operationalisierung der Einzelaspekte die Bewertung nachvollziehbarer zu gestalten und gleichzeitig das Ergebnis reproduzierbar und rechtssicher zu machen. Allerdings ist dieser Weg nur gangbar, wenn das letztlich durch einen Algorithmus erzeugte Ergebnis auch der fachlichen Einschätzung standhält. Insbesondere stellen die große Vielfalt an artspezifischen Verhaltensweisen, Reaktionsmustern sowie räumlichen Einzelfallkonstellationen und die daraus resultierenden hochkomplexen ökologischen Wirkungsgefüge hinsichtlich einer Einstufung möglicher Kollisionsrisiken in ordinale Zahlenskalen und relativ einfache Tabellenverknüpfungen eine große Herausforderung dar.
Maßgebliche rechtliche Fragestellungen im Arten- und Gebietsschutz erfordern ökologische Bewertungen und Einschätzungen (etwa Vorliegen einer „erheblichen Störung einer Art“ oder der „günstige Erhaltungszustand“). Weder im Arten- noch im Gebietsschutz gibt es jedoch normkonkretisierende Regelungen, die rechtlich bindende Vorgaben für die ökologische Bewertung und Einschätzung – wie etwa die Anwendung einer bestimmten Methodik – enthalten. Der Gesetzgeber überlässt die Beantwortung zentraler Rechtsfragen im Arten- und Gebietsschutz daher außerrechtlichen naturschutzfachlichen Kriterien.
Das Bundesverfassungsgericht hat zwar in seinem Beschluss vom 23.10.2018 (1 BvR 595/14, Rn. 24) betont, dass der Gesetzgeber gehalten ist, aus verfassungsrechtlichen Gründen für eine gesetzliche oder zumindest untergesetzliche Maßstabsbildung zu sorgen, jedoch müssen derartige Maßstäbe und Methoden selbst dann, wenn sie in Gesetzen oder untergesetzlichen Regelwerken (etwa Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften) enthalten sind, nach unserer Auffassung die jeweiligen naturschutzfachlichen Erkenntnisse und Rahmenbedingungen zum Beispiel im Hinblick auf die autökologischen und ethologischen Reaktionsmuster der Arten in jedem Einzelfall hinreichend berücksichtigen.
Erst recht gilt dies für sonstige Handlungsempfehlungen und ähnliches, die sich als außerrechtliche naturschutzfachliche Maßgaben nicht auf einen gesetzgeberischen oder vom Gesetzgeber abgeleiteten Wertungsspielraum berufen können. Hier ist daher neben einer umfassenden Abstimmung unter Beteiligung der maßgeblichen Expertenkreise und auch der Fachöffentlichkeit ein breiter wissenschaftlicher Konsens durch Anerkennung in der Praxis unverzichtbar (vergleiche Bundesverwaltungsgericht vom 12. Juni 2019 – 9 A 2/18, Rn. 64 sowie Bernotat 2019, Folie 21). Auch wenn das BfN die Methodik von Bernotat et al. (2018) als Fachkonvention/Fachstandard ansieht (Bernotat 2019, insbesondere Folien 1 und 30), bestehen seitens der Autoren des vorliegenden Artikels Zweifel an der ausreichenden Berücksichtigung naturschutzfachlicher Erkenntnisse und der hinreichenden Einbeziehung von Expertenmeinungen.
Die hinreichende Berücksichtigung der jeweiligen naturschutzfachlichen Erkenntnisse und Rahmenbedingungen setzt unter anderem voraus, dass die Datengrundlagen für die Bewertungskriterien der einzelnen Grundbausteine fachlich (im Idealfall sogar statistisch) hinreichend abgesichert sind. Dies ist bei der vorliegenden Methode beispielsweise beim vorhabentypspezifischen Tötungsrisiko (vT), beim vMGI sowie beim KSR zumindest teilweise fraglich, wie noch gezeigt wird. Unsicherheiten und mögliche Fehleinschätzungen innerhalb einzelner Indizes können sich somit im Zuge der Verschneidung fortsetzen, verstärken und damit die Validität des Ergebnisses zunehmend infrage stellen.
Hinzu kommt, dass das Bewertungssystem vor allem auf der Planfeststellungsebene häufig eine große Anzahl an zu bewertenden Fallkonstellationen ins Auge fassen muss. Dazu zählen neben der Anzahl zu berücksichtigender Arten und deren räumlicher Verteilung (etwa kleine Kolonie, große Kolonie) sowie der jeweiligen artspezifischen Aktionsräume auch die Anzahl an leitungstechnischen Konstellationen (unter anderem Neubau, Parallelführung mit Bestandsleitungen, Ersatzneubau, verschiedene Mastgestängetypen und deren räumliche Überlappungsbereiche). Die für die Methode notwendige Datenbasis (das heißt Zuordnung zu einzelnen Indizes) wird somit schnell hochkomplex. Aufgrund der Berücksichtigung mehrerer Matrizes und starrer Verknüpfungsregeln ist diese Methode daher fehleranfällig. Somit stehen dem Anspruch auf eine plausible und einfache Methode insbesondere Zweifel an der Verfahrenssicherheit entgegen.
Erste Erfahrungen in der Anwendung der Methode in der Bundesfachplanung durch die Autoren haben gezeigt, dass in einigen nicht unwesentlichen Fällen art- oder projektspezifische Einzelfallsituationen zu wenig berücksichtigt und folglich – unserer Auffassung nach – in fachlich unzulässiger Weise zu sehr pauschalisiert werden.
Bedenken bestehen weiter dazu, ob das Bewertungsverfahren mit der derzeitigen Rechtsprechung in Bezug auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (individuelles Tötungsverbot) konform ist. Es ist fachlich durchaus nachvollziehbar und in der aktuellen Rechtsprechung (BVerwG 9 B 25.17 vom 08.03.2018, Rn. 28) teilweise auch schon aufgegriffen, dass für ubiquitäre und populationsbiologisch „robuste“ Arten im Rahmen von Planungs- oder Genehmigungsentscheidungen gegebenenfalls keine weitergehenden oder differenzierteren Ermittlungen hinsichtlich eines projektbedingten Tötungsrisikos notwendig sind, sofern nur wenige Individuen betroffen sind. Dennoch ist der bundesweite Erhaltungszustand einer Population bisher allein kein Maßstab zur Relativierung einer etwaig signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos betroffener Individuen. Die Auswirkungen auf den Erhaltungszustand werden gegebenenfalls erst im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft, wobei dann auch die konkrete Zahl der betroffenen Individuen von besonderer Relevanz ist. Die starke Gewichtung der bundesweiten Bestandssituation einer Art beim Kriterium „Seltenheit“ schränkt die Aussagefähigkeit des MGI/vMGI für Vorhaben mit vor allem regionaler Bezugsebene damit stark ein.
Große Bedenken bestehen aus Sicht der Autoren dahingehend, dieses zur Bestimmung der artenschutzrechtlichen Signifikanzschwelle entwickelte Verfahren gleichermaßen für die Erheblichkeitsschwelle im Kontext des Gebietsschutzes gemäß § 34 BNatSchG anzuwenden. So differenzieren Bernotat et al. (2018) bezüglich der aus der Bewertung des KSR im Abgleich mit der vMGI-Klasse zu ziehenden Schlussfolgerung im Sinne einer Planungs- und Verbotsrelevanz nicht zwischen der möglichen Verwirklichung des artenschutzrechtlichen Tötungsverbotes und erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura-2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen (Bernotat et al. 2018, Kapitel 4.4.2, S. 29; Bernotat in Amprion GmbH 2019, Kapitel 2, Seite 89). Dabei sind sehr verschiedene fachliche und rechtliche Beurteilungsmaßstäbe sowie verschiedene Maßstäbe an die Prognosesicherheit anzulegen. Die von Bernotat et al. 2018 (Kapitel 4.4.2, Seite 29) benannte Berücksichtigung des Erhaltungszustandes einer Art innerhalb des MGI bezieht sich ausschließlich auf einen überregionalen Zustand. Vorhandene oder zukünftige Beeinträchtigungen der Population einer Art im Gebiet dürfen allerdings – anders als beim Artenschutz – nicht dadurch relativiert werden, dass die Art auf nationaler Ebene einen günstigen Erhaltungszustand aufweist. In dem nach Veröffentlichung der Methode stattgefundenen Austausch mit Experten weist das BfN schriftlich darauf hin, dass „i.d.R. das individuenbezogene artenschutzrechtliche Tötungsverbot die strengere Prüfnorm sei. Wenn ein Vorhaben an keinem artenschutzrechtlichen Verbot scheitert, dann ist davon auszugehen, dass auch keine Erheblichkeit beim Gebietsschutz für die entsprechenden Arten zu attestieren ist“ (BfN 15.08.2019 schriftlich). Mit den Aussagen des BfN sind scheinbar vorhandene Wertungsspielräume eingeschränkt.
Wenn die Konfliktbewertung im Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung für ein konkretes Gebiet durch den vMGI maßgeblich auf den Erhaltungszustand einer Art in Deutschland (Rote-Liste-Status, Bestandstrend) fokussiert – wie es in der Methode von Bernotat et al. (2018) angelegt ist – und nicht auf die Situation der betroffenen Art im jeweiligen Gebiet, bestehen daher erhebliche rechtliche Risiken. Dies wird an folgenden Beispielen verdeutlicht:
Weißstorch ( Ciconia ciconia ): Die Art, für die Bernotat & Dierschke (2016, Anlage 16.2) ein sehr hohes vT angeben, ist gemäß Bernotat et al. (2018, Tab. 15) unter Hinweis auf neue SPEC-Kriterien und neue Rote Listen einzelner Bundesländer von der vMGI-Klasse A in die Klasse B herabgestuft worden. In der Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung zum Vogelschutzgebiet (VSG) „Plothener Teiche“ für die geplante 380-kV-Freileitung Röhrsdorf-Weida-Remptendorf gemäß Nr. 14 der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) hätte die Heranziehung des vMGI B als Beurteilungskriterium zu einer Fehlbewertung geführt, da die Art im VSG einen schlechten Erhaltungszustand aufweist und essenzielle Nahrungsflächen nur eines einzigen knapp außerhalb des VSG brütenden Horstpaars zum VSG gehören. Daher wurde für die Bewertung statt des vMGI das sehr hohe vT herangezogen. Da der Weißstorch im Freistaat Thüringen als vom Aussterben bedroht eingestuft ist (Frick et al. 2011), war bei dem gleichen Vorhaben seine im Vergleich zum Bundesdurchschnitt kritischere Gefährdungssituation auch bei der artenschutzrechtlichen Bewertung zu berücksichtigen.
Zwergtaucher ( Tachybaptus ruficollis ): Für diese Art geben Bernotat & Dierschke (2016, Anlage 16.2) ein hohes vT an; sie ist gemäß Bernotat et al. (2018, Anlage 4) in die vMGI-Klasse C eingestuft, sodass gemäß dem Methodenkonzept von Bernotat & Dierschke (2016) erst ein hohes KSR als verbotsrelevant einzustufen ist. In der Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung zum VSG „Ackerhügelland nördlich Weimar mit Ettersberg“ für eine großräumige Alternative der geplanten 380-kV-Freileitung Pulgar-Vieselbach gemäß Nr. 13 der Anlage zum BBPlG hätte die Heranziehung des vMGI C als Beurteilungskriterium zu einer Fehlbewertung geführt, da die Art im VSG einen schlechten Erhaltungszustand mit nur 1–5 Brutpaaren aufweist. Daher wurde bei der Bewertung statt dem vMGI das hohe vT der Art berücksichtigt.
3 Diskussion zum vorhabentypspezifischen Tötungsrisiko (vT) von Vogelarten
Die Herleitung des vT von Vogelarten gemäß Bernotat & Dierschke (2016, Anlage 16.2) basiert „auf Kenntnissen zur Biologie und zum Verhalten der Art, Totfundzahlen bzw. -statistiken an den jeweiligen Vorhabentypen, publizierten Skalierungen von Fachkollegen und Fachkolleginnen sowie eigenen Einschätzungen“ (Seite 65 ff). Wie Bernotat & Dierschke (2016) weiter ausführen, wurde hierfür eine „z.T . sehr umfangreiche Recherche und Auswertung deutscher sowie europäischer Quellen zu Totfunden durchgeführt“. Die Daten und darauf basierende Ableitungen finden sich unverändert in Bernotat et al. (2018) wieder. Im nächsten Arbeitsschritt zur Anwendung der Methode nach Bernotat et al. (2018) wird das vT mit der allgemeinen Mortalitätsgefährdung der Art (MGI) aggregiert und daraus der vMGI der Arten generiert.
Bezüglich der Ausführungen von Bernotat & Dierschke (2016) besteht nach unserer Auffassung folgende Kritik:
- Die Ableitungen bei den Einstufungen des vT sind oftmals zu grob oder zu unspezifisch, sie berücksichtigen zum Teil relevante Sachverhalte innerhalb des Verhaltensrepertoires einer Art im Jahresverlauf nicht hinreichend. So findet etwa keine Unterscheidung der Totfundzahlen von Brut- und Rastvögeln statt.
- Der Informationsgehalt der zur Verfügung stehenden Daten wurde in einigen Fällen nicht ausgeschöpft (etwa zum Status der Art, zu speziellen Verhaltensweisen oder unterschiedlich hohen Risiken an Freileitungen verschiedener Spannungsebenen; siehe hierzu auch die folgenden Beispiele). Mit diesen ließen sich die erforderlichen Spezifizierungen durchführen.
- Im Fazit ist die Einstufung des vT für eine Reihe von Arten nicht korrekt und führt nach strenger Anwendung des Bewertungsverfahrens zu einer Fehlbewertung.
Diese relevanten Aspekte werden im Folgenden anhand der Arten Kranich, Schwarzstorch, Flussregenpfeifer und Großer Brachvogel beispielhaft erläutert.
Kranich ( Grus grus ): Bei dieser Art wird gemäß Bernotat & Dierschke (2016) bei der Einstufung des vT – so wie bei allen Arten – nicht zwischen der Gefährdung als Brut- beziehungsweise Rastvogel unterschieden. Dies ist nach Auswertung der zugrunde liegenden Daten zu hinterfragen. Ein wichtiger im Kontext der Anfluggefährdung zu berücksichtigender Faktor innerhalb des Jahreszyklus der Art ist, dass sie zur Brutzeit und der Zeit der Führung der Jungen brutortstreu ist und trotz Paar- und Imponierflügen zur Revierabgrenzung in der (frühen) Balzphase insgesamt weniger und niedrigere Flugbewegungen zeigt als dies während des restlichen Jahresverlaufs (Zug- und Rastzeit) der Fall ist (Glutz von Blotzheim 1994). Bei Nichtbrütern (Immaturen) hingegen sind auch während der Brutzeit mehr Flugbewegungen feststellbar (Nowald 2003, Nowald mdl. 2019).
Daher ist im Grundsatz davon auszugehen, dass Kraniche während der Brutzeit weniger anfluggefährdet sind und infolgedessen seltener an Freileitungen verunglücken sollten. Wenn dies in diesem Zeitraum doch geschieht (etwa bei plötzlichem Auffliegen aufgrund von Störereignissen), ist es zudem ohne Weiteres möglich, dass niedrige Freileitungen (zum Beispiel Mittelspannungsfreileitungen sowie 110-kV- und 220-kV-Freileitungen in Einebenen-Bauweise) eine größere Gefahrenquelle für den Kranich darstellen als beispielsweise eine hohe 380-kV-Freileitung.
Der Einstufung des vT für den Kranich liegt für Deutschland ausschließlich der Datensatz von Langgemach (2016) mit 236 Anflugopfern zugrunde. Der Datensatz wurde erneut angefragt und führt nun 255 Anflugopfer auf (Stand 30.10.2019). Hierin enthalten sind 18 Ereignisse mit > 1 Individum als Anflugopfer (insgesamt 179 Individuen), davon drei Ereignisse mit allein schon 140 Individuen (111, 19 sowie zehn Anflugopfer) sowie 76 Ereignisse mit jeweils einem Anflugopfer (Aufschlüsselung nach Brut- und Rastzeiträumen siehe Tab. 1).
Dieser Datensatz weist demnach circa 16 % der Anflugopfer während der Brutzeit aus und circa 71 % während der Zug- und Rastzeit. Bei den 42 zur Brutzeit gefundenen Individuen sind 18 enthalten, deren Alter in den Grundlagendaten nicht angegeben ist. Sie wurden in einem konservativen Ansatz den Brutzeit-Individuen zugeordnet (es könnte sich aber auch zum Teil um Immature gehandelt haben, sodass sich der Unterschied Brut-/Rastzeit weiter vergrößern würde). Verstärken könnte sich dieser Unterschied zudem noch dadurch, dass der Kranichzug noch bis etwa Mitte April auf hohem Niveau anhält (Dürr schriftlich 2019). Dem stehen Anflugopfer während der Balzzeit (Paar- und Imponierflüge) ab Februar gegenüber (ebenda).
Weiterhin liefern die Daten Hinweise, dass die Anflugereignisse während der Zug- und Rastzeit von wenigen „Großereignissen“ stark beeinflusst werden. So sind zwei der angesprochenen drei Ereignisse mit den meisten Anflugopfern mit 121 Individuen (111+10) diesem Zeitraum zuzurechnen (das dritte Ereignis mit 19 Anflugopfern ereignete sich in einem unbekannten Zeitraum, siehe Tab. 1).
Darüber hinaus liefern die Daten Hinweise, dass niedrigere Leitungen zur Brutzeit für Kraniche gefährlicher sind: an Mittelspannungsleitungen verunglückten zur Brutzeit circa 36 % der Anflugopfer, während es zur Rastzeit nur circa 7 % sind. Generell verunglückten Kraniche eher an niedrigeren Leitungen, was sichtbar wird, wenn die Kategorie Hoch- und Höchstspannungsfreileitung weiter aufgeschlüsselt wird: Die meisten Opfer sind an 220-kV-Einebenen-, 110-kV- sowie Mittelspannungsfreileitungen zu verzeichnen. Diese Erkenntnisse müssten bei der Bewertung zur Vermeidung von Fehlinterpretationen berücksichtigt werden.
Schwarzstorch ( Ciconia nigra ): Hier stellt die Veröffentlichung von Hormann & Richarz (1997) die Hauptquelle für die vT-Einstufung von Bernotat & Dierschke (2016) mit „sehr hoch“ dar (mit 30 von insgesamt 36 verzeichneten Anflugopfern). Gemäß Hormann & Richarz (1997) sind die 30 Opfer überwiegend an Nieder- und Mittelspannungsleitungen verunglückte Jungvögel. Vier weitere dokumentierte Schlagopfer stammen aus Bulgarien (Demerdzhiev et al. 2009, 20-kV-Leitung, ohne Altersangabe).
Vor diesem Hintergrund soll ein fiktives Beispiel die Bewertung des Neubaus einer 380-kV-Freileitung als Mehrebenenmast im Vergleich zum Neubau einer Mittelspannungsleitung im zentralen Aktionsraum eines Schwarzstorchpaares veranschaulichen.
Grundlagen der Bewertung gemäß Bernotat et al. (2018) wären hier die folgenden Einstufungen:
- vT Schwarzstorch = sehr hoch
- MGI Schwarzstorch = Klasse II.5
- Ergebnis: vMGI von B (hoch) für den Schwarzstorch.
Die Einstufung des KSR gemäß den Vorgaben von Bernotat et al. (2018) führt dazu, dass das Vorhaben nur als Mittelspannungs-, nicht aber als Höchstspannungsleitung genehmigungsfähig wäre (Tab. 2). Dieses Ergebnis steht im starken Widerspruch zur realen Gefährdung des Schwarzstorchs durch Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen. Die vorhandenen Daten belegen, dass die Art vor allem nach störungsbedingtem Auffliegen an Mittelspannungsfreileitungen verunglückt, die Nahrungshabitate überspannen (Hormann & Richarz 1997). Diese Tatsache findet aber keinen Eingang in die Einstufung des vT für die Art durch Bernotat et al. (2018).
Flussregenpfeifer ( Charadrius dubius ): In ganz Europa ist bisher nur ein einzelner Fund eines mit einer Freileitung kollidierten Individuums dokumentiert. Das vT wird als hoch (2) eingestuft, da „Limikole vergleichbar in Ökologie + Verhalten“. Da diese Aussage zu allen kleinen Limikolenarten getroffen wird, kann der Vergleich nur zu größeren Arten mit anderen Habitatansprüchen gezogen werden. Eine Vergleichbarkeit scheint nicht plausibel. Zudem wird in Bernotat & Dierschke (2016) für die Kollisionsgefährdung an Straßen darauf hingewiesen, dass „Brut u. Nahrungserwerb am Boden“ stattfinden. Dieser Hinweis fehlt für Freileitungen. Trotz höherer Verlustzahlen (sieben in Europa) wird bei dem Vorhabentyp „Straße“ das vT der Art auf gering (4) gesetzt. Eine Begründung der deutlich unterschiedlichen Einstufungen ist nicht erkennbar.
Großer Brachvogel ( Numenius arquata ): Bei Bernotat et al. (2018) wird die Art mit ihrer vT in die Kategorie einer „sehr hohen“ (1) Gefährdung eingeordnet. Eine Analyse der Anflugverluste aus der gleichen Arbeit ergibt insgesamt 12 Nachweise von in Deutschland gefundenen Leitungskollisionsopfern (Hörschelmann et al. 1988: 3, Gutsmiedl & Troschke 1997: 7, Langgemach 2016: 2). Hier ist festzuhalten, dass es sich bei den in Gutsmiedl & Troschke (1997) beschriebenen sieben Anflugopfern allesamt um Rastvögel handelt, die an einer küstennahen 110-kV-Leitung während zwei Herbstperioden dokumentiert werden konnten. Dabei konnten in einem der Untersuchungsgebiete Tagesmaximalzahlen von über 1.200 Großen Brachvögeln erfasst werden. Es konnte in mehreren hundert Beobachtungsstunden keine Kollision beobachtet werden. So wird von Gutsmiedl & Troschke (1997) daher die Vermutung geäußert, dass die Anflüge bei ungünstigen Wetter- und Lichtbedingungen erfolgten.
Weitere Anflugverluste von Großen Brachvögeln an Freileitungen außerhalb von Deutschland sind von Scott et al. (1972) dokumentiert (ein Anflugopfer an einer 400-kV-Leitung), für die Niederlande von Koops (1986, 397 Kollisionsopfer im Erfassungszeitraum von 1960–1985 an unterschiedlichen Leitungen und zu unterschiedlichen Jahreszeiten) sowie von Hartmann et al. (2010, 27 Kollisionsopfer von Rastvögeln an einer 150-kV-Leitung innerhalb von zwei Zugperioden). Für Italien sind in der zusammenfassenden Arbeit von Rubolini et al. (2005) drei Kollisionsopfer benannt. Eine Zuordnung zu einer bestimmten Leitung oder zu einer Jahreszeit findet dort nicht statt. Bisher in die Übersicht nicht eingegangen sind vier Totfunde Großer Brachvögel an einer 380-kV-Leitung in Baden-Württemberg von Martin Boschert in den 2010er-Jahren. Der Brachvogelexperte führt diese Verluste vor allem auf Störungsereignisse oder schlechte Witterungsbedingungen zur Brutzeit zurück. In derartigen Situationen greifen Gewöhnungs- und Lerneffekte vermutlich nicht (Boschert mündlich).
Von den hohen Zahlen abgesehen, die bei Koops (1986) aufgeführt sind (im Durchschnitt circa 16 pro Erfassungsjahr) und im Zusammenhang mit dem in Mitteleuropa sehr hohen Brutbestand des Großen Brachvogels in den Niederlanden (4.643–5.949 Brutpaare, BirdLife International 2017) zusammen mit den dort ebenfalls starken Rastvogelbeständen (143.390–219.237 Individuen, 30–35 % des europäischen Bestandes, ebenda) zu sehen sind, fallen Verluste während der Brutzeit eher gering aus. Dies muss im Zusammenhang mit der bodennahen Lebensweise dieser Art während der Brutperiode gesehen werden. So konnten Altemüller & Reich (1997) bei ihrer Untersuchung zum Einfluss von Hochspannungsfreileitungen auf Brutvögel des Grünlandes in der Norddeutschen Tiefebene zeigen, dass Große Brachvögel bei Habitateignung die Trassennähe keineswegs meiden, sogar im unmittelbaren Trassenbereich brüten, auf den Masten sitzende Rabenkrähen ausdauernd und heftig attackieren, die Leitungen beim reviermarkierenden Ausdrucksflug mit mehr als 10 m Abstand über- und bei anderen Flügen unterfliegen. Neben diesem beschriebenen Verhalten ist bei der Einstufung des vT zu beachten, dass sich die Vögel während der Brutzeit außer bei plötzlich auftretenden Störereignissen bevorzugt am Boden (bei Nahrungssuche/Brut/Jungenführen) und bodennah (bei kleineren Ortswechseln) aufhalten.
Damit soll das potenzielle Anflugrisiko keinesfalls in Abrede gestellt werden. In einem Brutgebiet des Großen Brachvogels kann aber bei Langlebigkeit der Vögel durchaus von einem Erfahrungslernen ausgegangen werden. Außerdem muss nicht nur beim vMGI, sondern auch schon beim vT eine Unterscheidung von Brut- und Rastvögeln erfolgen.
Zwischenfazit
Die Beispiele zeigen, dass die Einstufungen des vT durch Bernotat et al. (2018) nicht die Realität hinsichtlich einer situationsgerechten Beurteilung der Arten abbilden. Die Einstufungen sind zu starr und es fehlt die Möglichkeit, aus den aufgezeigten Gründen die Gesamtlage der vorliegenden Fakten (Eigenschaften des zu beurteilenden Vorhabens, vom Vorhaben betroffene Individuen, Unterscheidung Brut- und Rastvogel und so weiter) verbalargumentativ berücksichtigen zu können. Wesentliche Merkmale zur Beurteilung einer Situation (etwa die Spannungsebene der zu beurteilenden Freileitung) mit regelmäßig eng korrelierten kollisionswirksamen Faktoren (wie zum Beispiel Sichtbarkeit der Seile, Höhe der Leitung und so weiter) können keine Berücksichtigung finden.
Eine Überprüfung und Anpassung der vT-Einstufungen dieser (und weiterer) Arten erscheint vor diesem Hintergrund zwingend notwendig.
4 Diskussion des Konstellationsspezifischen Risikos (KSR)
4.1 Erläuterung des Methodenschritts
Zur Ermittlung des KSR eines Vorhabens wird diesem nach Bernotat et. al. (2018) anhand projektbezogener und raumbezogener Kriterien sowie der Lage des Vorhabens zum Artvorkommen eine Konfliktintensität zugeordnet.
Die zu beurteilenden Kriterien werden in vier Kategorien eingeteilt:
- projektbezogenes Kriterium (Konfliktintensität der Freileitung),
- raumbezogenes Kriterium (Individuenzahl, räumlich funktionale Beziehungen),
- Entfernung (Raumnutzung, Lage des Vorhabens zum Aktionsraum),
- Vermeidungs- und Schadensbegrenzungsmaßnahmen (insbsondere Vogelschutzmarkierungen).
Die einzelnen Kriterien können jeweils die folgenden Wertstufen erreichen: (-) – nicht vorhanden, 1 – gering, 2 – mittel, 3 – hoch (gemäß Bernotat in Amprion GmbH 2019).
Beispiele zur Einstufung der Kriterien sind tabellarisch in Bernotat et al. (2018: 50, Tab. 16) dargestellt.
4.2 Beurteilungsspielräume bei den einzelnen Kriterien
Nach strenger Lesart erscheinen die Kriterien und die ihrer Bewertung zugrunde liegenden Definitionen, zum Beispiel die Zuweisung kreisrunder Aktionsräume mit fest definierten Radien zu sensiblen Gebieten oder einzelnen Arten (vgl. Bernotat et al. 2018, Tab. 14 und 15), zunächst starr und wenig praxisnah. Grundsätzlich ist jedoch die fachgutachterliche Konkretisierung fallspezifischer Bewertungsgrundlagen innerhalb eines durch Bernotat et al. (2018) festgelegten Rahmens möglich und teilweise auch erwünscht. Einige Erläuterungen dazu finden sich in Bernotat et al. (2018, Kapitel 8).
Im Folgenden werden die den Kriterien innewohnenden Beurteilungsspielräume, jedoch auch verbleibende Fragestellungen dargelegt.
4.2.1 Projektbezogenes Kriterium – Konfliktintensität der Freileitung
Für die gutachterliche Einschätzung stellt die Tabelle „Freileitungsvorhabentypen und deren Konfliktintensität hinsichtlich Leitungskollision“ gemäß Bernotat et al. (2018: 81 f, Tab. 19) die Grundlage dar. Da in Kapitel 9 der BfN-Arbeitshilfe basierend auf drei Jahren Praxiserfahrung und unter Abstimmung mit Kollegen aus der Praxis eine sehr weitreichende Differenzierung hinsichtlich der Konfliktintensität verschiedener Leitungskategorien und Ausbauformen vorgenommen und validiert wurde, besteht aus Sicht des BfN hier kein weiterer Abstimmungsbedarf (BfN 30.09.2019 schriftlich).
Aus unserer Sicht ergeben sich in der praktischen Anwendung jedoch gleichwohl Defizite. Im begründeten Fall sollte daher die Möglichkeit für Erweiterungen und Anpassungen der Methodik bestehen. Folgende Haupt-Kritikpunkte haben sich in der bisherigen praktischen Anwendung ergeben:
[1] Der pauschalen Aussage, dass eine höhere Leitung ein höheres Konfliktpotenzial mit sich bringt, kann nicht für alle Konstellationen oder Arten gefolgt werden. Bei der Leitungskonfiguration wird ein Einebenenmast grundsätzlich als geringeres Risiko gegenüber dem in der Regel höheren Mehrebenenmast benannt (Bernotat et al. 2018, Tab. 19, S. 81/82 und Kap. 10.3, S. 94). Jedoch kann mit Einebenenmasten aufgrund der breiteren Überspannung darunter liegender Habitatflächen für bestimmte Arten ein höheres Kollisionsrisiko bestehen, als dies bei schmaleren und höheren Mehrebenenmasten der Fall wäre.
Konkrete Beispiele dazu aus der Praxis
Flugrouten eines Schwarzstorchs entlang eines Bachtals: Konkrete Beobachtungen zur Erfassung der Raumnutzung eines Schwarzstorch-Brutpaares zeigten regelmäßige Nahrungsflüge entlang von Bachtälern im Mittelgebirge (Lange GbR 2019). Die Tiere flogen dabei immer sehr niedrig und unterflogen nach Querung einer Straße eine straßenbegleitende Freileitung, welche das Bachtal quert. Es ist hier nicht nachvollziehbar, dass eine niedrigere und breitere Leitung konfliktärmer sein soll als eine höhere und schmalere, welche mehr Flugraum zur Unterquerung bietet.
Bruthabitat von Rallen und ähnliches: Arten wie zum Beispiel Wasserralle und Tüpfelsumpfhuhn halten sich als Brutvögel nahezu ausschließlich am Boden im Schilf auf. Flüge werden selten durchgeführt. Wenn diese stattfinden, dann nur über kurze Distanzen niedrig über der Vegetation. Selbst Flucht findet fußläufig statt (Glutz von Blotzheim 1994, auch in Anhang 2 von Bernotat et al. 2018). Die vMGI-Klasse B führt dazu, dass insbesondere hohe Leitungen mit großem Abstand der untersten Seilebene zum Boden (Höchstspannung) genehmigungsrechtlich als problematisch eingestuft werden. Niedrigere Leitungen dagegen werden besser eingestuft, obwohl diese im Vergleich zu Leitungen der Höchstspannungsebene die potenziell größere Gefahr darstellen. Eine vergleichbare Situation entsteht auch bei Bewertung von Bruthabitaten des Kranichs und Großen Brachvogels (s. Beispiele in Abschnitt 4).
[2] Die anschließende „Verrechnung“ der eingesetzten Kriterien wirft weitere Fragen auf: Warum wiegt die vermeintlich verminderte Konfliktintensität durch die Verringerung von zwei (Donaumast) auf eine Leiterseilebene (Einebenenmast) die potenzielle Interaktion vieler Individuen mit der Freileitung auf? Bei welchen Arten und in welchen Situationen wäre ein solches „Aufrechnen“ der Kriterien fachlich vertretbar, in welchen Fällen aber nicht?
[3] Problematisch ist zudem, dass auf Ebene der Bundesfachplanung/Linienfindung in der Regel noch keine konkreten Informationen zum Mastdesign, deren Standorten und so weiter vorliegen, ein solcher Planungsstand bei Anwendung der Methode von Bernotat et al. (2018) jedoch bereits auf vorgelagerter Planungsebene zwingend erforderlich wird.
Im Hinblick auf die Einstufungen der Konfliktintensität nach Bernotat et al. (2018) wird nach unserer Auffassung eine Öffnung auch dieses Kriteriums für notwendig gehalten. Es sollte möglich sein, im konkreten Fall das Mastdesign in Hinblick auf das Flugverhalten einer betroffenen Art unter Berücksichtigung des gesamten Artenspektrums im betrachteten Raum einzelfallspezifisch und fachgutachterlich begründet anders zu beurteilen. So kann ein bestimmtes Mastdesign für das gesamte Artenspektrum im Betrachtungsraum hinsichtlich des Anflugrisikos günstiger sein, während das gleiche Design für eine Art aufgrund ihres artspezifischen Flugverhaltens nachteilige Auswirkungen haben kann (etwa durch die unterschiedlich breite Überspannung von Funktionsräumen wie zum Beispiel Kiebitzbalzplätzen).
4.2.2 Raumbezogenes Kriterium – Individuenzahl, räumlich funktionale Beziehungen
Das sogenannte raumbezogene Kriterium beschreibt die vom geplanten Vorhaben betroffene Individuenzahl beziehungsweise das Vorhandensein und die Bedeutung von Flugwegen. Im relevanten Raum erfasste Individuenzahlen werden bei Arten der vMGI-Kategorien A bis C für die in der Methodik erforderliche Einstufung von Ansammlungen in die Wertkategorien „lokale/regionale Bedeutung“ und „landesweite Bedeutung“ herangezogen. Bei Arten der vMGI-Kategorien A und B werden auch einzelne Brutpaare gewertet. Regelmäßig frequentierte Flugwege, sofern sie nicht über die Ansammlungen oder Brutreviere abgedeckt sind, können bei Bedarf für alle Arten der vMGI-Kategorien A bis C definiert werden, sofern sie nachgewiesen wurden.
Innerhalb dieses Kriteriums sind Konkretisierungen mit zunehmender Sachkenntnis zum Raum und zur Raumnutzung der Arten insbesondere zu folgenden Punkten möglich.
[1] Konkretisierung der betroffenen Brut- und Rastgebiete sowie ihrer Bedeutung und Individuenzahl (vgl. hierzu die Grundlagen in Bernotat et al. 2018, Kapitel 7) – eine fachgutachterliche Einschätzung der real vorhandenen konkreten Situation ist möglich (Bernotat in Amprion GmbH 2019). Dabei sind auch von (gegebenenfalls veralteten) offiziellen Daten abweichende Einstufungen von Gebieten oder Teilgebieten möglich, wenn sie jeweils nachvollziehbar begründet werden. Die offiziellen Grenzen etwa der Vogelschutzgebiete sind dabei nicht zwingend maßgeblich, sondern der real von der betroffenen Art oder Artengruppe genutzte Raum. Im Rahmen der Natura-2000-Studien sind auch Entwicklungs- und Wiederherstellungsziele zu berücksichtigen.
[2] Offiziell ausgewiesene Gebiete oder Ansammlungen, die über die definierten Typen laut Bernotat et al. (2018, Tab. 14) hinausgehen, haben zunächst nur rein indikatorische Funktion und können fachgutachterlich im Hinblick auf vorliegende Kollisionsrisiken beurteilt werden.
[3] Sporadische Einzelbruten von Arten, die außerhalb der definierten relevanten Gebiete auftreten, entfalten in der Regel keine Planungs- oder Verbotsrelevanz.
[4] Dichtezentren: Für in anderem Zusammenhang beschriebene „Dichtezentren“ von Arten ist die Methode Bernotat et al. (2018) eher optional und mit gewisser Zurückhaltung anwendbar, da eine Übertragbarkeit auf den Begriff der „Ansammlung“ nicht immer gegeben ist.
[5] Relevante Flugwege und -korridore können in der Regel über Habitatpotenzialanalysen (HPA) oder Raumnutzungsanalysen (RNA) abgeleitet werden.
Nach unserer Auffassung ist insbesondere die Öffnung der fachlichen Beurteilungsspielräume innerhalb dieses Kriteriums bei genauerer Kenntnis der Örtlichkeit und der Artvorkommen zu begrüßen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auf Individuen einer konkreten Art und nicht auf Artengruppen bezieht. Durch eine „gesammelte“ Beurteilung der Bedeutung eines Gebiets für ganze Artengruppen (zum Beispiel Wasservogelbrutgebiet) kann somit das Vorliegen eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos für eine einzelne betroffene Art nicht ermittelt werden. Fachgutachterlich ist hier eine noch nähere Konkretisierung etwa des artspezifischen Bruthabitats und der konkreten Bedeutung des Brutgebiets für die Art erforderlich.
Den vollständigen Artikel lesen Sie im PDF.
Von Klaus Jödicke, Melanie van de Flierdt, Arno Reinhardt, Frank Bernshausen, Christian Beste, Brunhilde Göbel, Christoph Herden, Boris Jechow, Moritz Mercker, Johannes Spannagel und Tim Strobach
Eingereicht am 18. 03. 2020, angenommen am 16. 01. 2021
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

















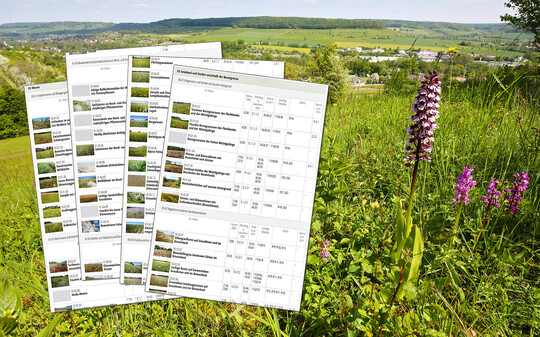


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.