Gebietseigenes Saatgut – Chance oder Risiko für den Biodiversitätsschutz?
Abstracts
Gemäß § 40 BNatSchG dürfen seit März 2020 bei Einsaaten und Anpflanzungen nur Pflanzen in der freien Natur ausgebracht werden, die „ihren genetischen Ursprung in dem betreffenden Gebiet haben“. Der Beitrag diskutiert Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Regelung im Hinblick auf die Verwendung von Wildpflanzensaatgut (unter Ausklammerung der Gehölze) mit besonderer Berücksichtigung faunistischer Aspekte. Er entstand aus einem Expertinnen- und Expertenworkshop mit dem Ziel, eine reflektierte interdisziplinäre Debatte zur Berücksichtigung genetischer Vielfalt anzustoßen, welche die Auswirkungen für die Naturschutzpraxis aus ganzheitlicher Sicht beleuchtet. Es wird deutlich, dass bestehende Regelungen auf großen Unsicherheiten fußen und massive Einschränkungen für die Wirksamkeit von Renaturierungen und die Erreichbarkeit übergeordneter naturschutzfachlicher Ziele mit sich bringen. Das betrifft besonders die ausgeklammerte Relevanz von Phytodiversität für das Vorkommen artenreicher Tiergemeinschaften und damit für möglichst vollständige Biozönosen sowie die Renaturierung von Biotopen. Aus der Analyse werden Lösungsmöglichkeiten abgeleitet, die dringend diskutiert werden sollten, um zielführende Regelungen für die Naturschutzpraxis zu etablieren.
Native seeds – opportunity or risk for biodiversity conservation? A thesis paper on the implementation of § 40 BNatSchG
According to § 40 BNatSchG, since March 2020 only plants that “have their genetic origin in the area concerned” may be spread in the wild. This article discusses possibilities for implementing this regulation with regard to the use of wild plant seeds (excluding woody plants) with special consideration of faunistic aspects. It emerged from an expert workshop with the aim of initiating a reflective interdisciplinary debate on the consideration of genetic diversity, which sheds light on the implications for nature conservation practice from a holistic perspective. It became clear that existing regulations are based on great uncertainties and entail massive restrictions for the effectiveness of restoration and for the attainability of higher-level nature conservation goals. This applies in particular to the excluded relevance of phytodiversity for the occurrence of numerous animal species and, thus, for species-rich ecological communities that are as complete as possible and the restoration of biotopes. Possible solutions are derived from the analysis, which should be urgently discussed in order to establish goal-oriented regulations for nature conservation practice.
- Veröffentlicht am

Von Eckhard Jedicke, Ulrike Aufderheide, Erwin Bergmeier, Oliver Betz, Stefan Brunzel, Philipp Eckerter, Anita Kirmer, Martin Klatt, Manfred Kraft, Andreas Lukas, Sandra Mann, Karsten Mody, Julia Schenkenberger, Hans Schwenninger, Josef Settele, Johannes L.M. Steidle, Sabine Tischew, Erik Welk, Volkmar Wolters und Ralf Worm
Eingereicht am 28. 02. 2022, angenommen am 15. 03. 2022
1 Einleitung, Handlungserfordernis
Aufgrund der gravierend schlechten Situation der Biodiversität, gerade in der Agrarlandschaft, reicht die Erhaltung und optimierte Nutzung oder Pflege der vorhandenen Flächen und Strukturen mit Naturschutzfunktionen allein bei Weitem nicht aus, um die anspruchsvollen Ziele aus der Konvention über die biologische Vielfalt, der EU-Biodiversitätsstrategie und den Biodiversitätsstrategien des Bundes und der Länder zu erreichen. Es bedarf in hohem Maße einer Erhaltung und der zusätzlichen Neuanlage von artenreichem Grünland und anderer Biotoptypen (etwa Fartmann et al. 2021 und Jedicke 2021 am Beispiel der Insekten).
Die Wiederherstellung von Ökosystemen ist heute weltweit als Schlüsselkomponente von Naturschutzprogrammen anerkannt und als Teil des Strebens nach Nachhaltigkeit unerlässlich (Aronson & Alexander 2013). Die UN startete 2021 die Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen und thematisiert damit diesen Handlungsbedarf (etwa Farrell et al. 2021). Sie möchte hierbei substanzielle Beiträge zur Erfüllung derSustainable Development Goals (SDGs ) leisten (IRP 2019). Dabei sollte (muss) ein ganzheitlicher, interdisziplinärer Ansatz verfolgt werden, um nicht selektiv nur einzelne Arten, sondern die natürlichen Ressourcen insgesamt mit einer breiten Vielfalt und Intensität an Ökosystemleistungen zu fördern (Edrisi & Abhilash 2021).
Unter Bezug auf denEuropean Green Deal hat die Europäische Kommission mit der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 das Ziel definiert, mindestens 30 % der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen, um ein kohärentes Netz von Schutzgebieten zu schaffen. Mindestens ein Drittel der Schutzgebiete – 10 % der EU-Landflächen und -Meeresgebiete – soll streng geschützt werden (Europäische Kommission 2020). Zugleich kündigt die Kommission darin einen EU-Plan zur Wiederherstellung von Ökosystemen an, um „den Zustand bestehender und neuer Schutzgebiete zu verbessern und die vielfältige und widerstandsfähige Natur wieder in alle Landschaften und Ökosysteme zurückzubringen“ (Europäische Kommission 2020). Im Januar 2022 legte die Kommission ein Arbeitspapier mit Kriterien und Leitlinien für die Schutzgebietsausweisung vor, in welchem sie auch den EU-Plan zur Wiederherstellung der Natur als Baustein zur Zielerreichung thematisiert (European Commission 2022). Ebenso wurde im neuesten Bericht der Arbeitsgruppe 2 des IPCC im Konsens aller Mitgliedsländer konstatiert, dass die Erhaltung der Resilienz der biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen auf globaler Ebene vom wirksamen und gerechten Schutz von etwa 30 bis 50 % der Land-, Süßwasser- und Meeresflächen der Erde einschließlich der derzeit naturnahen Ökosysteme abhängt (IPCC 2022; SPM.D.4).
Aus diesen Gründen wird in den nächsten Jahren erheblich größere Aufmerksamkeit als bisher auf Strategien und Maßnahmen des Naturschutzes zur Bewahrung, Wiederherstellung und Neuanlage von Biotopen und Ökosystemen zu richten sein. Der für die Begrünung erforderlichen Auswahl von Pflanzen und der Feststellung ihrer Vorkommensgebiete gibt § 40 Abs. 1 BNatSchG einen engen Rahmen vor: Seit März 2020 dürfen in der freien Natur nur noch Pflanzen ausgebracht werden, die „ihren genetischen Ursprung in dem betreffenden Gebiet haben“ . Dabei ist definitionsgemäß (§ 7 Abs. 2 Nr. 3) „jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart“ zu berücksichtigen. Für den Umstand, dass durch Ansaat von Saatgutmischungen eine Gefährdung von Biotopen oder Arten auszuschließen ist, trägt der Saatgutausbringende die volle Darlegungs- und Beweislast (Lau 2021).
Eine genaue Abgrenzung von „Gebieten“ erfolgt im BNatSchG nicht. Da Verbreitungsmuster von Ökotypen weitgehend unbekannt sind, werden bereits heute viele artenreiche Ansaaten nicht durchgeführt, obwohl sie die essenzielle Grundlage für die Entwicklung ökologisch hochwertiger Biotope sind, ohne die eine erfolgreiche Förderung verschiedenster Tiergruppen nicht möglich ist.
Der vorliegende Beitrag diskutiert die Möglichkeiten zur Umsetzung des § 40 BNatSchG unter erweiternder Berücksichtigung faunistischer Aspekte. Er entstand anhand eines Expertinnen- und Expertenworkshops des Kompetenzzentrums Kulturlandschaft (KULT) an der Hochschule Geisenheim mit dem Ziel, einen Beitrag zu einer reflektierten Debatte zur Berücksichtigung genetischer Vielfalt zu leisten.
2 Rechtliche Vorgaben und ihre Umsetzung
Das BNatSchG spannt in § 1 Abs. 1 einen weiten Rahmen für die Zielsetzungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege: „Natur und Landschaft sind […] so zu schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind“.
„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere […] wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 5). Ausdrücklich als Aufgabe des Artenschutzes wird in § 37 Abs. 1 Nr. 3 „die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Arten in geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets“ unabhängig von ihrem Rote-Liste- oder Schutzstatus nach Anhängen der FFH-Richtlinie hervorgehoben. Die daraus abzuleitende Erfordernis der Neuschaffung von standortangepasster Vegetation unterliegt mehreren weiteren gesetzlichen Vorgaben.
„Das Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur, deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, sowie von Tieren bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde. Dies gilt nicht für künstlich vermehrte Pflanzen, wenn sie ihren genetischen Ursprung in dem betreffenden Gebiet haben. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten der Mitgliedstaaten nicht auszuschließen ist.“ (§ 40 Abs. 1 BNatSchG).
Es geht damit um die Erhaltung der räumlich differenzierten Vielfalt, wie sie die Konvention über biologische Vielfalt (CBD) 1992 mit der expliziten Nennung innerartlicher genetischer Vielfalt als Schutzziel definiert hat. Florenverfälschung kann potenziell negative Auswirkungen auf weitere normative Schutzziele des § 1 Abs. 1 BNatSchG zeigen (Schoof et al. 2021).
In zahlreichen Arbeiten wurde gezeigt, dass die Populationen vieler Pflanzenarten an die lokale Umwelt angepasst sind und daher die Ökosystemfunktionen durch einheimische, lokal etablierte Pflanzen besser gewährleistet sind als durch nicht-heimische Pflanzen oder solche aus entfernt liegenden Beständen (etwa Bucharova et al. 2017). Das Abstellen des Gesetzestextes auf das Vorkommen in einem bestimmten Gebiet macht deutlich, dass § 40 Abs. 1 BNatSchG nicht nur die zwischenartliche Vielfalt, sondern auch die innerartliche Vielfalt zum Gegenstand hat (Lau 2021).
Hier folgt der Bundesgesetzgeber dem Artverständnis der Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) (vgl. COP 6 Decision VI/23). Die Einbeziehung von unter der Unterart angesiedelten niederen Taxa (Teilpopulation einer Unterart) verdeutlicht, dass auch Populationen unter den Rechtsbegriff der Art fallen und die Abgrenzung nicht nur anhand des phänotypischen Erscheinungsbildes, sondern auch anhand des Erbgutes erfolgt (Lau 2021). Die Unterscheidung gebietseigener von gebietsfremden Pflanzen hat somit auch bei der Anwendung von § 40 BNatSchG auf der Populationsebene zu erfolgen (Schumacher & Schumacher 2020).
Um die in § 40 BNatSchG eingeführten artspezifischen Vorkommensgebiete bei der Ausbringung von Saatgutmischungen handhabbar zu gestalten, wurden in einem Beschluss der LANA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung) die von Prasse et al. (2010) für Deutschland vorgeschlagenen 22 Ursprungsgebiete übernommen (BMUV 2021), die sich an die naturräumliche Gliederung (Meynen & Schmithüsen 1962) anlehnen. Das bedeutet, dass Vorkommensgebiete den Ursprungsgebieten entsprechen, unabhängig von der geografisch-genetischen Differenzierung der einzelnen Arten. Die Ursprungsgebiete wurden zudem in das Saatgutrecht als Karte integriert (Erhaltungsmischungsverordnung, ErMiV) und erlangten hier somit Rechtskraft. Dabei wird der Handel mit Saatgut über die Ursprungsgebietsgrenzen hinweg bis 2024 übergangsweise erlaubt.
Geografische Bezeichnungen
gemäß § 2 der Erhaltungsmischungsverordnung
- Ursprungsgebiet (synonym: Herkunftsregion ): ein Gebiet (von 22 in Deutschland), „in dessen Abgrenzung die zugehörigen Quellgebiete und Entnahmeorte liegen, das nach naturräumlichen Kriterien gegenüber anderen Gebieten abgrenzbar ist und in dem die Erhaltungsmischung in den Verkehr gebracht werden darf“
- Quellgebiete : entweder nach FFH-Richtlinie ausgewiesene Schutzgebiete oder zum Schutz pflanzengenetischer Ressourcen beitragende Gebiete, die vergleichbar geschützt sind; hierzu zählen nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope; um weitere in einzelnen Bundesländern ergänzt
- Entnahmeort: „der Teil eines in einem Ursprungsgebiet liegenden Quellgebietes, in dem a) eine direkt geerntete Mischung entnommen wird, b) Ausgangssaatgut für eine angebaute Mischung gesammelt wird“
- Produktionsraum: „das einem Ursprungsgebiet oder mehreren Ursprungsgebieten zugeordnete Gebiet, in dem sich die Vermehrungsflächen einer angebauten Mischung befinden, deren Entnahmeort in einem der diesem Produktionsraum zugeordneten Ursprungsgebiete liegt“. Deutschland ist in acht Produktionsräume gegliedert.
Die für eine Begrünung erforderliche Entnahme von Saatgut aus der Natur bedarf bei gewerblichem Handeln, wie es für die meisten Wildpflanzen-Vermehrungsbetriebe der Fall ist, einer Genehmigung nach § 39 Abs. 4 BNatSchG. Um die Verfügbarkeit von Saatgut zu fördern, betont § 39 Abs. 4 Satz 4: „Bei der Entscheidung über Entnahmen zu Zwecken der Produktion regionalen Saatguts sind die günstigen Auswirkungen auf die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.“
Um die Anwendung und Sicherung der naturschutzrechtlichen Vorgaben für die Praxis verbindlich zu strukturieren, wurde in § 54 Abs. 4 b BNatSchG das BMUV speziell bezüglich des Ausbringens von Gehölzen und Saatgut zu einer Verordnung ermächtigt, um
- die Vorkommensgebiete von Gehölzen und Saatgut zu bestimmen,
- einen Nachweis, dass Gehölze und Saatgut aus bestimmten Vorkommensgebieten stammen, vorzuschreiben und Anforderungen für einen solchen Nachweis festzulegen,
- Regelungen zu Mindeststandards für die Erfassung und Anerkennung von Erntebeständen gebietseigener Herkünfte zu treffen.
Die Erstellung dieser Verordnung ist vom BMUV bisher nicht vorgesehen. Stattdessen arbeitet das Bundesamt für Naturschutz an einem Leitfaden, der Regelungen für Begrünungen mit Wildpflanzen entwickelt. Dieser wird keine Rechtsverbindlichkeit erlangen, jedoch werden entsprechende Leitfäden durch den behördlichen Naturschutz häufig als verbindlich zu nutzende Grundlage für Entscheidungen und Vorgaben interpretiert. Somit können solche Schriften, wenn sie nicht alle Aspekte und Auswirkungen ihrer Empfehlungen berücksichtigen, weitreichende negative Auswirkungen haben. Eine genaue Abwägung und Bewertung verschiedener Auffassungen und Empfehlungen ist jedoch wichtig, um nicht noch länger dem gravierenden Artenrückgang sowohl bei Fauna als auch Flora trotz vorhandenem Wissen zu geeigneten Methoden weiterhin zuzuschauen.
Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, dass im Rahmen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2023 in den Ökoregelungen der 1. Säule für Blühstreifen und Blühflächen auf Ackerlandkein gebietseigenes Saatgut vorgesehen ist. Die Bundesländer können jedoch regionales Saatgut vorschreiben. Die GAP-Direktzahlungen-Verordnung des Bundes definiert zur Auswahl ein Artenset, aus dem die Länder bei Bedarf bestimmte Arten streichen dürfen, um besonderen regionalen agrarstrukturellen oder naturschutzfachlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen (§ 17 Abs. 5 sowie Anlage 5 GAPDZVO).
3 Genetische Grundlagen
Während Inzuchteffekte (Inbreeding Depression ) vielfach belegt sind, bestehen hinsichtlich möglicher Auskreuzungseffekte (Outbreeding Depression ) noch große Kenntnislücken (vergleiche Crispi & Hoiß 2021): Verpaaren sich genetisch weit entfernte Individuen einer Art, so kann dies zu negativen Folgen führen, wie einer verminderten Anpassungsfähigkeit an ihre Umwelt infolge einer Veränderung der für die Anpassung zuständigen Gene, etwa durch Aufbrechen koadaptierter Genkomplexe. Die Naturschutzpraxis sucht daher einen Mittelweg zwischen den Gefahren von Inzucht und Auskreuzung, eine „optimale Kreuzungsdistanz“ (Waser & Price 1989).
Ausmaß und regionale Differenzierung der innerartlichen genetischen Vielfalt innerhalb Deutschlands kann artspezifisch sehr unterschiedlich sein (etwa Durka et al. 2019): Der Vergleich von Vorkommen von sieben häufigen Arten in Glatthaferwiesen aus acht Ursprungsgebieten zeigte, dass bei allen Arten die Pflanzen aus den verschiedenen Regionen auch genetisch unterschiedlich sind. Die genetischen Unterschiede steigen tendenziell mit der Entfernung der Herkünfte oder mit zunehmenden klimatischen Unterschieden an. Durka et al. (2019) identifizierten für windbestäubte Arten deutschlandweit eine recht einheitliche Genetik; einige insektenbestäubte Arten wiesen bis zu acht unterschiedliche Genpools auf – mehr als acht waren versuchsbedingt nicht nachweisbar.
Von Resultaten wie diesen werden zum Teil sehr kleinräumige Regelungen für die Verwendung gebietseigener Wildpflanzen hergeleitet. Jedoch sollten die Ergebnisse und deren Gewichtung gegenüber Parametern wie Boden und Klima stärker hinterfragt werden. Dass gerade die windbestäubten Pflanzenarten eine einheitlichere Genetik aufweisen, kann wahrscheinlich auf einen noch deutlich stärker und großräumiger vorhandenen Genaustausch als für insektenbestäubte Arten zurückgeführt werden. In großen Teilen Deutschlands behindern Siedlungen, Straßen sowie durch Monokulturen und fehlende Strukturen geprägte Landwirtschaftsflächen Wanderungsbewegungen von Insekten und reduzieren damit erheblich einen genetischen Austausch auch für die daran gebundenen Pflanzenarten. Verstärkt werden diese Effekte durch einen fortschreitenden Ausfall von traditionellen Vektoren für Diasporen wie Wild- und Weidetiere (vergleiche Abschnitt 7.1) und lokalem Heu- und Getreidehandel. Hier stellt sich die Frage, inwieweit der Mensch diese Barrieren- und Isolationswirkungen durch zu kleinräumige Vorgaben hinsichtlich der Verwendung von gebietseigenen Herkünften noch weiter verstärken möchte oder im Sinne des Artenschutzes wirklich effektive und multifunktionale Maßnahmen unterstützt (vergleiche Abschnitt 7).
Eine zentrale Frage ist, welche Entfernungen zwischen Sammelort und Zielort der Ausbringung zulässig sind. Hierzu liegen allerdings nur wenige Arbeiten insbesondere über die kleinräumige genetische Differenzierung von Arten und deren Abhängigkeit von klimatischer und geografischer Distanz (Durka et al. 2019, Mix et al. 2006) vor.
Ein zusätzlicher Aspekt besteht in der Anpassungsfähigkeit von Arten in Abhängigkeit von der Populationsgröße . Dies hat eine Bedeutung für die Sammelstrategie zur Gewinnung von Ausgangssaatgut für Renaturierungen, mit dem Ziel, isolierte Vorkommen wieder zu verbinden, und für die Abschätzung, wie lokale Populationen auf eingebrachte Herkünfte „reagieren“ können. In einer Metastudie zeigten Leimu & Fischer (2008), dass lokale Anpassungen bei größeren Pflanzenpopulationen (> 1.000 blühende Individuen) viel häufiger vorkamen als bei kleinen (< 1.000 blühende Pflanzen), bei denen lokale Anpassung sehr selten war. Van Rossum et al. (2020) zeigten beispielsweise erfolgreiche Bereicherungs-Translokationen fürArnica montana , ohne dass die oft befürchteten Heterosis- oder Auskreuzungseffekte auftraten.
Einige Forschende vertreten nach Crispi & Hoiß (2021) die Auffassung, dass die Standortähnlichkeit sich kreuzender Individuen entscheidender für die genetische Kompatibilität von Populationen ist als die geografische Distanz. So diskutieren Smith et al. (2005) am Beispiel des Hornklees (Lotus corniculatus ), dass für den Etablierungserfolg die standörtliche Ähnlichkeit gegebenenfalls wichtiger sein könne als die geografische Nähe. Auch hier besteht großer Forschungsbedarf.
4 Tierökologische Relevanz
Von jeder Pflanzenart im Grünland hängen zahlreiche Insektenarten ab (vergleicheDatabase of Insects and their Food Plants unter www.brc.ac.uk/dbif/), die
- von Pollen und Nektar leben – wie Wildbienen, Wespen, Schwebfliegen und Schmetterlinge,
- ektophytisch an Blättern, Stängeln oder Wurzeln fressen – wie Schmetterlingslarven und Käfer,
- Pflanzensaft saugen – wie Wanzen und Pflanzenläuse,
- endophytisch in Blättern, Früchten, Samen, Blütenköpfen oder Gallen leben – wie Blattminierer, Gallmücken oder Gallwespen.
Gleichzeitig bieten Pflanzen Raumstrukturen, die zum Beispiel für das Anheften von Eiern oder die Konstruktion von Fangnetzen (bei vielen Webspinnen) erforderlich sind. Dabei sind etwa 80 % aller herbivoren Insekten Spezialisten und fressen nur bestimmte Wirtspflanzen, im Extremfall bei monophagen Arten nur eine bestimmte Pflanzenart oder Gattung, wie etwa 56 % der Edelfalterarten und 76 % der Blattlausarten (Schoonhoven et al. 2005). Entsprechend gibt es in Mitteleuropa beispielsweise 19 Insektenarten, die ausschließlich am Rainfarn (Tanacetum vulgare )leben (Schmitz 1998), und 24 Arten, die sehr eng mit der Brennnessel (Urtica dioica ) assoziiert sind (Davis 1989). Die Datenbank der herbivoren Insekten in Europa (https://bladmineerders.nl/) führt zum Beispiel für die Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea ) 99 Insektenarten auf. Werden Parasitoide und Parasiten einbezogen, liegt die Artenzahl der von einer Pflanzenart abhängigen Insekten nochmals deutlich höher, da je nach Ordnung jede herbivore Insektenart als Wirt für zwei bis neun Parasitoidenarten dient (Hawkins & Lawton 1987).
Herbivore Insekten und ihre Parasitoide machen den Großteil der Insektenarten in Mitteleuropa aus (Klausnitzer 2005). Dennoch nehmen Wildbienen aufgrund ihrer wichtigen Funktion als Bestäuber von Nutz- und Wildpflanzen (Kratochwil 2003) eine Schlüsselrolle ein. Sie ernähren sich ausschließlich von Blütenprodukten und haben im Laufe der über 80 Mio. Jahre dauernden Koevolution mit Blütenpflanzen spezielle Anpassungen entwickelt. Nach Westrich (2018) sind 137 der 428 nestbauenden Wildbienenarten Deutschlands (32 %) oligolektisch, das heißt, ihre Weibchen sammeln im gesamten Verbreitungsgebiet auch bei Vorhandensein anderer Pollenquellen ausschließlich Pollen einer Pflanzenart oder nah verwandter Pflanzenarten. Fehlen diese Pflanzenarten, so kommen auch die jeweiligen Bienenarten nicht vor (Westrich 2018). Westrich weist darauf hin, dass oligolektische Wildbienen für bestimmte Pflanzenarten eine höhere Bestäubungswirksamkeit haben als nicht spezialisierte Blütenbesucher und dass gerade Populationen gefährdeter beziehungsweise seltener Pflanzenarten „in Naturschutzgebieten nur dann gesichert sind, wenn langfristig auch der Erhaltung der Wildbienen-Nistplätze Rechnung getragen wird“. Aber auch polylektische Bienenarten nutzen zumeist ein kleines Spektrum an Nahrungspflanzen und nur wenige Generalisten wie etwa die Honigbiene (Apis mellifera ) stellen geringe Ansprüche an das Blütenangebot. Häufig sind es die seltenen Pflanzenarten, die zum Erhalt vieler Insektenarten wichtig sind. Eine enge Bindung an seltene Pflanzenarten ist zum Beispiel für eine Reihe von Zikaden (Achtziger et al. 2014), Schwebfliegen (Popov et al. 2017), Bohr- und Minierfliegen sowie oligophage Tag- und Nachtfalterarten bekannt.
Es besteht dringender Handlungsbedarf, um den besorgniserregenden Rückgang der Mehrzahl der Insektenarten (Fartmann et al. 2021) einschließlich der Wildbienen (Schwenninger & Scheuchl 2016) und damit den Verlust ihrer vielfältigen Funktionen in Ökosystemen zu stoppen. Eine geringe Anzahl an Pflanzenarten in der Ansaatmischung kann dazu führen, dass besonders spezialisierte Insekten von Generalisten verdrängt werden, da beide dieselben Ressourcen nutzen müssen (Thomson & Page 2020, zur Konkurrenz zwischen Roter Mauerbiene [Osmia bicornis ]und Honigbiene vergleiche Hudewenz & Klein 2015).Zu berücksichtigen ist auch, dass arten- und strukturreiche Vegetationsbestände Lebensgrundlage für zahlreiche weitere Tiergruppen sind. Viele Vogelarten und auch Kleinsäuger sind zumindest während der Jungenaufzucht auf insektenreiche Nahrungshabitate angewiesen. Auch die Samen verschiedenster Pflanzenarten sind wichtige Nahrungsquellen für Vögel und Kleinsäuger.
5 Klimawandel
Arten sind an bestimmte Kombinationen von Umwelt- und Klimabedingungen angepasst, die es ihnen ermöglichen, zu wachsen, zu gedeihen und sich zu vermehren. Wenn der Klimawandel den geeigneten Lebensraum reduziert, die potenziellen Arealgrenzen immer weiter nach Norden oder in höhere Lagen verschoben werden (Metzing & Gerlach 2008) sowie die Austrocknung von Biotopen im Zuge globaler Aridifizierung zunimmt (Shi et al. 2020), sterben Arten lokal aus, sofern sie es nicht schaffen, sich an die neuen Bedingungen zu adaptieren oder in geeignete Gebiete zu migrieren. Auch zur Klimaanpassung könnten kleine Populationen am Arealrand interessant sein, wenn in deren Genpool spezielle Anpassungsstrategien bereits angelegt sind.
Aufgrund der starken Fragmentierung der Landschaft, des fehlenden Biotopverbunds, der oftmals anthropogenen Verbreitungslücken und häufig nur noch kleinen Populationsgrößen entsprechender Arten ist das natürliche Ausbreitungspotenzial im Vergleich zum schnell voranschreitenden Klimawandel und den sich dadurch verändernden Standortbedingungen jedoch relativ gering. Hier müssen künftig Rahmenbedingungen bestehen, die ausreichende Handlungsspielräume für die Verwendung gebietseigener Wildpflanzen ermöglichen (vergleiche Abschnitt 7).
Während für Anpassungsprozesse eine ausreichend hohe Allel-Variabilität erforderlich ist (Leimu & Fischer 2008), die durch die Einbringung zusätzlicher genetischer Informationen verbessert werden kann (Reed & Frankham 2003), benötigen Wanderbewegungen vor allem Zeit. Eine Untersuchung am Hasenglöckchen (Hyacinthus non-scripta ) hat gezeigt, dass die durchschnittliche Wanderungsrate nur 0,02 bis maximal 1 m pro Jahr beträgt (Sanczuk et al. 2022). Dies ist im unteren Bereich mehr als 1.000-fach niedriger als die Geschwindigkeit des Klimawandels, denn die Isothermen in Laub- und Mischwäldern der gemäßigten Zonen verschieben sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 350 m pro Jahr (Loarie et al. 2009). Vor allem in den stark fragmentierten Landschaften Westeuropas machen derart niedrige Wanderungsraten Arealverschiebungen, die schnell genug sind, um dem Klimawandel zu folgen, praktisch unmöglich.
6 Praktische Anwendung
In der bisherigen Praxis des Einsatzes von gebietseigenem Saatgut haben sich zwei Hauptproduktionsverfahren etabliert. Zum einen werden Wildherkünfte mehrerer Standorte eines Ursprungsgebiets gesammelt und garten- oder ackerbaulich als Einzelarten vermehrt. Daraus werden – soweit möglich – standortangepasste Mischungen zusammengestellt. Zum anderen werden Direkternteverfahren eingesetzt, meist Wiesendrusch oder Bürstverfahren. Direkternteverfahren stellen naturschutzfachlich einen höheren Standard dar, da sie lokale Artenspektren bei guter Verfahrenstechnik besser abbilden können. Sie können in Einzelfällen mit manuell gesammelten Samen von besonders zu fördernden Arten ergänzt werden. Diese standörtlich angepassten und zum Teil durch mehrfache Erntetermine aufwändigen Verfahren sind regelmäßig nur noch in den verbliebenen Extensivlandschaften praktikabel.
Sofern solche Verfahren nicht zur Verfügung stehen (zum Beispiel in ausgeräumten Landschaften), sind artenreiche angebaute Mischungen die Alternative. Der weit überwiegende Begrünungsteil stammt aus angebauten Mischungen (2021 in Deutschland circa 500 t; mdl. Mitt. VWW 2022). Der Bedarf an Wildpflanzensaatgut dürfte aktuell bei circa 2.000–3.000 t liegen (mdl. Mitt. VWW 2022). Die Ansaat gebieteigener Herkünfte wird unabhängig von der gesetzlichen Regelung im besiedelten Raum auch bei der Anlage von biodiversitätsfördernden Gärten und Grünanlagen zunehmend nachgefragt.
Weitere Verfahren wie Mähgutübertragung oder Staudenpflanzungen decken aufgrund des hohen logistischen Aufwands nur einen sehr kleinen Prozentsatz in Begrünungsprojekten ab.
Um Regionalität und naturschutzgesetzliche Konformität bei den Saatguttransfers zu bewahren, wurden für Deutschland 22 Ursprungsgebiete definiert (Prasse et al. 2010). Seither orientiert sich der gesamte Saatgutmarkt für Gräser und Kräuter an diesen 22 Ursprungsgebieten. Um den pauschalen Einsatz von Saatgutmischungen in einem Ursprungsgebiet zu erleichtern, wurde einArtenfilter entwickelt. Dieser wird allerdings nur fallweise angewendet, da er keine Rechtsgrundlage besitzt und inhaltlich aus naturschutzfachlicher Sicht stark überarbeitungsbedürftig ist.
Die Möglichkeit zur Ausbringung von zertifiziertem Saatgut ohne Genehmigungsverfahren ist eine zentrale Voraussetzung, um Ansaaten in laufenden Projekten zeitnah umsetzen zu können. Seit März 2020 wird aber von vielen Verwaltungsstellen eine vorsorgliche Beschränkung in der Artenverwendung eingeführt, um Kriterien des § 40 BNatSchG nicht zu verletzen. Dabei werden zunehmend die Vorgaben des Artenfilters übernommen, obwohl es hierzu bereits seit Längerem eine äußerst kontroverse Diskussion gibt (Wieden & Mainz 2020). Außerdem sind immer weniger Länder bereit, Ausnahmen bei der Verwendung von Ersatzherkünften aus Nachbarregionen zu erlauben (Ausnahme zum Beispiel Hessen, Erlass vom 25.08.2020).
Die genannten Einschränkungen führen in vielen Projekten zum Verzicht auf Ansaaten oder zur Verwendung von artenärmeren Mischungen, sodass das große Potenzial der naturnahen Begrünung mit Wildpflanzen bei Weitem nicht ausgeschöpft wird, obwohl die konsequente und schnelle Umsetzung solcher hochwertiger Maßnahmen ein zentraler Weg aus dem aktuellen Artensterben in Tier- und Pflanzenwelt ist. Allein der Verweis auf eine erforderliche Ausnahmegenehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde stellt für viele Vorhaben eine unkalkulierbare Verzögerung dar und führt zu deutlichen Qualitätseinbußen. Die Verwendung von Arten außerhalb des Artenfilters wird zunehmend schwieriger.
7 Diskussion und Lösungen
7.1 Abgrenzung und Anwendung der Ursprungsgebiete
Aufgrund der erheblichen Kenntnislücken zu lokal differenzierter genetischer Vielfalt von Arten und den damit verbundenen unbekannten geografischen Verbreitungsmustern sowie der fehlenden Berücksichtigung von historischen Ausbreitungswegen müssen die von der LANA als Interpretation des § 40 BNatSchG übernommenen Ursprungsgebiete als für die Fragestellung ungesicherte Raumkonstruktion angesehen werden. Zudem ist fachlich schwer begründbar, dass die artspezifischen Vorkommensgebiete ohne Berücksichtigung der jeweiligen Ausbreitungsstrategien und ohne Beachtung von Vektoren in der historischen Kulturlandschaft und früheren Naturlandschaft (Vera 2002) den Dimensionen der Ursprungsgebiete gleichgesetzt werden. Zudem erschwert im Gegensatz zu früher heute die fehlende Durchlässigkeit der Landschaft die zoochore Ausbreitung. Arten mit Anpassungen an Wind- oder Vogelausbreitung können dagegen noch immer auch größere Entfernungen überbrücken, was sich beispielsweise bei der Analyse der Besiedlung von Tagebauflächen zeigte (Kirmer et al. 2008).
Auch die Untersuchung von Durka et al. (2019) kann nicht als Beleg für die strenge Handhabung der Abgrenzung der 22 Ursprungsgebiete herangezogen werden, da das Untersuchungsdesign nur die Ebene der acht Produktionsräume berücksichtigt. Für die Ursprungsgebiete liegen keine tragfähigen Kenntnisse vor. Für die allein etwa 400 marktrelevanten Arten, die sich in Produktion befinden, ist dies auch mittelfristig nicht zu klären. Nach den bisherigen Kenntnissen ist die räumliche Gliederung für Arten mit großer genetischer Differenzierung möglicherweise zu grob, für andere zu kleinteilig (dazu Aavik et al. 2012, Kaulfuß & Reisch 2019). Aber auch diese Aussage ist zu prüfen, da die Wirkung der Barriere- und Isolationseffekte nicht ausreichend geklärt ist. Die räumliche Gliederung von 22 Ursprungsgebieten pauschal für alle Kraut- und Grasarten ist somit eine pragmatische, aber in Anbetracht dieser Kenntnisdefizite unzureichend abgesicherte Kompromisslösung.
Wesentliche neue Daten wird das bis 2023 laufende Projekt RegioDiv am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle liefern. Für 28 Pflanzenarten werden „genetische Karten“ entwickelt, die beantworten helfen, ob die Herkunftsgebiete passend abgegrenzt sind und es ein geeigneter Kompromiss ist, alle Pflanzenarten mit demselben System an Herkunftsgebieten zu „bewirtschaften“ (Durka et al. 2020). Diese Daten sollten bei der Erarbeitung des beim BfN in Vorbereitung befindlichen Leitfadens berücksichtigt werden, um zu verhindern, dass mit dem Leitfaden ein Regelwerk fixiert wird, das den Artenschutz unter den zuvor genannten Aspekten sogar behindert, anstatt ihn gezielt voranzubringen.
Das sich ausweitende Nichtzulassen von Ersatzherkünften aus Nachbarursprungsgebieten erzeugt einen analogen Trend im Saatgutangebot. Gerade die im Aufbau befindlichen Betriebe, die zudem oft in den aktuell noch unterversorgten Regionen liegen, können dadurch weniger Mischungen mit einem großen Artenspektrum anbieten, da sie Arten aus dem benachbarten Ursprungsgebiet nicht hinzufügen dürfen. Jedoch werden gerade solche multifunktionalen Mischungen im Bereich des Artenschutzes benötigt. Auch vor diesem Hintergrund ist zu hinterfragen, ob die Ursprungsgebietsgrenzen so kategorisch angewendet werden müssen, dass dadurch Betriebe ihre Produktion einstellen und das Angebot wieder zurückgeht.
Für das Ziel der Renaturierung artenreicher Vegetation, die auch regional spezifische Arten enthält, benötigt die Praxis eine erleichterte Vorgehensweise für den Ersatz nicht verfügbaren Saatguts aus Nachbarregionen ohne Genehmigungserfordernis:
- Zumindest übergangsweise sollten – definitionsgebunden – in schlechter versorgten Regionen bei Nichtverfügbarkeit im Ursprungsgebiet benachbarte Ursprungsgebiete herangezogen werden dürfen.
- Um das Konzept der Regionen nicht aufzuweichen, könnten Obergrenzen für den Anteil an Arten aus anderen Ursprungsgebieten in der Mischung eingeführt werden, gegebenenfalls stufenweise differenziert nach Versorgungsgrad der Region. Zur Einstufung könnten regelmäßig Anbaustatistiken des Bundessortenamtes herangezogen werden.
- Die Flexibilität der Ursprungsgebietsgrenzen könnte artspezifisch insbesondere anhand der Verbreitungsbiologie differenziert werden: Voraussichtlich unproblematisch sollte die Freigabe bei windbestäubten und bei großräumig zoochor verbreiteten Arten sein, während Arten mit bekannter starker genetischer Differenzierung gegebenenfalls mit einerBlacklist von der generellen Freigabe auszuschließen sind. Eine solche Liste sollte von Experten erarbeitet werden (etwa der Gesellschaft zur Erforschung der Flora Deutschlands), die auch schwierige Sippen beurteilen, beispielsweise Apomikten, die aktuell in halbnatürlicher Sippenbildung begriffen sind.
Auch die klimatischen Veränderungen raten eine maßvoll flexible Handhabung von Regionengrenzen an, um die Etablierung artenreicher Bestände bei fortschreitender Veränderung von Standorten sicherzustellen. Gewisse Funktionseinschränkungen können durch nicht angepasste Blühzeitpunkte entstehen. Viele an ihr regionales Klima angepasste Arten behalten in anderen Regionen ihre Phänologie bei (Crispi & Hoiß 2021) – sodass sie möglicherweise am neuen Standort gegenüber Bestäubern und herbivoren Arten desynchronisiert sind. Dem entgegen stehen einerseits mögliche Anpassungen an den neuen Standort im Laufe der Zeit und andererseits die hohe Varianz der Blühzeitpunkte innerhalb einer Population: Mit Ausnahme einiger Frühjahrsgeophyten erstreckt sich der Blühbeginn bei fast allen mitteleuropäischen krautigen Pflanzenarten, insbesondere bei Weidenutzung, immer über mehrere Wochen (Nowak & Schulz 2000) und bietet so auch die Chance einer raschen lokalen Adaption bei neu angelegten Biotopen.
Auch wenn sich die Diskussion hier im spekulativen Bereich bewegt, ist nach unserer Meinung ohne Maßnahmen das Risiko des lokalen Aussterbens angesichts des raschen und drastischen Schrumpfens von Areal und Häufigkeit zahlreicher Gefäßpflanzenarten in der Kulturlandschaft (etwa Wiesen-GlockenblumeCampanula patula , Kleines MädesüßFilipendula vulgaris ) erheblich größer als die Gefahr, dass sich den Artenbestand bereichernde Translokationen durch Ansaat negativ auswirken. Die Erhaltung der Arten (Pflanzenarten und die von ihnen direkt und indirekt abhängigen Tier- und Pilzarten sowie zugehörige Mikrobiome) sollte daher gegenüber dem unsicheren Risiko einer möglichen Veränderung genetischer Informationen durch Ansaaten klar Vorrang haben.
7.2 Artenauswahl zur Ansaat bei Renaturierungen
Die Auswahl von Arten für die Neuanlage von artenreichem Grünland und Säumen wird noch viel zu häufig ausschließlich unter Gesichtspunkten des botanischen Artenschutzes durchgeführt. Dies erscheint vor dem Hintergrund der Kenntnisse aus der Biozönologie (Kratochwil & Schwabe 2001) mit zahlreichen Tier-Pflanze-Interaktionen als zu einseitig. Spezifisch wirksame Bestäuber ermöglichen oder verbessern die erfolgreiche Reproduktion von Pflanzenarten. Ohne einen wirksamen Biotopverbund, das heißt die Wiederansiedlung der Wirts- und Nahrungspflanzenarten im Umfeld, lässt sich die Überlebensfähigkeit ihrer Populationen nicht erhöhen (Metapopulationskonzept).
Damit sich die insektenblütigen Pflanzenarten nachhaltig etablieren können, ist eine differenzierte Auswahl insbesondere der Hauptbestäuber, also der regional noch vorkommenden und der dort ursprünglich verbreiteten Wildbienenarten vorzunehmen. Gleichzeitig sind aber auch die Nahrungsansprüche der vielen herbivoren Insektenarten zu beachten, die den überwiegenden Anteil der Insektenarten in Mitteleuropa ausmachen.
Die Gesichtspunkte des botanischen Artenschutzes werden im Artenfilter nach Prasse et al. (2010) gebündelt. Anhand von zehn Ausschlusskriterien werden für jedes Ursprungsgebiet Arten zugelassen oder ausgeschlossen. Da die Herangehensweise des derzeitigen Artenfilters den aktuellen Bedürfnissen des faunistischen, aber aus unserer Sicht auch botanischen Artenschutzes nicht genügt, sind im Folgenden Hinweise zu einzelnen erörterten Kriterien des Artenfilters aufgeführt:
- 60 % Messtischblattquadranten-Frequenz: Das vermutlich schwerwiegendste Kriterium im Artenfilter verlangt den Nachweis einer Pflanzenart in mindestens 60 % der Messtischblattquadranten (MTB) und führt gerade bei weniger häufigen bis seltenen Arten und den an sie gebundenen Nahrungsnetzen zum Ausschluss. Die 60%-Regel wird der Verschiedenartigkeit der Verbreitungsbilder von Einzelarten nicht gerecht. Oft ist weder die aktuell und noch weniger die historisch besiedelte Fläche ausreichend bekannt, insbesondere in anthropogen ausgedünnten Populationen. Ebenso werden Arten ausgeschlossen, die schon aufgrund ihrer Ökologie einen Anteil von 60 % besiedelter MTB-Quadranten nie überschreiten würden, die jedoch wichtige Bestandsbildner dringend zu entwickelnder und aufzuwertender Vegetationsbestände sind, etwa Arten der Brenndoldenauenwiesen und Pfeifengraswiesen als FFH-Lebensraumtypen. Der Artenfilter konserviert die durch den Menschen hervorgerufene Fragmentierung der Vorkommen besonders bei früher mittelhäufigen Pflanzenarten (Bruelheide et al. 2020, Jansen et al. 2019), reduziert so die Zahl der verwendbaren Arten und fördert selektiv weniger gefährdete Ubiquisten, während der Druck auf seltenere (gegebenenfalls konkurrenzschwache) Arten erhöht wird. Die 60%-Grenze sollte daher deutlich herabgesetzt oder ganz gestrichen werden. Aus gesamtökologischer Sicht ist die Feststellung geeignet, dass die Art im betreffenden Ursprungsgebiet in ihrem Areal vorkommt oder vorschlagsweise in den letzten 200 Jahren vorkam (ohne Häufigkeitsangabe).
- Ein weiteres eng mit der Rasterfeldfrequenz verbundenes Kriterium ist das Vorliegen einer Arealgrenze in einer Herkunftsregion. Aktuelle Verbreitungsbilder von Pflanzenarten sind häufig anthropogen oder edaphisch bedingt, das heißt, auch eine Verbreitung außerhalb aktueller Vorkommensgebiete hätte zumindest regional keine negativen Folgen. Gerade Grün- und Offenlandstandorte sind seit der neolithischen Revolution immer stark anthropogen bestimmt gewesen und oft recht jungen Datums. Zudem verändern sich Arealgrenzen aufgrund des Klimawandels. In der historischen Kulturlandschaft kam es durch Transhumanz zu einem großräumigen Austausch zwischen Regionen und Populationen (etwa Bonn & Poschlod 1998, Luick 2008, Poschlod & Wallis De Vries 2002). Die historische raum-zeitliche Dynamik (vergleiche Jedicke 2015) bleibt in der naturschutzfachlichen Debatte weitgehend und in der Diskussion um die Umsetzung des § 40 vollständig ausgeblendet. Auch fehlen im Artenfilter jegliche Hinweise zur Methode der Definition von Arealgrenzen. Verbreitungskarten der Pflanzenarten bieten erst mit den landesweiten floristischen Erhebungen seit etwa 1980 ein bundesweit vergleichbares Bild. Die Zeitspanne mit ansteigender Datendichte liegt in der Phase, in der die vielfältigen anthropogenen Einflüsse das Areal der meisten Arten bereits tiefgreifend verändert haben. Entsprechend sollten nicht allein die Ist-Situation, sondern tatsächlich auch potenziell-historische Verbreitungsgebiete der letzten 200 Jahre betrachtet werden; ein allmählicherbaseline shift durch anthropogen ausgelöste Rückgänge und Fragmentierung der Vorkommen ist zu vermeiden. Mindestens sollte das Kriterium Arealgrenzen mit entsprechenden Spielräumen ausgestattet werden.
- Das Kriterium Rote-Liste-Status sollte kritisch hinterfragt werden. Der pauschale Ausschluss aller Pflanzenarten mit Rote-Liste-Status 1, 2, 3 und R hat automatisch den Ausschluss vieler auf diese Pflanzenarten spezialisierten Insekten zur Folge. Weiter ist das Paradoxon zu betrachten, dass gerade Populationen von Arten mit hoher Relevanz für die jeweiligen Lebensräume (etwa FFH-LRT) und oft mit besonders geringer Verbreitung oder mit herausragend starkem Rückgang am wenigsten durch Ansiedlungsprojekte gestützt werden können. Lediglich die Kategorien 1 (vom Aussterben bedroht) und gegebenenfalls R (Arten mit geografischer Restriktion) sollten pauschal ausgeschlossen werden und stattdessen Gegenstand spezifischer Artenhilfsprogramme sein.
- Einzelne Arten sollten als Arbeitshilfe für die Behörden über den Artenfilter hinaus zugelassen werden können, entsprechende Auswahlmechanismen sind zu beschreiben. Sollte der Artenfilter beibehalten werden, müsste er regelmäßig aktualisiert werden (Rote Listen, Areale, Taxonomie).
- Als Alternative zum Artenfilter könnte auf Basis bundesweit einheitlicher Kriterien ein interdisziplinär zusammengesetztes Gremium je Ursprungsgebiet eine spezifische Artenliste ( Positiv- oder Empfehlungsliste ) für ein breites Anwendungsspektrum insbesondere im Bereich der Biodiversitätsförderung erarbeiten, möglichst über die Grenzen der Bundesländer hinweg. Zwingend notwendig ist es, bei den Artenlisten das Kriterium zu fördernder Tierarten zu ergänzen, insbesondere von Bestäubern und Herbivoren (vergleiche Abschnitt 4). Die Freigabe für eine möglichst große Pflanzenartenzahl als Basis für ein breites Spektrum profitierender Tierarten sollte hierbei das übergeordnete Biodiversitätsziel sein, da artenreiche Grünland- und Saumbiotope resilienter sind und sich durch ein höheres Maß an Ökosystemleistungen auszeichnen, wie das Jena-Experiment zeigt (Barnes et al. 2020). Ein geeignetes neues Kriterium wäre auch die Geschwindigkeit des Artenrückgangs, denn die besonders stark zurückgegangenen Arten müssen künftig vermehrt gefördert werden, um überhaupt eine Trendumkehr beim Artensterben herbeizuführen. Hier ergibt sich eine umgekehrte Funktion gegenüber den bisher geltenden Ausschlüssen von Arten der Roten Listen. Dennoch sollten im Umkehrschluss nicht alle Arten überall ausgebracht werden. Das Beachten standörtlicher Gegebenheiten ist essenziell und der Schutz von Ökotypen mit speziellen Anpassungen ist auch vor dem Hintergrund des Klimawandels wichtig.
7.3 Anpassung der Rechtsgrundlage, Schaffung einer Übergangslösung
Vor dem Hintergrund des umfassenden Anspruchs der Konvention über die biologische Vielfalt ist es konsequent und richtig, Erhaltung und Entwicklung der genetischen Vielfalt weit mehr als bisher in den Fokus zu nehmen. In der praktischen Anwendung des § 40 BNatSchG sind aber die unbestimmten gesetzlichen Ausführungen (Population, Teilpopulation, Vorkommensgebiet) nicht ohne Konkretisierung umsetzbar. Naturschutz ist auf rasche und durchgreifende Erfolge angewiesen, sodass hier die Frage nach effizienten Entscheidungen für einen hohen Umsetzungsgrad in der Praxis im Vordergrund stehen sollte.
Zudem sollten Ausnahmegenehmigungen für Ansaaten nur in seltenen Fällen auf die Naturschutzbehörden verlagert werden. Die Beweisführungslast, dass beim Einsatz von Ersatzherkünften eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen, Arten oder lokalen Populationen am Zielstandort ausgeschlossen ist, können die Antragstellenden nicht erfüllen. Im Ergebnis verringert dies das potenziell einsetzbare Artenspektrum und werden viele Ansaatvorhaben gar nicht durchgeführt, denn die meisten Naturschutzbehörden sind personell nicht ausreichend ausgestattet.
Konkret empfehlen die Autorinnen und Autoren folgende Maßgaben:
- § 40 muss die faunistischen Belange gleichberechtigt mit den bisher engen floristischen Vorgaben berücksichtigen und zu einem umfassenden Instrument für eine ganzheitliche Renaturierung von Biozönosen, Biotopen und Ökosystemen weiterentwickelt werden, welches das gesamte Methodenspektrum inklusive etwa der Mahdgutausbringung darstellt.
- Weiter muss § 40 die Erhaltung stark zurückgehender Arten gegenüber dem Schutz ihrer in der Regel unbekannten genetischen Diversität höher priorisieren. Wegen des massiven und mittels tradierter Methoden des botanischen Artenschutzes quantitativ nicht aufhaltbaren Artenrückgangs erfordert dies für zahlreiche deutlich rückläufige Arten die Ermöglichung der Ausbringung von gebietseigenem Saatgut.
- Für eine fundiert begründete Umsetzung des § 40 mangelt es an essenziellem Wissen. Einen Baustein hierzu liefert das BfN-geförderte Projekt RegioDiv, dessen Ergebnisse für weitere Entscheidungen abgewartet werden sollten.
- Zeitnah zu schaffende Übergangslösungen mit regionalem Bezug auf Landesebene (Verordnung, Erlass) sind ein probates Mittel, damit die Länder freier agieren können (vergleiche Hessen). Die großen Interpretationsspielräume der Begriffe im § 40 erlauben den Ländern eine abgestimmte Vorgehensweise zur praktikablen Gestaltung von Neuanlagen bei Naturschutzmaßnahmen. Eine möglichst bundesweite Abstimmung wäre für die Praxis des Saatguthandels von großer Bedeutung (Ursprungsgebiete sind länderübergreifend!).
- Die Wirkungsweise des empfehlenden Charakters des Leitfadens wird unterschätzt. Bereits heute nutzen erste Behörden den Entwurf (!) des BfN-Leitfadens als Argumentationsgrundlage. Aufgrund der Tragweite der Rahmensetzung sollten die Vorgaben des § 40 bis 2030 durch eine Übergangsregelung im § 74 des BNatSchG vereinfacht erläutert werden, zum Beispiel der Umgang mit Ursprungsgebietsgrenzen. Dies lässt sich auf Antrag der Bundesländer im Bundesrat vergleichsweise rasch umsetzen.
7.4 Förderung der Produktion
Seit 2020 ist geschätzt eine Vervierfachung der Nachfrage nach gebietseigenem Saatgut zu konstatieren (mdl. Mitt. VWW 2022). Spenderflächen können diesen Umfang nicht leisten, sodass die Saatgutvermehrung unverzichtbar ist. Zudem führen beide Methoden zu unterschiedlichen Etablierungsergebnissen. Je nach naturräumlicher Ausstattung kann eines der Verfahren geeigneter oder auch eine Kombination beider sinnvoll sein.
Saatgut wird in privatwirtschaftlich geführten Betrieben erzeugt, die dringend eine Entwicklungsperspektive und Klarheit über die Marktstruktur benötigen: Welche Arten über den aktuellen engen Artenfilter hinaus können künftig in welchem Raum vermarktet werden? Einschränkungen und Auflagen dürfen einen noch ökonomisch praxistauglichen Umfang nicht überschreiten. Zudem müssen die Betriebe Anreize erhalten, im Sinne der Biodiversitätserhaltung und der Förderung vielfältig strukturierter und multifunktionaler Ansaatflächen auch Saatgut von schwerer anbaubaren und von in betreffenden Ursprungsgebieten stärker förderungsbedürftigen Arten zu vermehren. Die Vermehrungsbetriebe erfüllen eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe und bedürfen entsprechend einer Unterstützung durch die öffentliche Hand.
7.5 Offene Forschungsfragen
Der Beitrag verdeutlicht zahlreiche offene Forschungsfragen, die in den kommenden Jahren insbesondere durch das Bundesumweltministerium und andere öffentliche Stellen über Projektförderungen bearbeitet werden müssen. Hierzu zählen unter anderem die räumliche genetische Differenzierung besonders von Grünlandarten innerhalb Deutschlands, ökosystemare Risiken durch Wegfall einzelner Pflanzenarten, Risiken aufgrund des Einbringens von Populationsmaterial aus Nachbarregionen mit genetischer Differenzierung, Gefahren einer Entkopplung der Synchronizität zwischen Lebenszyklen von Tier- und Pflanzenarten durch Klimawandel oder Translokation sowie Beständigkeit von Renaturierungen unter den Bedingungen des Klimawandels.
In Anerkennung der seit Jahrzehnten verheerenden Entwicklung der Biodiversität des Offenlandes in Deutschland liegt ein vordringlicher Bedarf bei der quantitativen Abschätzung von Rückgangsgeschwindigkeiten der einzelnen Arten und den zu deren Kompensation erforderlichen Reetablierungsgeschwindigkeiten von Populationen.
7.6 Integrative Naturschutzstrategien
Saatgutausbringung gebietseigener Wildpflanzen im Rahmen naturschutzfachlich fundierter Renaturierungen und Begrünungen ist keine Ansalbung oder Florenverfälschung, sondern ersetzt ansatzweise Effekte ehemaliger anthropozoogener Transhumanz. Sie ist notwendig, da insbesondere zahlreiche Arten magerer Grünland- und Saumbiotope auf Sameneintrag angewiesen sind und durch dessen Fehlen sukzessive ausfallen können. Der genetische Austausch zwischen Populationen ist das zentrale Ziel des Biotopverbunds, der in Baden-Württemberg mittlerweile auch gesetzlich vorgegeben ist und das Aussterben von Populationen durch Inzucht verhindern soll. Allerdings ist ein lückenloser Biotopverbund auch mittelfristig nicht wieder im historischen Maße etablierbar. Daher ist heute der Mensch als Vektor zur Verbreitung von Diasporen gefordert, wo physisch keine Verbindungen (mehr) gegeben sind. Auch dies macht das Instrument der Samenausbringung von Wildpflanzen unverzichtbar.
7.7 Offene interdisziplinäre Zieldiskussion
Es fehlt als notwendiger Hintergrund der Debatte eine offene Zieldiskussion, welches Schutzgut (Schutzziel) höher wiegt: die Erhaltung größtmöglicher biozönotischer Artenvielfalt – oder die genetische Konservierung lokaler Pflanzenpopulationen mit der Konsequenz, dass aus Vorsorgegründen in vielen Fällen keine oder nur artenarme Biotopneuanlagen erfolgen. Die Entscheidung muss anhand zu definierender Kriterien nachvollziehbar abgewogen und grundsätzlich getroffen werden und benötigt hierfür auch einen neuen gesetzlichen Rahmen. Sie kann kaum praktikabel auf die verschiedenen Behördenebenen im Zuge von Einzelfallentscheidungen mit der Beweislast der Antragstellenden für die ökologische Unbedenklichkeit delegiert werden.
Lebensräume sind primär floristisch definiert, was aber die durch das BNatSchG bestimmten Ziele des Naturschutzes nicht ausreichend abbildet (Kunz & Borsig 2021). § 40 muss so gewichtet werden, dass er kein Risiko für die Erhaltung der Biodiversität als Ganzes entfaltet. Dies gilt umso mehr, da die Anpassung an die Folgen des Klimawandels mehr genetische Flexibilität erfordert, um resiliente Bestände zu entwickeln, und die Verwendung artenreicher Mischungen zudem Etablierungsrisiken minimiert. Auch die FFH-Richtlinie definiert zwar die in Anhang I gelisteten und zu schützenden Lebensräume auf floristischer Grundlage, doch zählt für den „günstigen Erhaltungszustand“, den zu erreichen das Ziel der Richtlinie darstellt, die Gemeinschaft der charakteristischen Tierarten untrennbar dazu (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, Artikel 1 e).
Als Lösungsansätze appellieren die Autorinnen und Autoren an das Bundesamt für Naturschutz, die aufgeführten Anregungen in der Vorbereitung des neuen Leitfadens aufzugreifen und das bisher floristisch definierte Verfahren angesichts der erheblichen Folgewirkungen für den Naturschutz sinnvoll auf einen gesamtökologischen Ansatz zu erweitern .
Den vollständigen Artikel finden Sie im PDF.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen














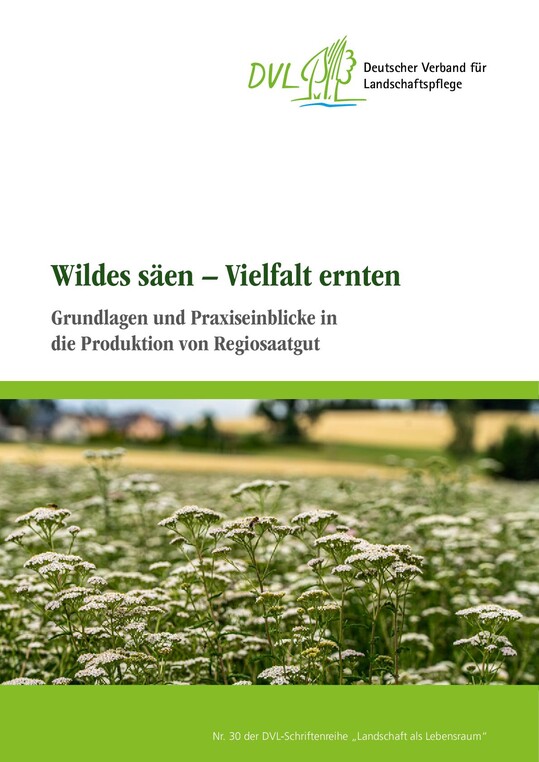
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.