Neue Glatthaferwiesen für Höxter
- Veröffentlicht am

Es ist Ende April, der Frühling hält endlich Einzug im Kreis Höxter. Die Schlehen stehen in voller Blüte, die Feldlerchen balzen und auf den Wiesen des Weserberglandes zeigt sich frisches Grün. Mit Winfried Türk bin ich etwas außerhalb des kleinen Ortes Ottbergen bei Höxter. Die Landschaft hier ist geprägt von Heterogenität: Es gibt Wälder und Ackerstandorte, Wiesen und magere Weideflächen, unter anderem mit Fliegen-Ragwurz und Dreizähnigem Knabenkraut. Entsprechend gibt es auch mehrere Naturschutzgebiete, um die seltenen Arten zu schützen. Allerdings: Die Vernetzung der Gebiete ist nicht optimal. Zumindest bis vor zehn Jahren: 2012 nahm die Landschaftsstation Borgentreich gemeinsam mit einem Team der Hochschule Ostwestfalen-Lippe (heute TH OWL) im Rahmen des LIFE+-Projekts „Vielfalt auf Kalk", das in Trägerschafts des Kreises Höxter durchgeführt wurde, den Biotopverbund in den Fokus. Das Ziel des Teilprojekts: ehemalige Ackerstandorte in den Verbindungsachsen der Naturschutzgebiete. Hier sollen artenreiche Salbei-Glatthaferwiesen entstehen, die als Trittsteine die wertvollen Flächen verbinden.
Bei Ottbergen stehen wir auf der ersten dieser Flächen: Die Ackernutzung auf der Fläche wurde aufgegeben, die Fläche begrünte sich nach einem einmaligen Umpflügen von selbst. Jedoch fehlte der Artenreichtum. Deshalb fuhr das Projektteam großes Gerät auf: zwei über zehn Meter breite Streifen wurden auf der gesamten Länge des ehemaligen Ackers umgepflügt. Anschließend brachte ein Dutzend Menschen drei Tage lang samenhaltiges Mahdgut von intakten Wiesen gleichmäßig auf die gepflügten Flächen auf. Ein enormer Aufwand, erinnert sich Winfried Türk, und entsprechend hohe Kosten.
Die Arbeit bringt aber auch Erfolg: Auf den beiden Streifen keimen schon im Folgejahr Wiesen-Salbei, Margeriten, Hornklee, Esparsette und Co. Einige Arten brauchen länger – der Kreuz-Enzian beispielsweise. Das Monitoring belegt, was das Auge in Anbetracht der neuen Blütenfülle wahrnimmt: Zwischen 50 und 60 Arten sind auf den Flächen zu finden, sogar Orchideen. 50 bis 60 % der Arten der beernteten Fläche sind auf dem ehemaligen Acker vertreten.
Der Artenreichtum fällt auch jetzt im April schon auf: Frühlings-Fingerkraut setzt kräftige gelbe Akzente, die Knospen des Wiesen-Salbeis machen Lust auf den Mai. Und noch etwas fällt ins Auge: Die ursprünglich angelegten Streifen „verschwimmen“ allmählich. Die Arten wandern in die Fläche der Umgebung und verändern die Artenzusammensetzung. „Die trockenen Perioden, die wir im Sommer oft haben, unterstützen diesen Prozess“, erklärt Türk. „Die Narbe stirbt dann lokal ab und macht den neuen Samen Platz.“
Noch ist die Fläche – anhand der Wüchsigkeit gut zu sehen – verhältnismäßig nährstoffreich. Die Ackernutzung wirkt immer noch nach und der Lössanteil der Böden hält den Stickstoff langfristig. Für einen Kalkmagerrasen wäre der Standort zu fett, die Salbei-Glatthaferwiese ist deshalb das Nonplusultra, das hier zu erreichen ist. „Ein Entfernen des Oberbodens kam für uns aber nicht infrage“, erklärt Winfried Türk. „Das wäre ein enormer Eingriff und auf kalkhaltigen Böden absolut nicht nachhaltig, da seine speziellen Kationenaustauscher und die Trockenheit die Nährstoffe sowieso schwer pflanzenverfügbar machen.“
Das Projektteam hat deshalb Nutzungsverträge mit den Landwirten im Ort geschlossen, damit die Wiese regelmäßig einmal im Jahr gemäht wird. Das Mahdgut wird entfernt. Das kommt Arten wie dem Kleinen Klappertopf, der im Weserbergland nur noch an wenigen Stellen in Kalkmagerrasen wächst, entgegen. Allerdings dürfen jedes Jahr zur Schonung der Insekten auf der Fläche einige Meter Wiese stehen bleiben. Sie werden dann erst im Folgejahr wieder bewirtschaftet.
Ein Erfolg – allerdings mit hohen Kosten. „Das muss doch auch günstiger gehen“, dachten sich Türk und sein Kollege Frank Grawe von der Landschaftsstation, zumal die Artzusammensetzung oft auch eine gute Ausgangslage bietet, wenn die Flächen sich selbst begrünt haben. Mit der Zeit bildet sich so mesophiles Grünland mit etwa 30 bis 35 Arten, teilweise auch mit Zielarten wieDaucus carota . Die Wilde Möhre ist auch Futterpflanze für die Raupen eines unserer schönsten Schmetterlinge, der Schwalbenschwanz.
Eine gute Ausgangsbasis, um Salbei-Glatthaferwiesen zu entwickeln: Auf einer anderen Fläche im Kreis bei Ossendorf, ebenfalls in der Nähe wertvoller Magerstandorte und angrenzend an bewirtschaftete Äcker, erprobte man eine andere Strategie. „Wir haben hier mit einer Umkehrfräse, also mit einer kleinen Maschine, die von einer Person bedient und auf dem Anhänger transportiert werden kann, nur schmale Streifen umgepflügt.“ Der Aufwand ist deutlich geringer. Auf die offenen Streifen und Fenster bringt das Team konzentriert Saatgut auf.
Das Material haben die Vegetationskundler selbst über die Vegetationsperiode hinweg auf den umgebenden Flächen geerntet. „Das ist minimaler Aufwand, weil wir das Saatgut nebenher ernten können, wenn wir sowieso auf den Flächen sind“, erklärt Winfried Türk. Außerdem können so genau die Arten eingebracht werden, die sich auf der Fläche noch nicht selbst angesiedelt haben, unabhängig vom Erntezeitpunkt einzelner Arten.
Auch hier stellen sich die Arten schnell ein – allerdings mit kleinen Überraschungen. „Als ich das erste Mal wieder auf der Fläche war, dachte ich ‚wo ist der Salbei hin?‘ Ich bekam richtig schlechte Laune“, erinnert sich Türk. Dann am Fuß des Hangs die Erklärung: Der Regen hatte für eine Umverteilung des Saatguts gesorgt, der Salbei wächst nun vor allem im unteren Hangbereich. Aber auch einige Höhenmeter weiter oben konnten sich ein paar Rosetten etablieren, sodass das Team nicht nachsäen musste.
Die Arten, die hier in Streifen eingebracht wurden, haben sich inzwischen in das umliegende Grünland ausgebreitet. Die vor zehn Jahren angelegten Saatstreifen sind heute allenfalls zu erahnen, zumal die kurzlebigen Arten, die in den ersten Jahren dominiert haben, sich inzwischen wieder zurückgezogen haben.
Jetzt, Ende April, dominiert hier vor allem die Echte Schlüsselblume das Bild. Sie hat sich gut etabliert und begeistert nicht nur Winfried Türk, und mich: Auf diesem ehemaligen Acker bekommen wir Gesellschaft. Frank Grawe, inzwischen Wissenschaftlicher Leiter der Landschaftsstation Borgentreich, stößt zu unserer kleinen Exkursion dazu. Wir kennen uns schon etliche Jahre, dementsprechend herzlich ist die Begrüßung und entsprechend schnell ist unser Übergang zum Fachsimpeln über die floristischen Besonderheiten dieser Wiese.
Grawe begleitet das Projekt schon von Anfang an. Für ihn steht im Projekt vor allem die Frage, wie die Potenzialflächen im Kreis mit möglichst wenig Aufwand und Kosten optimiert werden können, im Fokus. „Die Naturschutzmittel sind immer begrenzt“, betont er. „Wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen.“ Für ihn stellte sich deshalb eine wesentliche Frage: Funktioniert Artenanreicherung auch mit noch weniger Eingriffen in die bestehende Grasnarbe? Diese Frage wollten die Vegetationskundler ebenfalls beantworten. Deshalb erprobten sie an anderen Standorten eine weitere Methode: Mit Handgerät – einem simplen Grubber – schafften sie nur sehr kleine Saatfenster, in die wiederum von Hand geerntetes Saatgut der Zielarten eingesät wird. Einmal antreten, fertig. Nach wenigen Wochen schon keimt das Saatgut. Homogener als die Streifentechnik sieht das Bild allemal aus und die Ergebnisse im Monitoring stehen den aufwändigeren Varianten in nichts nach.
Winfried Türk hat außerdem außerhalb des Projekts noch eine weitere Wiese angelegt, dieses Mal zusammen mit einer kleinen Bürgerinitiative aus Höxters Nachbarstadt Brakel. In diesem Fall wurde eine autochthone Saatgutmischung von Rieger-Hofmann eigens für das Projekt zusammengestellt – komplett ohne Gräser. Die sind inzwischen von allein eingewandert. Sie gehören nämlich zu den wenigen Arten, die sich auf den „minimalistischen“ Ackerrandstreifen hier behaupten können. Die neue Wiese ist dank der Ansaat – und einiger mikroinvasiver Ergänzungen – mit inzwischen fast 100 Arten schon sehr artenreich, auch wenn noch viele Stickstoffzeiger dabei sind. Eine klassische Glatthaferwiese wird hier vielleicht nie entstehen – wohl aber eine Vorzeigewiese für die Umweltbildung und ein wichtiger Trittstein für viele Wildbienenarten und Heuschrecken, die sonst in der ausgeräumten Landschaft kaum einen Lebensraum finden würden.
Allen Ausbringungsvarianten ist eines gemein: Es braucht einen langen Atem. Viele Arten laufen nicht gleich im ersten Jahr auf. Erst nach mehreren Jahren wird die positive Entwicklung deutlich. „Der Erfolg lässt sich nicht nach drei Jahren beurteilen“, betont Winfried Türk. „Das braucht viel viel länger.“ Auf privaten Flächen ist oft nicht klar, ob dann noch Zugriff auf die Standorte gegeben ist. Deshalb arbeitet die Landschaftsstation fast ausschließlich auf Flächen der öffentlichen Hand, wo sichergestellt werden kann, dass die Wiesen auch über Jahre hinweg zu artenreichen Glatthafer-Wiesen entwickelt werden können – mit den erfolgversprechenden Methoden, die das Team in den vergangenen zehn Jahren erprobt hat.
„Am besten hat sich im Vergleich der Methoden eine Selbstbegrünung bewährt, in die wir gezielt autochthones Saatgut per Hand einbringen. Minimalinvasiv sozusagen“, fasst Türk zusammen. Der Erfolg gibt ihm Recht: Ich hätte niemals vermutet, dass hier vor wenigen Jahren Weizen, Gerste und Co. angebaut wurden. Stattdessen laufen wir über die Wiese und springen von Fund zu Fund – hier eine Schlüsselblume, dort ein Frühlings-Fingerkraut und davor ein besonders toller Salbei-Bestand. Drei Botanik-Fans unter sich …
Kontakt
- Technische Hochschule OWL
- An der Wilhelmshöhe 44 37691 Höxter winfried.tuerk@th-owl.de
- Landschaftsstation im Kreis Höxter e. V.
- Zur Specke 4
- 34434 Borgentreich
- grawe@landschaftsstation.de

Prof. Dr. Winfried Türk ist Biologe und wurde 2000 als Professor für Vegetationskunde an die Universität-Gesamthochschule Paderborn (inzwischen Technische Hochschule OWL) berufen. In der Forschung beschäftigt er sich insbesondere mit der Wiederanlage und der qualitativen Aufwertung von Grünland.

Frank Grawe ist Diplom-Geograph. Derzeit ist er Wissenschaftlicher Leiter der Landschaftsstation im Kreis Höxter e.V. und engagiert sich mit zahlreichen Projekten für die Entwicklung hochwertiger Flächen im Kreis Höxter.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen













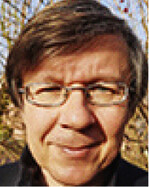
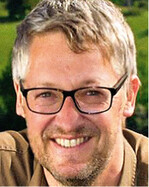




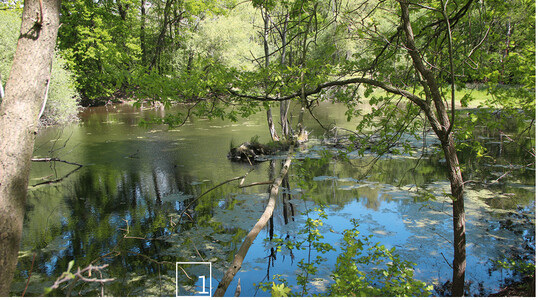




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.