Ein Ehrenamt für die Heidelberger Artenvielfalt
Der Verein Heidelberger Biotopschutz setzt sich für den Erhalt und die Vernetzung von Lebensräumen in Heidelberg ein. Dabei greift er auf den eigenen Erfahrungsschatz zurück und packt aktiv an. Dr. Thomas Trabold hat uns den Verein und seine Aufgaben vorgestellt.
- Veröffentlicht am

Eigentlich fing alles mit Schuhen an. Nicht irgendwelchen Schuhen allerdings, sondern mit einem baden-württembergischen Unternehmen, dass Schuhe produziert und den Feuersalamander als Markenzeichen auserkoren hatte. Die dazugehörige Werbefigur „Lurchi“ war bekannt, hatte sogar eine eigene Comic-Reihe – und die verschlang der junge Thomas Trabold mit Begeisterung. „Da war die Art natürlich positiv besetzt“, meint er rückblickend. „Der Salamander ist was Schönes!“
Dann kam der Hitzesommer 1976. Laichgewässer trockneten aus, Regen war nicht in Sicht. Das gab Trabold und seinen Schulfreunden den Impuls zum Handeln: Lurchi musste geholfen werden! Trabolds Vater war zu dieser Zeit Forstbeamter und Revierleiter im Stadtwald Heidelberg-Rohrbach – die ideale Voraussetzung für das Salamander-Rettungsprojekt der Jungen: Der Wald war sowieso ihr erweiterter Spielplatz. Hier stauten sie Bäche auf, sorgten so dafür, dass temporäre Laichgewässer zur Verfügung standen. Und dokumentierten ihre Ergebnisse, indem sie notierten, wann die Salamander an den Gewässern auftauchten und in welcher Zahl. „Das liegt mir im Blut“, lacht Trabold. „Schon mein Vater hat als Kind Vögel und Schmetterlingsraupen in Heidelberg erfasst.“
Damit war es aber noch nicht getan. „Im nächsten Schritt haben wir gemerkt: Es gibt ja auch noch andere Amphibienarten.“ Das Laichgewässerprojekt wurde ausgeweitet, es galt nun auch den Grasfrosch zu schützen. Was zu tun war, erfuhr Trabold aus Fachbüchern und Zeitschriften. Die las er schon als Kind, sobald er welche in die Finger bekam.
Doch auch hier war der jugendliche Eifer noch nicht am Ende: Als Nächstes standen die Sommerlebensräume im Fokus. „Die Sommerlebensräume der Grasfrösche sind Wiesen“, erklärt Trabold. „Da gab es bei uns in den 70ern fast keine mehr.“ Hier kamen ihm die Kontakte seines Vaters zugute, denn auch die Jagdpächter hatten ein Interesse an Freiflächen. Er fand Unterstützer und gemeinsam legten sie Wiesen und größere Gewässer im Wald an – auch mit größeren Maschinen.
Was als kleines Projekt eines Jungen begann, nahm nun endgültig Fahrt auf: In den 80ern stieg der Forst aus der Weihnachtsbaumproduktion aus und wenige Jahre später kamen der Strukturwandel der Landwirtschaft und die Landschaftspflegerichtlinie Baden-Württemberg. So standen plötzlich zahlreiche neue Splitterflächen zur Verfügung, die es in Wiesen zu verwandeln galt. Neue Biotope für Trabold, der inzwischen in Hohenheim Agrarwissenschaften studierte. Eingesät wurden die Flächen in der Regel nicht. Die Arten waren meist schon vor Ort vorhanden, vor allem in den Altersklassenwäldern, Weihnachtsbaumkulturen und aufgegebenen Weinbergen.
Der Student und seine Mitstreiter sorgten für die Offenhaltung der Flächen, mähten und pflegten sie. Eine Arbeit, die belohnt werden sollte: 1992 zeichnete der damalige Ministerpräsident Teufel das Projekt als „vorbildliche kommunale Bürgeraktion“ aus. „Und damit war klar: Wir brauchen jetzt eine Rechtsform“, erinnert sich Trabold. Ein Jahr später wurde schließlich der Verein „Heidelberger Biotopschutz“ gegründet mit einem klaren Ziel: dem Erhalt der Biotope. „Als Selbstbeschränkung im Verein haben wir dann beschlossen: nur im Stadtgebiet Heidelberg, das ist groß genug.“
Mit dem wachsenden Hintergrundwissen entwickelte sich dann ein neues, wegweisendes Vereinsziel: die Vernetzung der einzelnen Lebensräume, von Laichgewässern und Wiesen. Die Vereinsmitglieder begaben sich nun gezielt auf die Suche nach Flächen, die genutzt werden konnten, um gleichartige, aber auch verschiedenartige Lebensräume zu verbinden.
Ein Partner entpuppte sich schnell als Glücksgriff: Heidelberg Cement. Der Zementhersteller hatte zwei stillgelegte Steinbrüche in HD-Rohrbach und im benachbarten Leimen. Ersterer war rekultiviert, der zweite wurde zum Fledermausschutz offengehalten. Aufkommende Gehölzstrukturen trennten die beiden Lebensräume jedoch. Der Verein ergriff die Initiative, sorgte für die Vernetzung der beiden Steinbrüche untereinander und bezog sogar noch einen dritten, historischen Bruch mit ein. Ein Beleg für die erfolgreiche Arbeit: der Quarry Life Award, den das Projekt 2014 bekommen hat. Für das Team vom Heidelberger Biotopschutz ein Ansporn, weiter an der Vernetzung zu arbeiten. Heute nisten in den Steinbrüchen Uhus, und auch Fledermäuse und Reptilien haben die Lebensräume besiedelt. Von der Straße her lässt sich nur erahnen, welch eine Artenvielfalt sich hier entwickelt hat.
Thomas Trabold und ich passieren die Steinbrüche auf dem Weg zu den vernetzenden Wiesenstrukturen. Stilecht sind wir unterwegs: in einem Unimog, Baujahr 1970, rot lackiert und mit lärmendem Motor. Der Landschaftspfleger will mir hautnah zeigen, welche Aufgaben die Ehrenamtlichen im Verein in ihrer Freizeit bewältigen. An diesem Tag steht das Heuwenden auf dem Plan: Es sind hochsommerliche 33 Grad im Schatten, die Sonne brennt vom Himmel und am Vorabend wurden einige Streuobstwiesen gemäht. Bevor nun das Heu gepresst werden kann, rückt Trabold mit dem Oldtimer aus, um es zu wenden.
Er weiß genau, was er tut. Mit sicherer Hand lenkt er das Fahrzeug über enge, holprige Feldwege. Schließlich, auf einer der Flächen angekommen, springt er aus dem Fahrzeug, klappt mit geübten Handgriffen den Kreiselwender auseinander, klettert dann wieder auf seinen Sitz. Wo er den Umgang mit der Maschine gelernt hat? Das lernt man mit der Zeit, meint er ganz entspannt und steuert den Unimog gekonnt im Slalom durch die Streuobstwiese. Trabold hat sichtlich Spaß an dieser Aufgabe – das sieht man ihm an, wie er da vergnügt mit windzerzaustem Haar am Lenkrad kurbelt und mich derweil mit Anekdoten aus seinem Leben unterhält.
Trabold nimmt sich bei der Arbeit auch immer die Zeit, nach rechts und links zu schauen. So entdeckt er schnell Arten, die dem weniger geübten Auge entgangen wären: ein Neuntöter, der gerade über das Nachbargrundstück fliegt, oder ein Gartenrotschwanz, der in einem Strauch sitzt. Die Arten stehen für ihn immer im Fokus. Nicht nur der Feuersalamander, auch wenn der sich wie ein roter Faden durch Trabolds Geschichte zieht und heute auch großformatig den Vereins-Pick-up ziert.
Auch andere Tiergruppen hat der Verein im Blick und überwacht ihre Bestände mit einem Monitoring. Besondere Aufmerksamkeit bekommt hier die Gelbbauchunke, vor allem aufgrund ihrer starken Gefährdung und ihrer hohen Biotopansprüche. Die Pflege aller Flächen wird dabei so ausgerichtet, dass sie die Lebensraumansprüche der Tiere möglichst gut erfüllen.
Die Streuobstwiesen, Gewässer und Offenlandbereiche sind zum Teil in Privathand, andere städtisch. Gefördert wird die Arbeit über Pflegeverträge oder aus Mitteln der Landschaftspflegerichtlinie. „Alles, was wir erwirtschaften, fließt in diesen Fuhrpark“, erklärt Trabold. „Das ist für uns sehr wichtig, da die notwendigen Geräte heute so kaum noch erhältlich sind.“
Denn auf den Splitterflächen, die er mit seinen Mitstreitern pflegt, braucht es sehr wendige, kleine Maschinen, die zudem auch an teils recht steilen Hängen noch zuverlässig arbeiten. Bergbauerntechnik wäre geeignet, ist aber meist zu teuer. Daher schwören sie auf historische Maschinen. Die Lagerhalle des Vereins erinnert nicht ohne Grund etwas an ein Landwirtschaftsmuseum.
Repariert werden die Youngtimer teils in Eigenleistung. „Gerade weil wir die Arbeit in unserer knappen Freizeit machen, muss auch alles funktionieren – und einen hangtauglichen, streuobstwiesentauglichen, autobahntauglichen, wendigen 6-Zylinder, der weniger Verkehrsfläche als ein Pkw beansprucht, gibt es im Programm heutiger Hersteller längst nicht mehr. Zu Recht bezeichnete einmal Hans-Jürgen Wischhoff vom VDMA den Unimog 406 als ‚genialstes Fahrzeug‘.“
Trotz der lärmenden Maschinen: Der Verein ist auch dem Elektroantrieb nicht abgeneigt. Alle Kleingeräte wie Freischneider und Heckenscheren sind akkubetrieben. Das sei auch wichtig, meint Trabold, schließlich arbeite man ja in einer Erholungslandschaft. Man wolle ja nicht unnötig Unmut wecken. Der Verein plant auch, eines Tages einen elektrobetriebenen Schlepper anzuschaffen. Mit dem könnten viele der Pflegearbeiten „ohne Schall und Rauch“ dem Zeitgeist und dem Anspruch der Erholungsuchenden gerecht werden. Doch Trabold bleibt realistisch. „Das ist noch so teuer, das können wir uns in zehn Jahren vielleicht mal leisten“, lacht er. Ein Hersteller aus der Schweiz kommt in die engere Auswahl, die Traditionsmarke aus dem Allgäu arbeitet auch an dem Thema – es bleibt spannend zu raten, was in einigen Jahren in der Halle stehen wird.
Das „Endkundengeschäft“ in Form von Jugendarbeit, Exkursionen, Veranstaltungen und Umweltbildung, das in den Anfangsjahren des Vereins noch viel Zeit verschlang, hat man mittlerweile abgegeben an darauf spezialisierte Kooperationspartner, die alle gemeinsam in der professionellen Plattform des Umweltamtes „Natürlich Heidelberg“ koordiniert und organisiert sind. Auch ohne diese zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit fließen noch immer 20 Prozent der von den Vereinsmitgliedern geleisteten zirka 20 Wochenstunden in die Kommunikation und Beratung vor Ort. Man kennt so die „Stammkundschaft“ der Erholungsuchenden und Grundstücksnachbarn mittlerweile in fast jeder Ecke. Oft kommen auf diesem Weg auch wertvolle Hinweise oder Meldungen zu Arten an den Verein.
Betriebsdaten
Gründung: 1993
Gesellschaftsform: eingetragener Verein
Mitarbeiter: 12 aktive Mitglieder
Maschinenpark (Eigentum Verein, Privateigentum Mitglieder und Betriebe der Mitglieder): 4 Unimog (52–122 PS), 4 Allradschlepper (65–105 PS), 4 Einachser und Balkenmäher, 3 Mähwerke (Doppelmesser und Scheiben) 2 Kreiselschwader, 2 Kreiselwender, Bandrechen, 2 Ladewagen, Rundballenpresse, Kran-Anhänger mit Mistgreifer, 10 Akku-Handgeräte
Flächen: 50 Wiesen- und Sukzessionsflächen, 60 Amphibien-Laichgewässer, 300 Obstbäume
Philosophie
„Für uns ist die Biotopvernetzung ein großes Ziel. Wir möchten die Biodiversität in Heidelberg erhalten und entwickeln – unser Credo: Artenschutz durch Landschaftspflege!“
Weitere Infos
... finden Sie unter Webcode NuL4844.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen












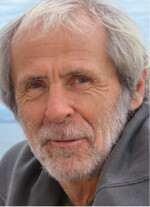





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.