Neuer Artenhotspot für die Niederlande
- Veröffentlicht am

Das Markermeer war nicht immer ein isolierter See. Einst gehörte es zum IJsselmeer, auch Eisselmeer genannt, dem größten See der Niederlande. Das änderte sich 1976: Seitdem trennt ein Deich das Markermeer vom Rest des Sees. Die Wasserfläche dahinter sollte trockengelegt werden, doch die Landgewinnung wurde über 30 Jahre hinweg immer wieder verschoben, bis die Pläne 2006 schließlich fallen gelassen wurden.
Der Dammbau aber blieb nicht ohne Folgen für den flachen See. Er wurde abgeschnitten von den Zuflüssen, die ihn als Teil des Eisselmeers durchströmten, und stagnierte. Ohne die Strömung sammelte sich eine dicke Schlammschicht am Grund, die vor dem Dammbau in die tieferen Gewässer des Eisselmeers gespült werden konnte. Wind und Wellen wirbelten Sedimente auf und trübten das Wasser. Das reduzierte die Primärproduktion von Algen und Wasserpflanzen. Zugleich verschwanden die natürlichen Ufer- und Flachwasserbereiche. Als Folge brachen die reichen Fisch-, Muschel- und Vogelbestände am See ein.
Innovative Lösung
Nun hat Natuurmonumenten, die größte private Naturschutzorganisation der Niederlande, zusammen mit Rijkswaterstaat, ein neuer Archipel in der 700 km² großen Wasserfläche geschaffen: Marker Wadden (das Marker Watt). Die Inseln, Marschen und Wattflächen reduzieren nicht nur die Turbulenzen im Wasser, sondern bieten heute zahlreichen Tier- und Pflanzenarten neuen Lebensraum. Den Impuls dazu gab Roel Posthoorn, Projektdirektor des Marker Watts. Er und andere arbeiteten daran, das Problem in eine Lösung zu verwandeln: Aus dem Überschuss an Schlick, Sand und Ton naturnahe Habitate zu formen und damit den Schlick im See zu reduzieren.
Die größte Herausforderung dabei: die Finanzierung. „Die größte Herausforderung war es, den Staat mit ins Boot zu holen. Dank des Geldes der Niederländischen Postcode Lotterie konnte Natuurmonumenten anfangen, aber das war noch nicht genug. Es war ein langwieriger Prozess, genügend Mittel für das Projekt zu finden, aber am Ende halfen viele Parteien bei der Finanzierung dieses einzigartigen Projekts“, erzählt Tim Kreetz, der im Projekt jetzt für die Koordinierung des Naturmanagements zuständig ist.
Umsetzung
2016 startete schließlich der Bau der Inseln: In Zusammenarbeit mit Rijkswaterstaat und Boskalis, einem niederländischen Bauunternehmen, das auf maritime Konstruktionen spezialisiert ist, wurden Inseln mit natürlichen Küsten wie Feuchtgebieten und Stränden aufgeschüttet. Dazu wurde das im See selbst abgelagerte Sediment genutzt. Fünf Inseln wurden so innerhalb von nur drei Jahren angelegt. Zwischen ihnen befinden sich wertvolle flache Wasserbereiche, die als Laichhabitate für Fische dienen, sowie tiefe Kanäle.
Insgesamt 42 Mio. m³ Sand wurden dafür bewegt. Dazu wurde zuerst ein tiefer Kanal im See in der Nähe der ersten Insel gegraben. „Das gewonnene Sediment wurde dann erst zu ringförmigen Dämmen unter Wasser geformt“, erklärt Tim Kreetz, „zwischen denen dann nach der Setzung des Materials Inseln aufgeschüttet wurden.“ Ihre Uferbereiche orientieren sich an Verlaufsmustern natürlicher Seen und der Schwerkraft. Mithilfe von Schilf und Rohrkolben wurden die Ufer dann fixiert – übrigens die einzigen Pflanzenarten, die künstlich eingebracht wurden.
Zusätzlich zur Modellierung der Inseln folgten einige wenige weitere bauliche Eingriffe: Ein Naturhafen bietet Platz für 60 private Boote und drei gecharterte Schiffe. Außerdem gibt es einen Kai für eine Personenfähre. Vier Strandhäuser auf der Hafeninsel können von Touristen angemietet werden. Auf insgesamt 12 km Wanderweg können diese die Inseln erkunden oder sich am 700 m langen Badestrand erholen. Drei Vogelbeobachtungshütten und ein 12 m hoher Beobachtungsturm ermöglichen eine störungsarme Beobachtung der zahlreichen Zugvögel. Für die Biodiversitätsforschung stehen außerdem eigene Räumlichkeiten zur Verfügung. Zusammen sind die Gebäude so ausgelegt, dass sie ihre eigene Energie und eigenes Trinkwasser erzeugen sowie das Abwasser reinigen.
Platz für die Natur
Die Hafeninsel ist die einzige, die von Menschen betreten werden darf. Die anderen vier Inseln sind allein für die natürliche Entwicklung reserviert. Mit Erfolg: Im Wesentlichen dienen die neuen Inseln der Natur. 140 Vogelarten, 190 verschiedene Insektenarten und über 200 Pflanzenarten wurden bereits in den verschiedenen Habitaten des Archipels wahrgenommen, an seinen Ufern wurden 19 verschiedene Fischarten gesichtet. „Bisher sind wir überwältigt von dem schnellen Wachstum der Biodiversität, der enormen Anzahl von Vögeln, Insekten, Wasserlebewesen, Fischen und Pflanzen“, betont Kreetz.
Viele der Vogelarten nutzen den Archipel, um zu überwintern, andere rasten hier nur auf ihrer Reise in wärmere Gefilde in Afrika beziehungsweise in die Brutgebiete in Skandinavien, Russland und Sibirien. Andere Arten sind aber auch für die Aufzucht ihrer Jungen an den einst devastierten See zurückgekehrt: Flussseeschwalben und Kormorane brüten hier regelmäßig und viele weitere Arten wie Nonnengans, Löffelente und Säbelschnäbler nutzen die Inseln für die Nahrungssuche. Regelmäßig sind jetzt auch wieder Stinte, Rotaugen, Schleie, Hecht und andere Fischarten in den flachen Gewässern anzutreffen. Seltener werden auch Schnäpel, Quappe, Rapfen und Wels gesichtet.
Auch die Pflanzen sind zurückgekehrt, und nicht nur das Schilfrohr und der Rohrkolben, die zur Ufersicherung gepflanzt wurden. Sumpfporst ist sehr häufig, außerdem fühlen sich Halophyten wie die See-Aster hier sehr wohl. Auch weitere Arten werden noch erwartet – sie wandern mithilfe des Windes, der Fische und der Vögel ein. „Wie sich die Natur genau entwickelt, können wir nicht vorhersagen“, erklärt Tim Kreetz. „Wir haben die Bedingungen geschaffen, nun ist die Natur an der Reihe.“
Was bringt die Zukunft?
Sein Team rechnet damit, dass das derzeitige Pionierstadium abnehmen wird, stattdessen werden sich größere und strukturreichere Schilfgürtel entwickeln. „Es geht weniger darum, ob wir mehr oder weniger Arten haben werden, sondern eher darum, dass sich die Artenzusammensetzung verändern wird.“
Doch Kreetz‘ Team hat auch konkrete Hoffnungen an die weitere Entwicklung der Inseln: „Wir hoffen, dass Pionierarten wie Flussseeschwalbe und Seeregenpfeifer weiterhin ihren Platz auf der Insel finden werden. Aber auch Arten, die in den Niederlanden sehr selten geworden sind, wie Rohrdommel und Drosselrohrsänger, werden einen langfristigen Platz in den Sümpfen finden.“ Die Hoffnungen der Naturschützer sind nicht unbegründet. „Im Moment sehen wir einen enormen Zuwachs an Jungfischen, der in den kommenden Jahren aufgrund der fantastischen Wachstumsmöglichkeiten in den Sümpfen weiter zunehmen wird. Davon profitieren letztlich auch viele fischfressende Vögel.“
Die Entwicklung wird in den kommenden Jahren genauestens dokumentiert. Im Marker Wadden Knowledge and Innovation Program (KIMA) untersuchen Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape und Natuurmonumenten, wie sich das Ökosystem des Marker Watts entwickelt. KIMA zielt darauf ab, Wissen über das Bauen mit Schlick, Schutzvorrichtungen aus Sand, Ökologie und Management der künstlichen Inseln zu generieren. Außerdem gibt es ein spezifisches Artenmonitoring, zum Beispiel für Säbelschnäbler und Fische.
Mit den bisherigen fünf Inseln ist das Projekt übrigens noch nicht beendet: Mit dem Bau zweier weiterer Inseln wurde in diesem Jahr begonnen, sie sollen bis 2023 fertiggestellt sein und dann noch mehr Lebensraum für die Arten des Wattenmeers bieten. Insgesamt soll eine Fläche von 1.300 ha im See entstehen.
Projektdaten
- Initiator: Natuurmonumenten
- Durchführung: Natuurmonumenten und Rijkswaterstaat
- Umsetzung: Boskalis
- Finanzierungsumfang: ca. 90 Mio. €
- Finanzierung: Natuurmonumenten, Niederländische Postcode-Lotterie, Ministerium für Infrastruktur und Wassermanagement, Ministerium für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität, Provinz Flevoland, Provinz Nord-Holland
Kontakt:
Natuurmonumenten
Stationsplein 1
NL – 3818 LE Amersfoort
T: (033) 479 70 00
www.natuurmonumenten.nl
Weitere Infos:
Mehr über das Gebiet Marker Watt erfahren Sie bei Natuurmonumenten.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


















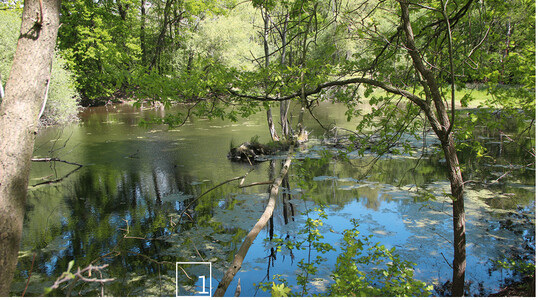


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.