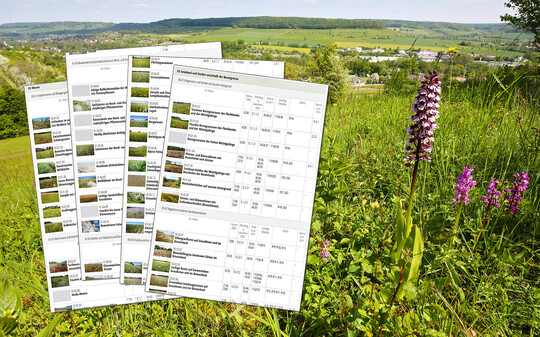
Neuer Zustandsbericht erschienen
Wie geht es den Vögeln in Deutschland? Welche Arten nehmen zu, welche verschwinden? Der neue Bericht „Vögel in Deutschland – Bestandssituation 2025“ stellt die Bestandsveränderungen von insgesamt 304 in Deutschland brütenden und 125 rastenden Vogelarten vor. Der Bericht zeichnet das Bild einer Vogelfauna, die sich derzeit dynamisch entwickelt.
von BfN/Redaktion erschienen am 05.11.2025Insgesamt hat sich die Bestandssituation der heimischen, regelmäßig brütenden Vogelarten im Vergleich zum letzten Berichtszeitraum leicht verbessert: Im Zeitraum von 2010 bis 2022 nahmen 40 % der Arten im Bestand zu, während 30 % Abnahmen zeigten. Trotz der teils positiven Entwicklung bietet der Anteil abnehmender Arten Anlass zur Sorge, zumal sich die Zahl an Arten mit stabilen Beständen verringert hat.
Zu den über die letzten 24 Jahre am stärksten zunehmenden Arten gehören Bienenfresser, Zaunammer, Wiedehopf und Purpurreiher-Vogelarten, die ihr Brutgebiet aktuell weiter nach Norden ausdehnen und somit von dem wärmeren Klima und milderen Wintern profitieren. „Erstmals können wir bei einer Reihe von Vogelarten Bestandstrends beobachten, die sich mit Auswirkungen des Klimawandels in Zusammenhang bringen lassen“, kommentiert Dr. Tobias Erik Reiners, Vorstandsvorsitzender des Dachverbands Deutscher Avifaunisten (DDA). „Während wärmeliebende Arten zunehmend profitieren, nehmen die Bestände vieler häufiger Arten, die gemäßigte Temperaturen bevorzugen, tendenziell ab.“
Schlecht sieht es besonders im Agrarland aus: Gleich sieben Arten, die landwirtschaftliche Flächen zum Brüten nutzen, zählen zu den größten Verlierern der letzten 24 Jahre. So verzeichnen Alpenstrandläufer (-84 %), Rebhuhn (-66 %), Bekassine (-66 %), Kiebitz (-65 %), Wachtelkönig (-61 %), Braunkehlchen (-59 %) und Uferschnepfe (-59 %) teils drastische Rückgänge. Eine Entwicklung, die Dr. Torsten Langgemach, Geschäftsführer der LAG VSW, mit Sorge auf diese Bilanz blicken lässt: „Es fällt auf, dass Arten des Grünlands wie Uferschnepfe und Wachtelkönig drastische Bestandsabnahmen aufweisen. Hier ist dringend konsequentes Handeln geboten, insbesondere was die Bindung finanzieller Fördermittel in der Landwirtschaft an einen Mehrwert für die biologische Vielfalt und die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen im Grünland betrifft.“
Hoffnung gibt, dass sich für einige Arten Verbesserungen zeigen, wenn konsequente Maßnahmen zu ihrem Schutz ergriffen werden. Unter anderem charismatische Großvogelarten wie Uhu, Großtrappe, Kranich und Seeadler profitieren von Artenhilfsprogrammen, nachlassender Verfolgung und dem Verbot schädlicher Umweltgifte.
Dass sich Schutzbemühungen lohnen, zeigt auch ein Blick auf das Herzstück des Vogelschutzes: die Vogelschutzgebiete. Von den sogenannten Triggerarten, den Zielarten der europäischen Vogelschutzgebiete, konnten etwa 40 % über die letzten zwölf Jahre eine positive Bestandsentwicklung verzeichnen.
„Der Bericht ,Vögel in Deutschland – Bestandssituation 2025‘ macht deutlich: Wenn in den ausgewiesenen Schutzgebieten ein umfassendes Management erfolgt, haben bedrohte Vogelarten wie Schreiadler und Mittelspecht eine Chance, dauerhaft zu überleben. Die positive Bestandsentwicklung bei vielen Arten unterstreicht, wie wirkungsvoll konsequentes Management sein kann – in Schutzgebieten und darüber hinaus!“, kommentiert Sabine Riewenherm, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN).
Hintergrund
Der Bericht ist eine gemeinsame Publikation des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) und des Dachverbands Deutscher Avifaunisten (DDA). Grundlage des alle sechs Jahre erstellten Berichts bilden ehrenamtlich erhobene sowie behördliche Daten. Die Ergebnisse bilden eine zentrale Basis für Natur- und Vogelschutzentscheidungen in Deutschland.









Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.