
Flächenmanagement und Klimawandel beeinträchtigen mehrere Agrarland-Ökosystemleistungen
Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, zeigt, dass Grün- und Ackerland besser verschiedene Leistungen gleichzeitig erbringen könnten, wenn der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und mineralischen Düngemitteln verringert wird. Diese Ergebnisse gelten auch unter möglichen zukünftigen Klimabedingungen, so die Forschenden.
von iDiv erschienen am 19.07.2024„Dank des Designs unserer Studie konnten wir den Einfluss zentraler Elemente des globalen Wandels, wie Landnutzungsänderung und Klimawandel, auf die Bereitstellung verschiedener Ökosystemleistungen untersuchen“, sagt Erstautor Friedrich Scherzinger. „Diese Ökosystemleistungen sind für das menschliche Wohlbefinden unabdingbar. Indem wir ökonomische und ökologische Forschungsansätze vereinen, kommen wir zu einem ganzheitlicheren Bild der vielen miteinander verbundenen Elemente eines Ökosystems.“
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzten eine große Feldexperiment-Anlage mit fünf Landnutzungstypen unter zwei verschiedenen Klimaszenarien (aktuelles und mögliches zukünftiges Klima): die vom UFZ betriebene Global Change Experimental Facility (GCEF). Um die ökologische Multifunktionalität zu bewerten, wurden 14 Ökosystemfunktionen untersucht – etwa die Bindung von Stickstoff oder die oberirdische Biomasseproduktion. Zur Bewertung der ökonomischen Multifunktionalität ermittelte das Team den finanziellen Gesamtwert der sechs Ökosystemleistungen Lebensmittelproduktion, Kohlenstoffbindung, Wasserqualität, Bodengesundheit, Erhalt der Biodiversität und Landschaftsästhetik.
Da die Forschenden die Präferenzen von Landwirten, Anwohnern, Umweltschützern und Tourismusverbänden von vornherein berücksichtigten, konnten sie die Ökosystemleistungen umfassender bewerten, als bei einer rein ökonomischen Betrachtung.
„Höhere Level an Biodiversität wirken sich stabilisierend auf die Biomasseerträge aus und machen diese weniger störungsanfällig, ähnlich wie bei einem diversifizierten Anlageportfolio“, sagt Prof. Dr. Martin Quaas, Wirtschaftswissenschaftler bei iDiv und der UL und Senior-Autor der Studie. „Auf diesem Effekt basieren unsere Berechnungen zum natürlichen Versicherungswert der Biodiversität.“
Die Ergebnisse legen nahe, dass der zukünftige Klimawandel und eine intensive Bewirtschaftung die ökologische Multifunktionalität von Grün- und Ackerland verringern. Insgesamt ist der wirtschaftliche Nutzen der Ökosystemleistungen bei einer extensiven Bewirtschaftung ungefähr 1,7- bis 1,9-mal höher als bei einer intensiven Bewirtschaftung – und zwar sowohl bei Grün- als auch bei Ackerland. Berücksichtigt man jedoch nur die Präferenzen der Landwirte, dann steigt die Multifunktionalität von Grünland durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Stickstoffdünger. Die Ergebnisse beruhen auf dem Vergleich pro Einheit Fläche; wegen der unterschiedlichen Produktivität intensiver und extensiver Landwirtschaft könnte ein Vergleich pro Einheit Ertrag anders ausfallen.
Bodenbiodiversität und Ökosystemleistungen verbinden
Das Forschungsteam untersuchte auch die Beziehung zwischen Bodenbiodiversität (die Vielfalt des Lebens im Boden) und ökologischer Multifunktionalität bei verschiedenen Landnutzungstypen und unter aktuellen sowie möglichen zukünftigen Klimabedingungen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Bodenbiodiversität einen wichtigen Anteil an der Fähigkeit eines Ökosystems haben könnte, verschiedene Funktionen gleichzeitig zu erfüllen. Ökosysteme mit geringer Bodenbiodiversität könnten unter zukünftigen Klimabedingungen besonders anfällig sein.
„Etwa 60 Prozent aller Arten leben im Boden. Diese Bodenlebewesen sind nicht nur unglaublich vielfältig, sondern sie sind auch das funktionelle Rückgrat unserer Ökosysteme“, erklärt Prof. Dr. Nico Eisenhauer, Bodenökologe bei iDiv und an der UL sowie Senior-Autor der Studie. „Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass wir die Bodenbiodiversität mit zielgerichteten Managementstrategien erhalten können und somit auch die verschiedenen Leistungen, die die Natur für uns erbringt.“
Die Studie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem ganzheitlichen und umfassenden Ansatz. Die Autorinnen und Autoren betonen, dass der gesellschaftliche Nutzen der Landwirtschaft aufgrund des Klimawandels, des Verlusts biologischer Vielfalt und zu hoher Mengen Agrochemikalien deutlich abnehmen könnte.
„Unsere Studie zeigt, dass Landwirte mit einer intensiven Bewirtschaftung die maximalen Erträge einfahren, die Bereitstellung von Ökosystemleistungen ist aber bei einer extensiven Bewirtschaftung am höchsten“, sagt Scherzinger. „Traditionell sind es nun einmal die Landwirte, die das Land bewirtschaften. Der gesellschaftliche Nutzen kann daher nur dann optimal sein, wenn ein System geschaffen wird, das Landwirten Anreize bietet und die Differenz zwischen den Einnahmen aus intensiver und extensiver Bewirtschaftung ausgleicht.“
Die Studie berücksichtigt jedoch nicht alle relevanten Aspekte, wie zum Beispiel die landschaftliche Vielfalt oder den Flächenbedarf pro Ertragseinheit. Das macht umfassende Schlussfolgerungen hinsichtlich des optimalen Bewirtschaftungstyps weiterhin schwierig. „Zukünftige Forschung sollte sich auf die Bereitstellung von Ökosystemleistungen auf Landschaftsebene konzentrieren und auf die Rolle der landschaftlichen Heterogenität für ein optimales gesellschaftliches Ergebnis“, schlussfolgert Scherzinger.







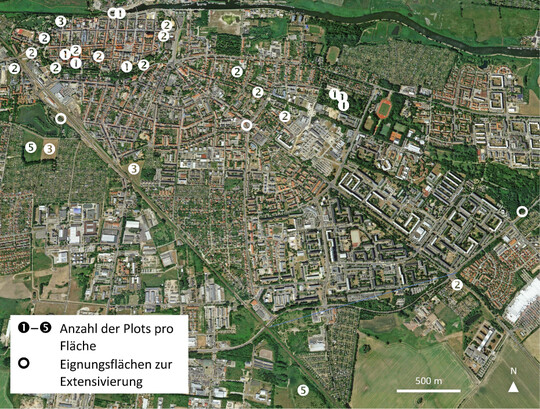

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.