Landschaftswasserhaushalt im Klimawandel
Dürren und zahlreiche Waldbrände auf der einen Seite, teils schwere Überschwemmungen auf der anderen Seite: Durch den Klimawandel wird das Wetter immer extremer. Was kann die Landschaftsplanung tun, um die Folgen zu mildern? Das haben wir Dr. Jörg Zausig, Diplom-Geoökologe und Vorsitzender des DWA-Hauptausschusses Gewässer und Boden, gefragt.
von Julia Schenkenberger erschienen am 08.05.2024











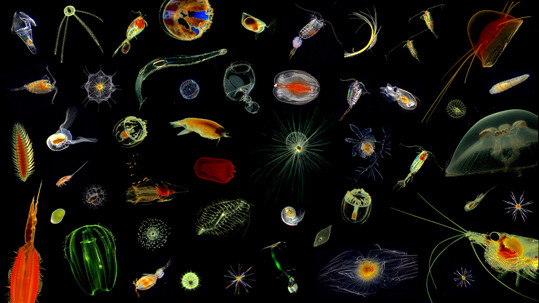
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.