Vision Flussperlmuschel
- Veröffentlicht am

Sommerferien! Freiheit! Schnell, den alten Schulranzen in die Ecke und raus in die Natur! Es gibt so viel zu entdecken. Am schönsten ist es drüben am Bach – lasst uns ein paar Muscheln suchen und in der Sonne mit ihnen spielen!
Moment. Muscheln in einem Bach?? Kaum jemand in meiner Generation kennt das noch. Sedimenteinträge und andere Stoffeinträge aus benachbarten Flächen haben das Interstitial – den Raum, in dem junge Muscheln die ersten Jahre ihres Lebens verbringen – längst unbewohnbar gemacht. Der Klimawandel tut sein Übriges. Die Flussperlmuschel, noch vor Jahrzehnten zu Tausenden in unseren Bächen, könnte in 20 Jahren ganz verschwunden sein.
Für Stefan Guttmann und Clemens Gumpinger ist klar: Das muss verhindert werden! Nicht allein um der Flussperlmuschel willen. „Die Muschel ist auch Schirmart für zahlreiche andere Arten“, betont Guttmann, seines Zeichens Betreuer des Projekts in der Abteilung Naturschutz beim Land Oberösterreich. „Wenn wir dieser Art helfen, helfen wir auch anderen Arten!“ In Österreich ist die Problematik der rückläufigen Bestände schon lange bekannt. Schon in den 90er Jahren werden erste Maßnahmen zum Schutz der Art ergriffen. Seit Stefan Guttmann schließlich 2010 das Artenschutzprojekt übernahm, hat er ein erklärtes Ziel: den Flussperlmuschelschutz in Oberösterreich auf ein neues Niveau heben! Bei Clemens Gumpinger rennt er offene Türen ein. Der Gewässerökologe leitet seit 1999 das Büro blattfisch und setzt sich bereits seit Anbeginn seiner beruflichen Laufbahn für den Schutz der heimischen Muscheln ein.
2011 wird aus dem gemeinsamen Ansinnen dann Realität. Mit dem Projekt „Vision Flussperlmuschel“ wollen die beiden Gewässerökologen wieder für vitale Bestände der Flussperlmuschel in den Bächen Oberösterreichs sorgen. Ihr Projekt fußt auf drei Säulen: der Untersuchung potenzieller Wiederansiedlungsgewässer, der Wiederherstellung der Lebensräume und der Nachzucht in einer eigens errichteten Zuchtstation.
Schon zu Projektbeginn ist klar: Die Flussperlmuschel zu retten wird Zeit brauchen. „Es ist wichtig, dranzubleiben, da die Art so alt wird und einen komplizierten Fortpflanzungszyklus hat“, betont Stefan Guttmann. Flussperlmuscheln können weit über 100 Jahre alt werden. Ihre Fortpflanzungsstrategie ist an die besonderen Herausforderungen ihres Lebensraums – Hochwässer, Dürren und mehr – angepasst. Sie produzieren unzählige Spermien und Eier. Die daraus entstehenden Glochidien, winzige Muschellarven, überleben nur, wenn sie sich in den Kiemen eines Wirtsfisches einnisten können. Im Falle der Flussperlmuschel ist das in Mitteleuropa ausschließlich die Bachforelle. Im Kiemengewebe überdauern sie den Winter, quasi als Parasiten. Erst im folgenden Sommer lösen sie sich und sinken als winzige, fertige Jungmuscheln an den Gewässergrund. Die nächsten fünf bis zehn Jahre werden sie hier tief im Kies eingegraben leben, bevor sie sich an der Oberfläche zu Muschelbänken zusammenfinden, wo sie Nahrungspartikel aus dem Wasser filtern.
Allein die Fortpflanzungsstrategie der Muscheln beinhaltet ein wesentliches Problem: Sie funktioniert nur dann gut, wenn die Bestände intakt sind. „In unseren ausgedünnten Beständen funktioniert das schlechter“, stellt Clemens Gumpinger fest.
Um die Bestände wieder zu stabilisieren, muss das Team an den drei Projektsäulen parallel arbeiten. Doch schnell treffen die großen Ambitionen der Projektinitiatoren auf die Realität. Ganze Bachabschnitte sanieren, sodass der Kieskörper wieder ein guter Lebensraum sein kann? Ein toller Ansatz, denn der ist schließlich als Lebensraum der Jungmuscheln der größte Flaschenhals. Vor allem die Überlagerung mit Feinsand aus dem Gewässerumland stellt ein Problem dar. Doch eine großangelegte Sanierung erweist sich als utopisch. Zu viele Akteure sind beteiligt – Landbesitzer, der Forst, Landwirtinnen und Landwirte, Kraftwerksbetreiber, die Fischerei. Ein Konsens für Muscheln ist nur selten möglich. „Wir mussten unsere Ziele downgraden“, gibt Guttmann zu. Und Gumpinger ergänzt: „Es geht zurzeit in erster Linie darum, die Art nicht aussterben zu lassen!“
Heute steht daher vor allem im Fokus, drei bis vier Stämme der Flussperlmuscheln zu erhalten und für diese kleine Lebensraumabschnitte zu optimieren, beispielsweise mit dem Einbau von Sedimentationsbecken, um den Austrag von Sediment aus dem Gewässer zu fördern. Auch das Feuchtwiesenmanagement wird optimiert. Wunschvorstellung ist, dass die Flussperlmuscheln in diesen optimierten Lebensräumen eines Tages wieder unabhängig vom Menschen überleben können. Selbst das ist eine Herausforderung. Aktuell arbeitet das Team mit drei Stämmen. Einer davon besteht nur noch aus 50 Tieren, die komplett in Kultur genommen wurden, damit der Stamm nicht ausstirbt.
In Kultur, das bedeutet in Oberösterreich in eine halbnatürliche Zuchtstation – die Idee hat das österreichische Team von einem Luxemburger Zuchtprojekt adaptiert. In der Station werden die Muscheln in zwei langen Wasserbecken in einem Baucontainer gehältert, in dem auch die Reproduktion stattfindet. Der Prozess verläuft halbnatürlich: Die Wassertemperatur wird nicht gesteuert. Clemens Gumpinger erklärt: „Wir wollen die Bedingungen möglichst nah an den natürlichen Bedingungen halten.“ In einem wesentlichen Punkt weichen die Projektbeteiligten aber von der Naturnähe ab: Als Wirtsfische kommen keine Bachforellen aus Wildgewässern mehr zum Einsatz – die haben sich als widerspenstig erwiesen und sind bereits einmal über die Abwasserleitungen geflüchtet. Zuchtforellen lassen sich in den Becken wesentlich besser hältern.
Einen Nachteil bringt die halbnatürliche Nachzucht aber mit sich: Der Zeitpunkt der Ernte, wenn die Jungmuscheln sich aus den Kiemen lösen, ist nicht steuerbar. „Wir nehmen unseren Urlaub also dann, wenn die Muscheln es erlauben“, schmunzelt Gumpinger. Als wir sprechen, arbeiten ein Stockwerk weiter unten gerade fünf Mitarbeitende daran, die Ernte auszulesen. Sie sortieren unter dem Mikroskop die gerade einmal 0,1 mm winzigen Tiere aus dem „Bodensatz“ der Fischbecken. Etwa 25.000 Mini-Muscheln pro Jahr werden so gewonnen. Wenn alles gut läuft, überlebt ein Zehntel der Tiere das erste Jahr – eine Ausbeute, wie sie auch in anderen Zuchtprojekten festgestellt werden kann. Krankheiten können den Bestand weiter dezimieren. Die Herausforderung dabei ist, dass die Muschelforschung noch eine recht junge Disziplin ist. Medikamente im Krankheitsfall gibt es kaum, das meiste wird über den Salzgehalt und die Wassertemperatur gesteuert. „Wir tauschen uns in der Community aber sehr intensiv aus“, fügt Clemens Gumpinger hinzu. Die ist zwar sehr überschaubar, aber eng vernetzt. Tritt in Österreich beispielsweise ein unbekanntes Symptom bei den Muscheln auf, ist schnell eine Mail geschrieben. Dann weiß vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin in Tschechien, Norwegen oder in Bayern Rat.
In Oberösterreich macht die Muschelzucht auch dank dieser internationalen Erfahrungen Fortschritte. Die ersten 90 rund 10 Jahre alten Flussperlmuscheln konnten im September 2022 wieder außerhalb von Behältern ausgewildert werden. Ein pressewirksames Ereignis – für das Projekt sehr wichtig, auch, um die Bedeutung der Muscheln für das Ökosystem aufzuzeigen. „Öffentlichkeitsarbeit für die Flussperlmuschel ist leicht und schwer zugleich“, stellt Stefan Guttmann fest. „Leicht, weil sie ein Sympathieträger ist und zugleich eine kulturhistorische Bedeutung hat. Schwer, weil der Naturschutz anderen Akteuren scheinbar Vorschriften machen will.“ Hier setzt das Projektteam an und zeigt auf, dass Muschelschutz auch einvernehmlich mit allen Akteuren gemeinsam funktionieren kann.
Wenn es nach Guttmann und Gumpinger geht, waren die ersten ausgewilderten Muscheln nur der Anfang. Einige Tausend warten noch darauf, in ihre neue alte Heimat ziehen zu dürfen, sobald sie groß genug sind. Die beiden Projektverantwortlichen machen sich außerdem Gedanken über die Größe des Projektes. Stefan Guttmann führt das aus: „Im Grunde tun wir die richtigen Dinge. Die Frage ist, ob wir es in der richtigen Dimension tun.“ Denn um die Flussperlmuscheln wirklich zu retten, müssten mehr Gewässer saniert und mehr Muscheln nachgezüchtet werden. Vielleicht ist ein großes, international angelegtes Projekt hier die Lösung – vernetzt sind die Muschelexpertinnen und -experten schließlich schon.
Projektdaten
- Projektname: Vision Flussperlmuschel
- Projektträger: Abteilung Naturschutz am Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
- Durchführung: blattfisch e. U.Projektbeginn: 2011
- Projektkulisse: Gewässersysteme der Aist und der Naam, Leitenbach
- Finanzierungsumfang: ca. 100.000 €/Jahr
- Finanzierung: mit Unterstützung von Land Oberösterreich und Europäischer Union: Maßnahme 78-03 Wissenstransfer und Bewusstseinsbildung
Kontakt
blattfisch e.U.
Leopold-Spitzer-Straße 26
A - 4600 Wels
office@blattfisch.at

Stefan Guttmann ist Sachverständiger in der Abteilung Naturschutz beim Amt der Oö. Landesregierung.

Clemens Gumpinger ist Leiter des Gewässerökologie-Büros blattfisch e. U.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen




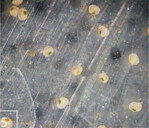






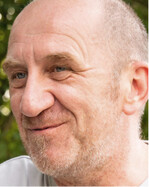





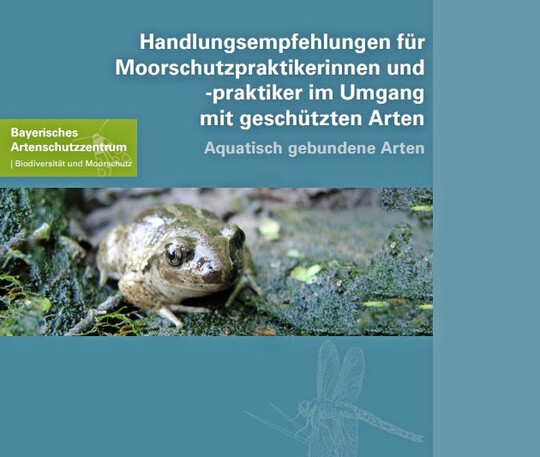



Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.