
Neue umfassende Genomdaten sollen Arten schützen
Wirbellose Bodenlebewesen sind enorm vielfältig und weit verbreitet. Im Ökosystem Boden übernehmen diese Tiere wichtige Aufgaben. Daher rücken sie auch zunehmend in den Blickpunkt von behördlichen Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Boden. Mit dem Projekt „MetaInvert“ stellen Forschende nun umfangreiche genomische Daten zu 232 Arten dieser bisher wenig erforschten Organismen bereit. Die Informationen tragen erheblich zur Identifizierung sowie zum Wissen über Zusammensetzung und Funktion von Gemeinschaften und die Entdeckung evolutionärer Anpassungen an Umweltbedingungen bei.
von Senckenberg/Red erschienen am 19.12.2023Im Projekt arbeiteten die Forschenden vor allem mit Metagenomik und Metatranskriptomik. Der Vorteil der Metagenomik gegenüber DNA- und RNA-basierten Methoden liegt darin, dass die DNA-Fragmente aus einer Probe nach dem Zufallsprinzip sequenziert werden. So werden vorhandene genomische Informationen zur taxonomischen Identifizierung genutzt.
Mittels Metatranskriptomik werden wiederum Gene aufgespürt, die aktiv in Ribonukleinsäuren (RNA) als wichtige Informations- und Funktionsträger einer Zelle umgeschrieben werden und somit laufende biologische Prozesse steuern. Dies gibt Aufschluss über die Stoffwechselaktivität der Mitglieder der Bodengemeinschaft und über funktionelle Veränderungen in diesen Gemeinschaften.
Umfassende Genomsammlungen und -datenbanken bilden laut der Studienautorinnen und -autoren gewissermaßen das „Rückgrat“ dieser beiden Methoden. „Im Rahmen unserer Studie haben wir mit der genomischen Analyse der 232 unterschiedlichen Arten nun eine große genomische Ressource geschaffen, um Einblicke in die Struktur, die Aktivität und die Funktionsweise von Gemeinschaften wirbelloser Bodenbewohner zu gewinnen. Darüber hinaus konnten wir bestätigen, dass Theorien zur Genomevolution nicht über evolutionär unterschiedliche Wirbellosengruppen hinweg verallgemeinert werden können“, so Studienleiter Miklós Bálint.
Mit ihren Ergebnissen wollen die Forschenden dazu beitragen, das Verständnis und den Schutz der biologischen Vielfalt im Boden zu stärken. Die neuen Erkenntnisse und Methoden ermöglichen laut der Studie ein detaillierteres Monitoring sowohl der Zusammensetzung als auch der Funktion von Gemeinschaften. Zudem könnten evolutionäre Anpassungen an veränderte Bodenbedingungen nachvollzogen werden.
Die Studie ist im Journal „Communications Biology“ erschienen. Sie können sie über Webcode NuL4196 herunterladen.







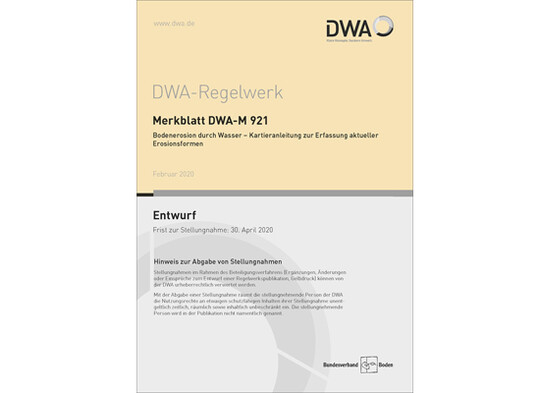


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.