Eine Marke für die Umweltbildung
- Veröffentlicht am

Auf den Spitznamen „Vogelphilipp“ hört Philipp Herrmann schon lange. Den haben ihm Freunde verpasst, weil es in seiner Bezugsgruppe vier Philipps gab. Und da war er, der sich schon als Jugendlicher mit der Vogelbeobachtung beschäftigt hatte, eben der Vogelphilipp. Als sich der heute 39-Jährige dann nach Ausflügen in die Wissenschaft und den behördlichen Naturschutz für die Praxis entschied, war der Spitzname wie dafür gemacht, ein Markenzeichen zu werden. 200 Vogelarten erkennt Herrmann am Gesang. Der Grundstein war bereits mit 11 Jahren gelegt, als der junge Niederbayer ein Fernglas und ein Bestimmungsbuch geschenkt bekam. Wenig später erhielt er dazu noch eine Vogelstimmen-CD. Mit der als Nachtlektüre lernte er die Stimmen im Schlaf.
Er sei in der Natur aufgewachsen, mit Trapperschuhen und Indianeroutfit. Gleichgesinnte habe es wenige gegeben auf dem Land, meint er und erzählt von dem Gründungsversuch einer BUND-Jugendgruppe in der Kleinstadt Vilsbiburg, der schon am ersten Abend endete, weil außer ihm und einem Brüderpaar, deren Eltern BUND-Mitglieder waren, keiner gekommen war. Naturschutz war für die Dorfjugend allenfalls etwas, worüber man sich lustig machte. Herrmann lernte Skateboarden. Das war cooler.
Diese Diskrepanz zwischen Naturbegeisterung und dem Stellenwert dieser Begeisterung in der Gesellschaft treibt Herrmann bis heute um. Letztlich hat sie auch entscheidenden Anteil daran, dass er das tut, was er heute macht. Er will weder für Hochschulschubladen arbeiten noch den Artenrückgang verwalten. Er will, dass der Zugang zu seinem Lieblingsthema „Vögel“ beziehungsweise generell zum Natur- und Artenschutz spielerischer und leichter wird. Er möchte, dass das Thema „cooler“ dargestellt und über moderne Medien transportiert wird.
So entstand vor sechs Jahren die Vogelstimmenhotline, bei der Bürgerinnen und Bürger Vogelgesang als WhatsApp-Sprachnachrichten an den Vogelphilipp schicken können. Der bestimmt die Art und antwortet mit ein paar netten Infos zum Tier.
Die ersten Werbeschilder für seine Aktion hat Herrmann 2016 mit Unterstützung des Bund Naturschutz im Landshuter Stadtpark aufgestellt – eine Sprechblase mit dem Hinweis auf den Service und eine Rufnummer. Nach dem großen Erfolg im ersten Jahr wurde die Aktion zusammen mit dem BUND Naturschutz 2017 in Regensburg, 2018 in Nürnberg und schließlich bayernweit angeboten. In Wirklichkeit kamen die Sprachnachrichten aber aus der ganzen Republik, sogar aus ganz Europa. In diesem Mai hat er als zusätzlichen Service eine Vogelstimmen-Exkursion über den WhatsApp-Status angeboten. Jeden Sonntag gab es über den Messenger-Dienst 5 Minuten mit dem Vogelphilipp, die jedes Mal von circa 1.500 Leuten angesehen wurden. „Wenn ich eine normale Vogelstimmen-Exkursion mache, nehmen immer die gleichen Leute teil“, sagt Herrmann. Aber diese Kombination aus Technik und Natur ermögliche auch Leuten, die nicht gerne früh aufstehen, sich mit Vogelstimmen zu beschäftigen.
So ist es auch mit der Vogelstimmen-Hotline: Es melden sich Kinder, Erzieherinnen, Lehrer und auch ganz viele Leute aus dem Urlaub. Denn dort haben sie mal Zeit und nutzen das Angebot. „Da waren jetzt während der Pandemie immer auch einige dabei, die mit ihren Kindern rausgegangen sind“, erzählt er. Die Kinder seien begeistert dabei, wollten alles wissen und die Erwachsenen mussten feststellen, dass sie viele Fragen nicht beantworten können. 2020 fiel der Start der Vogelstimmen-Hotline mit dem Lockdown zusammen. Viele Leute hat es in die Natur getrieben. Das hat Herrmanns Angebot zusätzlich eine besonders hohe Aufmerksamkeit beschert. Dieses Jahr waren es sogar fast 2.000 Teilnehmer mit 4.500 Einsendungen in einem Monat.
Die Medien finden es cool
Sein erstes Ziel hat der Naturschützer erreicht. „Ich hatte letztes Jahr über 50 Zeitungsartikel und Online-Erwähnungen“, freut sich der Niederbayer über die Resonanz. Vom Bayerischen Rundfunk über die Süddeutsche bis zum Vierbuchstaben-Boulevardblatt – sie alle berichteten über die Hotline und das Gesicht dahinter. Der Satz, dass sich Herrmann schon seit früher Jugend mit Vögeln beschäftigt, passte sogar ins private Frühstücksfernsehen.
Der Vogelphilipp kann darüber nur schmunzeln. Seine Agenda ist, das Thema wohnzimmertauglich zu machen und einer breiten Bevölkerungsgruppe zu erschließen. Platte Anzüglichkeiten sind da allenfalls Nebenwirkungen. „Das ist eine Zielgruppe, die man sonst nicht erreicht. Und das waren auch einige Hundert Nachrichten, die ich da bekommen habe“, freut er sich.
2020 wurde die Vogelstimmenhotline aufgrund ihres Wertes für die „Verbesserung der Artenkenntnis in der Bevölkerung als Schlüssel zur Wertschätzung der biologischen Vielfalt“ im Rahmen der UN-Dekade „Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet. In diesem Jahr verlieh ihm der Förderverein Zentrum-Wald-Forst Holz Weihenstephan e. V. die „Dätzel-Medaille“. Die wird an Menschen verliehen, die sich um das Waldwissen verdient gemacht haben. Seine Aktivitäten finden also bereits weit über die Ornithologenkreise hinaus Anerkennung.
Bis letztes Jahr war er selbst in der Presse aktiv. Für das kostenlos verbreitete Anzeigenblatt „Landshut Aktuell“ der Landshuter Zeitung (Auflage: 114.000 Ex.) verfasste Herrmann zusammen mit Redakteurin Claudia Hagn in drei Jahren über 150 Artikel namens „Wilde Heimat“ und stellte wöchentlich besondere Tiere der Region vor; immer mit Bildern des Fotografen Christoph König geb. Sieradzki. Die kleinen Artikel erfreuten sich großer Beliebtheit und Herrmann erreichten Dankesnachrichten von jungen Leuten, die sogar seine Artikel sammelten.
Sponsor gesucht
Herrmann hat bisher unendlich viele Arbeitsstunden in das Projekt „Vogelphilipp“ gesteckt. Die Vogelstimmenhotline zusammen mit dem BUND Naturschutz wird jedes Jahr mit einem begrenzten Budget unterstützt. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit dem Citizen Science and Arts-Projekt "Dawn Chorus" von der Stiftung Kunst und Natur, dem Biotopia Naturkundemuseum Bayern und dem Max-Planck-Institut für Ornithologie, für das er Vogelstimmen auswerten darf. Alle anderen Aktivitäten darüber hinaus macht Herrmann ehrenamtlich, aus Überzeugung und Freude an der Vermittlung der Vogelkunde. Immer wieder feilt er an neuen Projekten und hat neue Einfälle, wie sich Naturschutzthemen vermitteln lassen. Manche dieser Ideen scheitern jedoch an einer Finanzierung.
So zeigt das Modell Vogelphilipp auch die Probleme auf: Langfristigkeit ist selbst für gute Konzepte nicht gewährleistet. Jedes Jahr muss ein Projekt neu verhandelt werden. Dabei sind die Personalkosten ein ewiges Problem. Auch die töpfe-orientierte staatliche Förderung steckt lieber viel Geld in temporäre Einzelmaßnahmen, als Projekte langfristig zu unterstützen. Damit sie sich politisch verkaufen lassen, müssen sie außerdem innovativ sein am liebsten digital. Für die Vogelerkennungs-App „BirdNET“ etwa, ein KI-Projekt von Prof. Stefan Kahl von der TU Chemnitz zusammen mit der Hochschule Mittweida und der Cornell University in Ithaca/New York, hat der Europäische Sozialfond (ESF) Geld gegeben. App-Entwicklung geht immer. „Das menschliche Ohr ist der Technik aber immer noch einen Schritt voraus! Diese scheitert, sobald mehr als ein Vogel singt“, erklärt Herrmann die Vorteile der analogen Bestimmung und den Wert von echten Artenkennern. Die Arbeit von Menschen zu fördern – damit tut sich die Politik aber deutlich schwerer. Zudem können Einzelpersonen kaum Fördermittel einwerben und jeder Träger von Maßnahmen muss einen Eigenanteil stemmen. Zielorientierung in der Förderung von Naturschutzprojekten darf an vielen Stellen bezweifelt werden.
Marketing das A und O
Umso wichtiger wird für den Naturschutz das Marketing. Das konnte Herrmann bereits bei seiner letzten Aufgabe feststellen und das gilt auch für den Vogelphilipp. „Das war etwa 2014, als ich gemerkt habe, dass dieses Marketing für Naturschutz so wichtig ist, um wahrgenommen zu werden und etwas zu erreichen“, erzählt er. Da war er gerade Gebietsbetreuer der Stadt Landshut. Im Freistaat gab es die Überlegungen, den Naturschutzfond einzudampfen. Ob es weiter Gebietsbetreuer geben würde, stand dabei in Frage. „In der Zeit haben wir in einem sehr kreativen, kleinen Strategieteam die grünen Jacken entworfen, wir haben eine Gebietsbetreuer-Broschüre und ein Logo entwickelt“, blickt er zurück. Und dann habe es den Moment im bayerischen Landtag gegeben, in dem sich plötzlich die Abgeordneten zu „ihren“ Gebietsbetreuern gestellt hatten – obwohl damals Naturschutz in der „Mainstreampolitik“ alles anderes als beliebt war. Aber die in grün gekleideten Gebietsbetreuer hatten Schinken von Weideprojekten und Käse von der Alm mitgebracht. Damit bekam ihre Arbeit etwas Greifbares, Genießbares. „Da habe ich gemerkt, dass Marketing für den Naturschutz genau das ist, was es braucht“, sagt Herrmann, der schon kurz nach dem Abitur vor der Frage stand, ein Clown zu werden und Menschen zu unterhalten oder ein „Naturschutzclown“ zu sein, wie er lachend sagt, und für die gute Sache zu werben. Den „Vogelphilipp“ wieder auszupacken und zu einer Marke für Umweltbildung zu machen, war da ein schlüssiger Schritt. Da gebe es in Großbritannien noch ganz andere Beispiele, etwa David Lindo, der als „The urban Birder“ unterwegs ist und von den Medien unterstützt wird, oder Lucy Lapwing, die mit YouTube-Videos häufige Arten vorstellt und mit „BBC Springwatch“ zusammen arbeitet. Naturschutz müsse einfach cooler werden, lernen, Geschichten zu erzählen. So wie es der DJ Dominik Eulberg in seinem Buch „Mikroorgasmen“ tut. Oder, wie es auch der Filmer und Buchautor Jan Haft in seinem Projekt „Die Wiese – ein Paradies nebenan“ gemacht hat. Für das Buch hat Herrmann nebenbei lektoriert und dem Filmer Brachvogel- und Kiebitznester gesucht, wo dieser seine GoPro für die Aufnahme von Nahszenen aufbauen konnte.
„Ich glaube, dass die Jugendlichen generell keine Lust auf Vereine haben. Da hat keiner mehr Bock, sich zu binden“, fürchtet Herrmann, der sich selbst nicht als „Vereinsmensch“ sieht. Projekte und Medien, die Naturschutz mit niedriger Einstiegsschwelle einer breiten Öffentlichkeit nahebringen, seien wichtiger denn je. Der Vogelphilipp ist so ein Einstiegsangebot.
Und es muss digitaler werden
Daran, dass der Naturschutz die Vorteile der Digitalisierung nutzt, wird auch in der bayerischen Umweltverwaltung gearbeitet. Als Teil eines bayernweiten Teams ist auch die höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Niederbayern vertreten, bei der Herrmann beschäftigt ist. Die Gruppe verwirklicht unter anderem Konzepte, die eine digitale Besucherlenkung ermöglichen sollen (Arbeitstitel „Natur.digital“). Ein weiteres interaktives Citizen-Science Projekt ist übrigens auch dabei: die „Mitmachmöwen“ (https://mitmachmoewen.de). Dieses hat Herrmann zusammen mit seinem Kollegen Stefan Böger aus Mittelfranken entwickelt. Hier können Naturinteressierte anhand der Beringung verfolgen, woher die Lachmöwen stammen, die im Winter in bayerischen Städten unterwegs sind.
---
Philipp Herrmann (39) hat nach Abitur und Zivildienst auf einer Vogelstation in Hamburg sowie zwei Praktika im Naturpark Berchtesgaden und Ghana in Bernburg „Naturschutz und Landschaftsplanung“ auf Diplom studiert und anschließend noch seinen Master gemacht. Für seine Diplomarbeit untersuchte er zusammen mit Michael Stadler die Verbreitung des Gesprenkelten Schlangenskinks in Griechenland und die Lebensweise des bis dahin wenig erforschten Reptils. Dafür wurden sie mit dem Chimaira-Wissenschaftspreis der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ausgezeichnet. Außerdem beobachtete er auf den Falklandinseln die dort heimischen Regenpfeifer und den Einfluss eingeschleppter Ratten auf die Populationen. Praktische Erfahrungen hat er als Gebietsbetreuer für die Stadt Landshut gesammelt. In dieser Eigenschaft war er unter anderem für das Naturschutzgebiet „Ehemaliger Standortübungsplatz mit Isarleite“ verantwortlich. Heute arbeitet Herrmann bei der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Niederbayern u. a. an der Digitalisierung der Besucherlenkung im bayernweiten Natur.digital-Team. Seit kurzem ist Herrmann Beiratsmitglied der Bayerischen Ornithologischen Gesellschaft. Mehr Infos unter: Nul5605
Kontakt

„Der Vogelphilipp“
Philipp Herrmann
- WhatsApp Vogelstimmenhotline: +49160/442 44 50
- Homepage: dervogelphilipp.de
- Facebook: https://www.facebook.com/DerVogelphilipp
- Instagram: https://www.instagram.com/dervogelphilipp
- Email: dervogelphilipp@gmail.com
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen












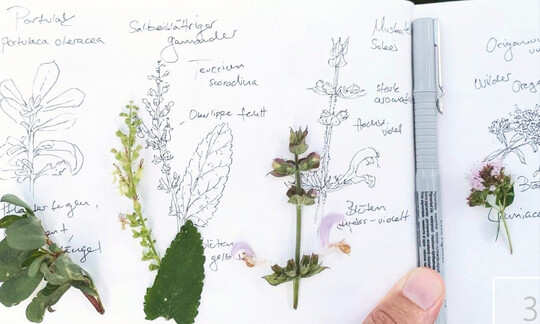


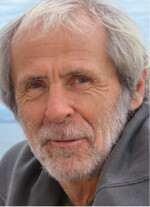


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.