Strukturreiche Weinberge für mehr Vögel und weniger Fraßschäden
Abstracts
Weinanbaugebiete bieten der Avifauna potenziell attraktive Lebensbedingungen: Die Holzstrukturen der Reben, Begrünung zwischen den Rebzeilen sowie ein Mosaik mit angrenzenden ungenutzten Strukturen können für viele Arten geeignete Habitatelemente darstellen. In vielen Fällen jedoch ist der Weinbau von intensiven Managementregimen mit häufigen Störereignissen wie Bodenbearbeitung, Pestizidanwendung und/oder Mahd der artenarm begrünten Gassen und Beseitigung von Randstrukturen geprägt. In einer solcherart intensiv genutzten Landschaft können nur wenige Arten bestehen, die infolge der Strukturarmut und fehlender Alternativen häufig Schäden an den Feldfrüchten verursachen.
Eine Literaturanalyse zeigt, dass mit einem angepassten Management und durch Zulassen von mehr Strukturvielfalt in Form von Bäumen, Sträuchern und artenreichem Grünland nicht nur die Avizönose in Weinanbaugebieten profitieren kann, sondern auch Winzer Vorteile für den Weinanbau haben können.
In Anbetracht des fortschreitenden Biodiversitätsverlustes ist weitere Forschung zu diesem Thema notwendig, um Reblandschaften wieder zu einem attraktiven Lebensraum für Vögel zu gestalten und gleichzeitig Winzern die Vorteile einer strukturreichen Landschaft aufzeigen zu können.
Structural heterogeneity of vineyards for a greater bird variety and less damage to grapes – A literature review on the viticultural relevance of birds in vineyard landscapes
Wine-growing areas can offer potentially attractive living conditions for many birds: the woody structures of the vines, rich inter-row vegetation, and a mosaic with adjacent semi-natural habitats can harbour quite a rich community of species. Vineyards, however, are usually managed intensively with frequent disruptive events, such as intensive tillage, the use of pesticides or mowing of the inter-row vegetation, and the removal of surrounding structures.
The clearing of those structures, and consequently removing foraging and habitat options for many birds, has resulted in the decline of some bird species while favouring the expansion of others. Lacking alternatives, frugivorous bird species can cause great damage to viticulture. Existing studies of birds in vineyards show that the avian community can benefit from wine-growing areas and winegrowers can benefit from richer biodiversity of species by adapting management and allowing more structural diversity in the form of trees, shrubs, and species-rich meadows. Further research on this topic is necessary to understand the effects of wine grape cultivation on avian biodiversity and provide sufficient information to winegrowers on the benefits of ecosystem services provided by higher landscape and species heterogeneity.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Weintrauben stellen eine attraktive Nahrungsquelle für fruchtfressende (frugivore) Tiere dar (Fukuda et al. 2008, Kross et al. 2012, Peisley et al. 2017, Somers & Morris 2002). In den meist als Monokulturen gestalteten Weinbergen sind Weintrauben in einer großen Zahl vorhanden und leicht zugänglich (Boudreau 1972). Auch wenn Vögel generell eher als Nützlinge betrachtet werden, können daher bestimmte Arten große Fraßschäden an den Trauben verursachen. Das Ausmaß dieser Schäden wird nicht allein durch die Umgebungsstrukturen wie Bäume und Sträucher bestimmt (Somers & Morris 2002, Tracey & Saunders 2003). Ausgangspunkt dieses Artikels ist die Hypothese, dass ein gezieltes vogelförderndes Management der Rebflächen und der Weinbaulandschaft dazu beitragen kann, Schäden durch Vögel effektiv zu reduzieren.
Da zum Thema der Strukturwirksamkeit auf Fraßschäden durch Vögel in Reblandschaften noch wenig konkrete Forschungsergebnisse bekannt sind, zeigen sich Winzerinnen und Winzer vielfach verunsichert und wünschen sich, dass die Weinbergslandschaft von allen möglichen Strukturen wie Bäumen und Sträuchern, die für Vögel Aufenthaltsqualität entfalten könnten, befreit wird. Daher lautet das Ziel des vorliegenden Beitrags, durch eine Literaturrecherche die vorliegenden Kenntnisse zu folgenden Fragen zusammenzufassen:
- Wie verhalten sich frugivore Vögel in Weinbergen und welche Strukturen wirken wie auf ihr jeweiliges Raumnutzungsverhalten?
- Welche Managementstrategien können hieraus abgeleitet werden, um Fraßschäden an den Trauben zu verringern, aber auch für den Weinbau möglicherweise wirtschaftlich nützliche Vogelarten zu fördern?
2 Weinbaulich problematische Vogelarten
Vögel sind in allen landwirtschaftlich dominierten Ökosystemen vorhanden und interagieren auf vielen Ebenen mit Feldfrüchten. Das können zum Beispiel das direkte Verzehren der Früchte, die Bestäubung der Blüten oder bei Insektenfressern die Nahrungssuche und damit Schädlingsbekämpfung an der Kulturpflanze sein (Peisley et al. 2017). Die positiven oder negativen Effekte für die Landwirtschaft hängen primär von bestimmten funktionalen Eigenschaften der jeweiligen Vogelart ab (Luck et al. 2015). Das Fressverhalten bildet eine solche funktionale Eigenschaft.
Vogelarten haben verschiedene Ernährungsweisen und stehen hierbei in einem Nahrungsnetz untereinander und zu anderen Tieren und Pflanzen des Ökosystems. Eine intensive landwirtschaftliche Praxis führt jedoch häufig dazu, dass nur bestimmte Arten und somit funktionale Gruppen in der Agrarlandschaft bestehen können. Das Gleichgewicht des Ökosystems wird gestört und viele Ökosystemfunktionen werden somit beeinträchtigt (Collard et al. 2009, Luck et al. 2015). Durch ihre Ernährungsweise können Vögel die Kosten des Anbaus bestimmter Feldfrüchte reduzieren oder den Ertrag erhöhen. Das Vorkommen insektivorer Arten kann zum Beispiel einen reduzierten Einsatz von Pestiziden zur Schädlingsbekämpfung ermöglichen (Peisley et al. 2017).
Vor allem frugivore und granivore (samenfressende) Arten können Schäden an Weintrauben verursachen. Hierzu gehören unter anderem Star (Sturnus vulgaris ), Singdrossel (Turdus philomelos ), Amsel (Turdus merula ), Wacholderdrossel (Turdus pilaris ), Ringeltaube (Columba palumbus ) und Haussperling (Passer domesticus ) (Peisley et al. 2017). Diese Arten bilden nur einen geringen Teil der potenziell in Weinbaulandschaften vorkommenden Avizönosen. Grundsätzlich zählen jedoch auch diese Arten zu den Nützlingen, da sie sich große Teile des Jahres (vor allem während der Jungenaufzucht) insektivor ernähren und somit große Teile von für die Kulturpflanze schädlichen Insekten fressen (Wegner-Kiß 2008, Wenny et al. 2011).
Anders als die anderen Schäden verursachenden Vögel sind Stare dafür bekannt, hohe Verluste an Weintrauben zu bewirken, da sie sich zu Schwärmen zusammenfinden können und als große Gruppe in Weinflächen „einfallen“. Sie suchen ihre Nahrung vielfach ausgehend von Ansitzwarten in angrenzender Vegetation (Somer & Morris 2002), da die Rebflächen an sich oft völlig ungeeignete Lebensbedingungen für Vögel bieten (Pithon et al. 2015).
Aus naturschutzfachlicher Sicht liefert der Star ein typisches Beispiel für den Rückgang ehemals häufiger Vogelarten. Sein Bestand nimmt stetig ab: Trotz eines geschätzten Brutbestands in Deutschland im Zeitraum 2011–2016 von 2,6–3,6 Mio. Revieren hat sich die Population über 36 Jahre (1980–2016) moderat (um 1–3 % p. a.), über 24 Jahre (1992–2016) stark (> 3 % p. a.) und über zwölf Jahre (2004–2016) moderat (um 1–3 % p. a.) reduziert (Gerlach et al. 2019). Der Star ist in der aktuellen Roten Liste der Brutvögel als gefährdet (Kategorie 3: Arten, die merklich zurückgegangen oder durch laufende bzw. absehbare menschliche Einwirkungen bedroht sind; Grüneberg et al. 2015) eingestuft, während er 2007 noch als ungefährdet galt. Als Ursachen gelten Intensivierung und Spezialisierung der Landwirtschaft mit Flächenverlusten von Brachflächen und Grünland sowie mit einem Rückgang der Weidehaltung von Rindern (Craig & Feare 2015). Dieses Beispiel zeigt, dass es bei der Konfliktlösung nicht allein um eine Schadensvermeidung für den Weinbau gehen darf, sondern dass auch die Habitatfunktion von Weinbaulandschaften für gefährdete und geschützte Vogelarten beachtet werden muss.
3 Für den Weinbau nützliche Vogelarten und Strategien zu ihrer Förderung
Alle Vögel übernehmen wichtige Funktionen in Ökosystemen, indem Sie Ökosystemleistungen erbringen, die andernfalls durch hohen Aufwand und Kosten vom Menschen kompensiert werden müssten. Insektenfressende Vögel fungieren als höchst effektive Schädlingsbekämpfer in Agrarsystemen wie dem Weinbau (Assandri et al. 2016) und können eine nachhaltige Lösung zum Schädlingsmanagement liefern (Barbaro et al 2017). Zu den häufigsten insektivoren Vögeln, die aufgrund ihrer Lebensweise (etwa Arten, die Insekten von Blättern absammeln) am stärksten zur natürlichen Schädlingsbekämpfung in Weinanbaugebieten beitragen können (Barbaro et al. 2017), gehören im Weinanbaugebiet Rheingau Blaumeise (Cyanistes caeruleus ), Kohlmeise (Parus major ), Dorngrasmücke (Sylvia communis ), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla ), Amsel (Turdus merula ), Buchfink (Fringilla coelebs ) und Hausrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus ) (Adler, unveröff. Daten). Studien zeigen, dass Vögel die Biomasse der Invertebraten um 20–70 % reduzieren können (Jedlicka et al. 2014). Bei dieser Reduktion von phytophagen Insekten reagiert die Pflanze gleichzeitig mit einem erhöhten Wachstum (Whelan et al. 2008).
Auch granivore (samenfressende) Arten können nützliche Funktionen in landwirtschaftlichen Flächen haben. Zur Bekämpfung von unerwünschten Gräsern durch samenfressende Vögel gibt es wenig Forschung, jedoch zeigen Wenny et al. (2011) ein Beispiel für mögliche Wirkungen dieser Vogelarten auf die Vegetation: In Neuseeland wurden Stieglitze (Carduelis carduelis ) aus ästhetischen Gründen eingeführt. Es zeigte sich, dass diese die Nickende Distel (Carduus nutans ), eine aggressive Weidekrautart, effektiver dezimiert haben als eine speziell als biologischer Pflanzenschutz eingesetzte Rüsselkäferart (Rhinocyllus conicus ) (Wenny et al. 2011).
Das Management des Weinberges kann positive oder negative Auswirkungen auf das Vorhandensein von diesen als nützlich betrachteten (zum Beispiel insektivoren) Vogelarten haben:
Barbaro et al. (2017) wiesen bei einer reduzierten Zeilenbegrünung mehr Vogelarten nach, die Insekten oder Kerne vom Boden absammeln. Dagegen begünstigt eine dichtere Zeilenbegrünung Arten, die Blätter nach Insekten absuchen. Die Autoren schlussfolgern hieraus, dass eine Zeilenbegrünung, die sowohl artenreiche Vegetation als auch freien Boden beinhaltet, höhere Prädationsraten auf Insekten durch Vögel begünstigen. Hier ergänzen sich Vogelarten beider Nahrungsstrategien (Barbaro et al. 2017).
Duarte et al. (2014) untersuchten den Einfluss von Managementstrategien auf das Vorkommen von insektenfressenden Vögeln: Die Häufigkeit, der Artenreichtum und die Diversität aller Vogelarten, aber auch spezifisch die der insektenfressenden Vögel, ist in Rebflächen mit einem mechanischen Management (Mahd) einer naturnahen Vegetation zwischen den Zeilen am höchsten. Chemisch behandelte Rebflächen weisen weit weniger Arten und Individuen auf als mechanisch bearbeitete. Das vogelunfreundlichste Management ist eine begrünungsfreie, umgebrochene Rebfläche. Hier wurden die geringsten Zahlen an Vogelarten und individuen nachgewiesen (Duarte et al. 2014).
Rollan et al. (2019) zeigen in ihrer Studie außerdem, dass eine organische Bewirtschaftung der Rebflächen sowohl die Individuenzahl der insektenfressenden Vögel als auch der Vögel, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, steigern kann.
Eine wichtige Strategie zur Förderung von nützlichen Vögeln kann das Anbringen von Nisthilfen darstellen (Lindell et al. 2016). Das Angebot von Nistkästen in Weinbergen kann die Vielfalt der vorkommenden insektenfressenden Vogelarten um bis zu 50 % und die Anzahl dieser Vögel um bis zu 200 % steigern (Jedlicka et al. 2011). Diese Vögel können aufgrund der hierdurch geschaffenen Bruthabitate für Weinbaubetriebe Ökosystemleistungen wie die Schädlingsbekämpfung übernehmen. Eine Studie aus Spanien kommt zu dem Ergebnis, dass in Bereichen mit Brutvorkommen von Vögeln in künstlichen Nisthilfen die Prädationsraten auf Raupen um ein Drittel höher waren als in Bereichen ohne Nistkästen (Rey Benayas et al. 2017). Jedlicka et al. (2011) weisen in ihrer Studie in Kalifornien sogar nach, dass durch die Installation von Nistkästen 3,5-mal mehr Larven im Umkreis dieser Kästen von den Vögeln entfernt wurden als in Vergleichsflächen ohne Nistkästen.
Nisthilfen für Eulenvögel können maßgeblich zur Reduktion der Nagerpopulation im Weinberg beitragen. Wendt & Johnson (2017) begleiteten Winzer in Kalifornien bei der Anbringung von 297 Nisthilfen für die Schleiereule (Tyto alba ). Bis zum Ende der Untersuchung waren etwa ein Drittel der Nisthilfen von Eulen belegt. Schleiereulen verzehren ca. 2.000–3.000 Nagetiere pro Jahr (Browning 2014) und tragen wahrscheinlich durch ihre erhöhte Anwesenheit in den Rebflächen zur Schädlingsbekämpfung bei (Wendt & Johnson 2017). In Deutschland kommen als förderfähige Eulenarten besonders die Schleiereule in Gebäuden der Dörfer und in freistehenden Bauwerken, der Steinkauz (Athene noctua ) im Falle von alten Streuobstbeständen in und um Weinbergen und der Waldkauz (Strix aluco ) bei älteren benachbarten Baum- bzw. Waldrandbeständen infrage. Letzterer nutzt auch 50–75 cm über die Umgebung herausragende Ansitze zur Jagd (Wendland 1963) und kann über deren Angebot in die Weinberge gelockt werden.
Durch welche Maßnahmen als nützlich erachtete Vogelarten in Reblandschaften gefördert werden und welche Vorteile diese für den Weinbau haben könnten, ist in Tab. 1 anhand verschiedener Quellen zusammengefasst.
4 Einflüsse von Habitatstrukturen auf Fraßschäden durch Vögel in Rebflächen
Wirksame Schutzmaßnahmen gegen Fraßschäden an Trauben sind meist kosten- und arbeitsintensiv. Landwirte und Winzer können zwar aus Erfahrung von Schäden aus vorherigen Jahren Standorte identifizieren, die stärker als andere betroffen sind, suchen aber häufig vergeblich nach konkreten Mustern (Somers & Morris 2002). Tracey & Saunders (2003) befragten in Australien Winzer zu ihren Erfahrungen zu Vogelfraßschäden an Weintrauben: Als die größten Einflussfaktoren, die zu erhöhtem Vogelfraß an Trauben führten, nannten sie eine verlängerte Reifephase sowie angrenzende Bäume und Vegetation. Studien zu diesem Thema zeigen jedoch ein anderes Bild (Abb. 3):
Vor allem Arten, die vorwiegend in der offenen Landschaft vorkommen, können große Schäden an Trauben verursachen; Arten, die von Gehölzstrukturen profitieren, bewirken hingegen wenig Schäden und tragen vor allem zur natürlichen Schädlingsbekämpfung bei (Jedlicka et al. 2014).
Mit steigendem Waldanteil in der Landschaft werden weniger Schäden durch frugivore Vögel an anderen Früchten (Kirschen) verursacht (Lindell et al. 2016).
Andere Landschaftsstrukturen werden schon seit Langem als Einflussfaktoren für das Ausmaß der Schäden an Wein beschrieben (zum Beispiel Stromleitungen oder Totholz) (Boudreau 1972). Das Vorhandensein von solchen Strukturen kann es den Vögeln zwar vereinfachen, an Trauben zu gelangen, Vögel sind jedoch höchst mobil und können, wenn wenig andere Möglichkeiten bestehen, weite Strecken zwischen attraktiven Futterstellen (Weintrauben) und Strukturen zum Aufenthalt zurücklegen. Sobald Futterstellen zum limitierenden Faktor werden, nutzen die Tiere auch andere Strukturen zum Verweilen, sodass die Reduktion von Vegetation zur Vorbeugung von Fraßschäden wenig Erfolg versprechen dürfte (Tracey & Saunders 2003).
Dagegen zeigen Barbaro et al. (2017) in ihrer Studie, dass Häufigkeit und Diversität von insektenfressenden Vögeln in strukturreichen Landschaften generell zunehmen. Vor allem semi-natürliche Habitate wie Gehölze, Gebüsche, Wiesen und Bäume in der Landschaft führen dazu, dass sich viele Vögel und auch die Insektenfresser in der Kulturlandschaft ansiedeln können. Hierzu gehören auch Arten, die Blätter von Insekten (auch Schädlingen) befreien. Diese Arten können also wahrscheinlich in Weinanbaugebieten mit vielen semi-natürlichen Habitaten mehr zur natürlichen Schädlingsbekämpfung in Weinflächen beitragen (Barbaro et al. 2017) als in ausgeräumten Landschaften.
Auch eine artenreiche Zeilenbegrünung trägt zur funktionalen Diversität von Vögeln bei (verschiedene Arten, die in sogenannte Gilden zusammengefasst werden können, welche bestimmte ökologische Funktionen erfüllen, siehe oben; Barbaro et al. 2017, Rollan et al. 2019).
Einen großen Einfluss auf das Ausmaß von Fraßschäden an Trauben hat die generelle Futterverfügbarkeit in der Landschaft (Lindell et al. 2018). In Regionen mit einem geringen Nahrungsvorkommen in Form von anderen Früchten sind Fraßschäden durch Vögel wahrscheinlicher (Lindell et al. 2016 aus Johnson et al. 1989). Befinden sich die Anbauflächen von Früchten in einer Region mit alternativen Nahrungsquellen, wie zum Beispiel Getreide oder Silage, kann dies aber auch dazu führen, dass größere Populationen von fruchtfressenden Vögeln wie etwa dem Star vorkommen und diese somit bei Fruchtreife mehr Schäden verursachen können (Lindell et al. 2016).
Lindell et al. (2018) zeigen weiter, dass vor allem die Unterschiede verschiedener Jahre (abiotische Faktoren wie Temperatur, Regen oder Ähnliches) für das Ausmaß von Vogelfraßschäden verantwortlich sind. Ein Jahr mit guten Bedingungen für eine reiche Weintraubenernte begünstigt auch andere Nahrungsangebote der Umgebung. Vögel finden Futterplätze im Überfluss und sind nicht auf vom Menschen geschaffene Nahrungsquellen angewiesen. Dieser Effekt überwiegt in dieser Studie auch den Einfluss von Waldflächen in der Umgebung und zeigt, dass in generell schlechten Erntejahren mehr in Vogelschutz investiert werden muss als in guten (Lindell et al. 2018).
Innerhalb der Rebfläche können unterschiedliche Präferenzen zum Fraßverhalten der schadenverursachenden Vögel nachgewiesen werden, die vor allem aufzeigen können, wo eine gezielte Vogelabwehr, zum Beispiel durch Netze, am sinnvollsten ist. Weintraubenschäden sind im Randbereich der Rebflächen am häufigsten anzutreffen, je weiter die Rebe in der Mitte der Fläche steht, desto weniger Schäden werden die hier reifenden Beeren durch Vögel erfahren (Somers & Morris 2002).
Tracey & Saunders (2003) stellen fest, dass kleinere Rebflächen anfälliger für Vogelschäden an den Trauben sind als größere Flächen. Sie vermuten, dass dieser Effekt auf die erhöhte Rand-zu-Innenfläche-Verteilung zurückzuführen ist: Kleine Flächen haben überproportional mehr Randflächen als große. Viele Vögel fressen bevorzugt Trauben am Rand der Fläche. An der Weinrebe weiter oben hängende Weintrauben werden von beerenfressenden Vögeln bevorzugt und sind schadanfälliger als näher am Boden hängende (DeHaven 1974, Somers & Morris 2002). Hier spielt wahrscheinlich auch die Belaubung eine kritische Rolle. Eine ausgeprägte Belaubung der Rebe und somit für die Vögel nicht ganz einfach zugängliche Trauben führt dazu, dass vor allem Finken, aber auch andere Vögel Interesse an den Trauben verlieren (Boudreau 1972). Dagegen nutzen Stare eine ausgeprägte Belaubung gerne als Schattenspender und bleiben somit länger in den Rebflächen als bei starker Sonnenexposition (Boudreau 1972) – Faktoren, auf die der Weinbau durch das Laubwandmanagement aktiv Einfluss nimmt.
Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass Rebsorten mit dunkleren Trauben bei Vögeln in Kalifornien beliebter sind als hellere und diese somit eher geschützt werden sollten (DeHaven 1974). Stare beginnen bereits an unreifen Trauben Schäden zu verursachen, diese erreichen jedoch in den letzten zwei Wochen vor der Lese ihr Maximum. Schutzmaßnahmen sollten entsprechend spätestens zwei Wochen vor Ernte begonnen werden (Somers & Morris 2002).
5 Maßnahmen zum Schutz der Trauben gegen Vogelfraß
Vogelfraßschäden an Weintrauben können kostspielig sein. Gleichzeitig werden viele verfügbare Schutzmaßnahmen von Winzern als vollkommen oder größtenteils ineffektiv beschrieben (Anderson et al. 2013). Diese Einschätzung stützen Studien zu diesem Thema: Visuelle Vogelschrecke wie Ballons (Fukuda et al. 2008), Methylanthranilat-Spray (ein Spray, das von Vögeln eingeatmet oder durch das Fressen der Trauben konsumiert wird und anschließend eine Irritation bei den Vögeln auslöst) und Inflatable Tube Man (eine Art Vogelschrecke, bestehend aus einem großen Schlauch, der sich durch ein Gebläse bewegt) (Lindell et al. 2018) wurden als vollkommen ineffektiv zur Vogelabwehr beschrieben.
Das Abspielen von Warnrufen beerenfressender Vögel kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen: Berge et al. (2007) konnten durch den Einsatz von einer Kombination aus Star-, Drossel- und Finken-Alarmrufen die Vogelschäden an Trauben im ersten Einsatzjahr erheblich reduzieren. Jedoch gewöhnen sich die Vögel schnell an die neuen Situationen und merken, dass trotz Rufen keine Gefahr droht (Harris & Davis 1998). Solche Aufnahmen sind also nur über eine kurze Dauer effektiv und müssten ständig betreut und im Raum bewegt werden, um wirksam zu sein (Harris & Davis 1998). Ähnliche Ergebnisse erzielen Schreckschussanlagen (Tracey et al. 2007).
Als anerkannte und effektivste Strategien zum Schutz vor Vogelfraß gelten Rebschutznetze (Anderson et al. 2013, Berge et al. 2007; Abb. 4).: „Müssen Starenschwärme abgewehrt werden, sind Rebschutznetze eine sehr effektive Maßnahme“ (Schiefer 2020). Bei der Abwehr von Standvögeln wie Amseln kann es sich lohnen, an Waldrändern oder größeren Hecken die ersten Rebzeilen einzunetzen, da die Standvögel von der Seite her einfliegen. Netze müssen jedoch täglich auf Vögel kontrolliert werden, die sich in den Maschen verheddern können (Schiefer 2020). Diese Methode ist durch die hohen Installations- und Pflegekosten somit nur bedingt rentabel (Anderson et al. 2013).
Alternativen zu konventionellen Schutzmethoden können Sitzstangen für Greifvögel bieten. Diese können den Vogelfraß in ihrer direkten Umgebung um mehr als 50 % reduzieren (Peisley et al. 2017). Solche Ansitze müssen aber nicht zwingend durch Greifvögel genutzt werden, um effektiven Schutz vor frugivoren Vögeln bieten zu können. Denn auch Rabenvögel nutzen diese und können durch ihre Anwesenheit nachweislich die Schäden an Trauben reduzieren (Peisley et al. 2017).
Eine bis heute wenig erforschte Methode ist die Förderung natürlicher Feinde beerenfressender Vögel. Kross et al. (2011) untersuchen, wie sich das Vorkommen des in Neuseeland endemischen und vorwiegend Vögel erbeutenden Maorifalken (Falco novaeseelandiae ) auf das Vorkommen von frugivoren Vögeln auswirkt. Gleichzeitig analysieren sie Traubenschäden, die in Rebflächen mit und ohne Falkenvorkommen auftraten. In Flächen mit Falken wurden 95 % weniger Trauben von Vögeln komplett entfernt und 55 % weniger Trauben angepickt, was eine signifikante Reduktion der allgemeinen Fraßschäden bedeutet und Winzern erhebliche Kosten erspart (Kross et al. 2011). Auch in Deutschland gibt es Arten, die diese Rolle des natürlichen Feindes übernehmen und somit zur Abschreckung von frugivoren Vögeln in Rebflächen beitragen können – insbesondere trifft das für Wanderfalke (Falco peregrinus ), Habicht (Accipiter gentilis ) und in deckungsreichen, waldnah gelegenen Flächen für den Sperber (Accipiter nisus ) zu. Habicht und Sperber jagen bevorzugt aus dem Hinterhalt und benötigen hierzu Deckung in Form von einer dichten Vegetation (Glutz von Blotzheim 1989/2001). Sie sind somit kaum durch Ansitzstangen in die Rebflächen zu locken.
6 Empfehlungen für das Landschaftsmanagement
Vögel können je nach Nahrungsstrategie wichtige Schädlingsbekämpfer sein oder selbst zum Schädling werden. Eine strukturreiche Kulturlandschaft kann verhindern, dass nur wenige Arten in sehr hohen Zahlen vorkommen und große Schäden verursachen. Um Winzerinnen und Winzern Empfehlungen geben zu können, wie sie einerseits Schädlingsvögel von ihren Flächen fernhalten und gleichzeitig Nützlingen einen geeigneten Lebensraum bieten können, bedarf es weiterer Forschung. Folgende Strategien zeigen sich vor dem Hintergrund der existierenden Literatur als erfolgversprechend:
1. Anfällige Flächen identifizieren und gezielt handeln
Effektive Schutzmaßnahmen und -vorrichtungen können sehr teuer sein und stehen nicht immer in einem angebrachten Verhältnis zum tatsächlichen Schaden durch Vögel. Eine systematische Einschätzung des konkreten Schadens, der durch Vögel verursacht wird, kann dazu beitragen, solche Flächen zu identifizieren, die besonders anfällig sind. Hier können im Idealfall auch die Hauptverursacher festgestellt und die Schutzstrategie entsprechend dem Fressverhalten angepasst werden (Somers & Morris 2002). Weiterhin sollte in schlechten Erntejahren mit mehr Schäden in Relation zur Ernte gerechnet und stärker in Schutzvorrichtungen investiert werden als in guten (Jedlicka et al. 2014).
2. Vegetation in der und um die Rebfläche fördern
Eine artenreiche Zeilenbegrünung, die mechanisch (Mähen oder besser noch Walzen) statt chemisch bearbeitet wird, begünstigt das Vorkommen und die Vielfalt von insektenfressenden Vögeln (Duarte et al. 2014). Für die Förderung der besonders stark vom Artenrückgang betroffenen Offenlandspezialisten ist das Anlegen und Erhalten von artenreichen Weiden und Wiesen eine wichtige Maßnahme (Pithon et al. 2015). Bäume, Sträucher und Hecken sind nicht nur wichtige Lebensräume für viele Tierarten, sondern können verschiedene Gegenspieler in der Kulturlandschaft maßgeblich fördern. Das Entfernen solcher Strukturen zur Vorbeugung von Fraßschäden ist wenig aussichtsreich – ganz im Gegenteil kann das Erhalten und Fördern von Gehölzstrukturen in der Landschaft vielen insektivoren Arten geeignete Lebensräume bieten und somit bei der natürlichen Schädlingsbekämpfung helfen (Jedlicka et al. 2014).
Zu beachten sind hier allerdings mögliche Wirkungen fruchttragender Gehölzarten als Wirtspflanzen oder semi-natürlicher Habitate als Überwinterungsgebiet für die invasive Kirschessigfliege (Drosophila suzukii ). Diese verursacht vor allem Schäden an einer großen Zahl von dünnhäutigen Früchten und kann außer im Obstbau auch im Weinbau Ernteverluste verursachen (Santoiemma et al. 2019). Literatur zu diesem Thema zeigt, dass semi-natürliche Landschaftselemente wie Wald, Feldgehölze und Hecken der Kirschessigfliege, die vor allem feuchte und kühle Umweltbedingungen bevorzugt, nicht nur eine gute Nahrungsgrundlage, sondern auch eine gute Habitatqualität bieten können (Haro-Barchin et al. 2018). Aufgrund der hohen Mobilität und Reproduktionsraten dieser Art stellt ein Eliminieren dieser Strukturen aus der Weinbergslandschaft jedoch keine geeignete Bekämpfungsmaßnahme dar (Santoiemma et al. 2018, 2019). Diese Strukturen spielen darüber hinaus eine fundamentale Rolle in der Stärkung natürlicher Feinde (Haro-Barchin et al. 2018). In Europa sind derzeit nur wenige parasitoide Arten bekannt, die die Populationsdichte der invasiven Kirschessigfliege maßgeblich dezimieren können (Chabert et al. 2012). Doch nur naturnahe Strukturen können solchen Arten in Agrarlandschaften potenziell die Möglichkeit bieten, sich anzusiedeln, sich zu vermehren und als natürliche Antagonisten zu agieren (Santoiemma et al. 2019). Daher sollten aus weinbaulicher Sicht keine ernsten Argumente gegen einen intensiven Biotopverbund innerhalb der Weinbaulandschaften oder gegen Maßnahmen zur ausgeprägten Förderung der Biodiversität sprechen; die durch frühere Flurneuordnungen erfolgte Ausräumung und Monotonisierung vieler Reblandschaften sollte sukzessive umgekehrt werden.
3. Randbereiche schützen
Schäden durch Vögel in Randbereichen der Rebfläche sind wahrscheinlicher als in der Innenfläche. Schutzmaßnahmen der Trauben gegen Vogelfraß sollten vor allem in solchen schadanfälligeren Bereichen eingesetzt werden, sodass Abwehrmaßnahmen insgesamt effektiver gestaltet werden können (Somers & Morris 2002).
4. Nist- und Ansitzhilfen für Sing- und Greifvögel
Eine Strategie zur Förderung von nützlichen Vögeln kann das Anbringen von Nistkästen darstellen. Viele insektenfressende Vögel benötigen Bruthöhlen zur Aufzucht ihrer Küken. Das Anbringen von Bruthöhlen für Singvögel kann die Populationsdichte insektivorer Vögel steigern und somit die Anzahl der Schädlingsinsekten reduzieren. Das Anbringen von Nisthilfen für Eulenvögel kann der natürlichen Bekämpfung von wurzel- und beerenfressenden Nagern dienen und auch anderen Greifvögeln sowie Rabenvögeln kann durch Aufstellen von Sitzstangen eine Ansitzmöglichkeit zur Jagd von Nagern und Vögeln geboten werden.
7 Forschunsgsdefizite
Mit steigendem Bewusstsein für die Umwelt und Biodiversität in Anbetracht des fortschreitenden Klimawandels sind Konsumenten bereit, mehr Geld für nachhaltig erzeugte, hochwertige Produkte wie Wein auszugeben (Sellers 2016). In der Folge zeigen auch mehr Winzerinnen und Winzer den Willen, biodiversitätsfördernde Anbaumethoden zu implementieren (Rollan et al. 2019). Um hier klare Empfehlungen geben zu können, welche Strategien nicht nur der Umwelt förderlich sind, sondern gleichzeitig positive Effekte für den Weinbau haben können (wie zum Beispiel die Bereitstellung von Ökosystemleistungen), bedarf es verstärkter Forschung in diesem Bereich. Die Klärung folgender Forschungsfragen hat sich bei der Literaturrecherche als vordringlich erwiesen:
- Welche Strukturwirksamkeit entfalten angrenzende semi-natürliche Habitate auf Fraßschäden durch Vögel in Reblandschaften? Auf welche Bereiche fokussieren Vögel ihren Nahrungserwerb im Weinberg?
- Welche Rolle spielen verschiedene Weinbaumethoden für die Gildenstruktur der Avizönosen? Können mit bestimmten Methoden (wie zum Beispiel Minimalschnitt oder ökologische Bewirtschaftung) vor allem insekten- und samenfressende Vögel gefördert werden?
- Welche Vogelarten übernehmen in welchem Umfang wichtige Ökosystemleistungen in Reblandschaften?
- Wie wirkt sich das sonstige Nahrungsangebot in Reblandschaften auf das Vorkommen und den Grad der Schäden durch Vögel an Trauben aus?
- Lassen sich die dargestellten, vor allem in Nordamerika gewonnenen Forschungsergebnisse zu Nisthilfen in Europa und insbesondere in Deutschland bestätigen?
Literatur
Anderson, A., Lindell, C.A., Moxcey, K.M., Siemer, W.F., Linz, G.M., Curtis, P.D., Carroll, J.E., Burrows, C.L., Boulanger, J.R., Steensma, K.M.M., Shwiff, S.A. (2013): Bird damage to select fruit crops: The cost of damage and the benefits of control in five states. Crop Protection 52, 103-109. DOI: 10.1016/j.cropro.2013.05.019.
Assandri, G., Bogliani, G., Pedrini, P., Brambilla, M. (2016): Diversity in the monotony? Habitat traits and management practices shape avian communities in intensive vineyards. Agriculture, Ecosystems & Environment 223, 250-260. DOI: 10.1016/j.agee.2016.03.014.
Barbaro, L., Rusch, A., Muiruri, E.W., Gravellier, B., Thiery, D., Castagneyrol, B. (2017): Avian pest control in vineyards is driven by interactions between bird functional diversity and landscape heterogeneity. J. Appl. Ecology 54 (2), 500-508. DOI: 10.1111/1365-2664.12740.
Berge, A., Delwiche, M., Gorenzel, W.P., Salmon, T. (2007): Bird Control in Vineyards Using Alarm and Distress Calls. American Journal of Enology and Viticulture 58 (1), 135-143. Boudreau, G. (1972): Factors related to bird depredations in Vineyards. USDA National Wildlife Research Center – Staff Publications, Paper 392, 136-139.
Browning, M. (2014): Barn Owl Box Company [WWW Document]. Barn Owl Box Co. Online verfügbar unter URL http://www.barnowlbox.com (letzter Zugriff am 25.08.2020).
Chabert, S., Allemand, R., Poyet, M., Eslin, P., Gibert, P. (2012): Ability of European parasitoids (Hymenoptera) to control a new invasive Asiatic pest, Drosophila suzukii. Biological Control 63 (1), 40–47. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2012.05.005.
Collard, S., Le Brocque, A., Zammit, C. (2009): Bird assemblages in fragmented agricultural landscapes: the role of small brigalow remnants and adjoining land uses. Biodivers. Conserv. 18 (6), 1649–1670. DOI: 10.1007/s10531-008-9548-4.
Craig, A., Feare, C. (2015): Common Starling (Sturnus vulgaris): In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A., de Juana, E., (Hrsg.), Handbook of the Birds of the World Alive, Lynx Edicions, Barcelona. Zitiert in: BirdLife International, 2021, Species factsheet: Sturnus vulgaris. Download: www.birdlife.org (letzter Zugriff am 30.01.2021).
DeHaven, R.W. (1974): Bird damage to wine grapes in central California, 1973. In: Johnson, W.V., Marsh, R.E. (Hrsg.), Proceedings of the 6th Vertebrate Pest Conference, Paper 9. Download: http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/9 (letzter Zugriff am 30.01.2021).
Duarte, J., Farfán, M.A., Fa, J.E., Vargas, J.M. (2014): Soil conservation techniques in vineyards increase passerine diversity and crop use by insectivorous birds. In: Bird Study 61 (2), 193-203. DOI: 10.1080/00063657.2014.901294.
Fukuda, Y., Frampton, C.M., Hickling, G.J. (2008): Evaluation of two visual birdscarers, the Peaceful Pyramid® and an eye-spot balloon, in two vineyards. New Zealand Journal of Zoology 35 (3), 217- 224. DOI: 10.1080/03014220809510117.
Gerlach, B., Dröschmeister, R, Langgemach, T., Borkenhagen, K., Busch, M., Hauswirth, M., Heinicke, T., Kamp, J., Karthäuser, J., König, C., Markones, N., Prior, N., Trautmann, S., Wahl, J., Sudfeldt, C. (2019): Vögel in Deutschland – Übersichten zur Bestandssituation. DDA, BfN, LAG VSW, Münster.
Glutz von Blotzheim, U.N. (Hrsg., 1989/2001): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Das größte elektronische Nachschlagewerk zur Vogelwelt Mitteleuropas. Unter Mitarbeit von Ralf Wassmann. Lizenzausg., Vogelzug Verlag im Humanitas Buchversand GmbH, Wiebelsheim.
Grüneberg, C., Bauer, H.-G., Haupt, H., Hüppop, O., Ryslavy, T., Südbeck, P. (2015): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. Ber. Vogelschutz 52, 19-67.
Haro-Barchin, E., Scheper, J., Ganuza, C., Groot, G.A., Colombari, F., van Kats, R., Kleijn, D. (2018): Landscape-scale forest cover increases the abundance of Drosophila suzukii and parasitoid wasps. Basic and Applied Ecology 31 (1), 33-43. DOI: 10.1016/j.baae.2018.07.003.
Harris, R.E., Davis, R.A. (1998): Evaluation of the efficacy of products and techniques for airport bird control. Aerodrome Safety Branch, Transport Canada, Ottawa, Canada, 107 S.
Jedlicka, J.A., Greenberg, R., Letourneau, D.K. (2011): Avian conservation practices strengthen ecosystem services in California vineyards. PloS one 6 (11), e27347. DOI: 10.1371/journal.pone.0027347.
–, Greenberg, R., Raimondi, P.T. (2014): Vineyard and riparian habitat, not nest box presence, alter avian community composition. The Wilson Journal of Ornithology 126 (1), 60-68. DOI: 10.1676/13-058.1.
Kross, S.M., Tylianakis, J.M., Nelson, X.J. (2011): Effects of introducing threatened falcons into vineyards on abundance of passeriformes and bird damage to grapes. Conservation Biology 26 (1), 142-149. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2011.01756.x.
Lindell, C., Hannay, M., Hawes, B. (2018): Bird Management in Blueberries and Grapes. Agronomy 8 (12), 295, 16 S. DOI: 10.3390/agronomy8120295.
Lindell, C.A., Steensma, K.M.M., Curtis, P.D., Boulanger, J.R., Carroll, J.E., Burrows, C., Lusch, D.P., Rothwell, N.L., Wieferich, S.L., Henrichs, H.M., Leigh, D., Eaton, R.A., Linz, G.M. (2016): Proportions of bird damage in tree fruits are higher in low-fruit-abundance contexts. Crop Protection 90, 40-48. DOI: 10.1016/j.cropro.2016.08.011.
Luck, G.W., Hunt, K., Carter, A. (2015): The species and functional diversity of birds in almond orchards, apple orchards, vineyards and eucalypt woodlots. Emu – Austral. Ornithology 115 (2), 99-109. DOI: 10.1071/MU14022.
Peisley, R.K., Saunders, M.E., Luck, G.W. (2017): Providing perches for predatory and aggressive birds appears to reduce the negative impact of frugivorous birds in vineyards. Wildl. Res. 44 (4), 334- 342. DOI: 10.1071/WR17028.
Pithon, J.A., Beaujouan, V., Daniel, H., Pain, G., Vallet, J. (2016): Are vineyards important habitats for birds at local or landscape scales? Basic and Applied Ecology 17 (3), 240-251. DOI: 10.1016/j.baae.2015.12.004.
Rey Benayas, J.M., Meltzer, J., Las Heras-Bravo, D. de, Cayuela, L. (2017): Potential of pest regulation by insectivorous birds in Mediterranean woody crops. PloS one 12 (9), e0180702. DOI: 10.1371/journal.pone.0180702.
Rollan, À., Hernández-Matías, A., Real, J. (2019): Organic farming favours bird communities and their resilience to climate change in Mediterranean vineyards. Agriculture, Ecosystems & Environment 269, 107-115. DOI: 10.1016/j.agee.2018.09.029.
Santoiemma, G., Mori, N., Tonina, L., Marini, L. (2018): Semi-natural habitats boost Drosophila suzukii populations and crop damage in sweet cherry. Agriculture, Ecosystems & Environment 257, 152- 158. DOI: 10.1016/j.agee.2018.02.013.
–, Trivellato, F., Caloi, V., Mori, N., Marini, L. (2019): Habitat preference of Drosophila suzukii across heterogeneous landscapes. J. Pest. Sci. 92 (2), 485-494. DOI: 10.1007/s10340-018-1052-3.
Schiefer, H.-C. (2020): Wild- und Vogelabwehr im Weinbau.
Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, Hrsg., Mskr., 9 S. Download: https://docplayer.org/185661742- Wild-und-vogelabwehr-im-weinbau.html (letzter Zugriff am 30.01.2021).
Sellers, R. (2016): Would you Pay a Price Premium for a Sustainable Wine? The Voice of the Spanish Consumer. Agriculture and Agricultural Science Procedia 8 (4), 10-16. DOI: 10.1016/j.aaspro.2016.02.003.
Somers, C.M., Morris, R.D. (2002): Birds and wine grapes: foraging activity causes small-scale damage patterns in single vineyards. J. Appl. Ecology 39 (3), 511-523. DOI: 10.1046/j.1365- 2664.2002.00725.x.
Tracey, J., Saunders, G. (2003): Bird damage to the wine grape industry. Report to the Bureau of Rural Sciences, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. [Orange, N.S.W.?]: Vertebrate Pest Research Unit, NSW Agriculture.
–, Bomford, M., Hart, Q., Saunders, G., Sinclair, R. (2007) Managing Bird Damage to Fruit and Other Horticultural Crops. In: Bureau of Rural Sciences, Canberra.
Wegner-Kiß, G. (2008): Traubenfraß und seine Ursachen. Der Badische Winzer 8/2008, 17-19.
Wendland, V. (1963): Fünfjährige Beobachtungen an einer Population des Waldkauzes (Strix aluco) im Berliner Grunewald. .J. Ornithol. 104, 23-57. DOI: 10.1007/BF01677677.
Wendt, C.A., Johnson, M.D. (2017): Multi-scale analysis of barn owl nest box selection on Napa Valley vineyards. Agriculture, Ecosystems & Environment 247, 75-83. DOI: 10.1016/j.agee.2017.06.023.
Wenny, D.G., DeVault, T.L., Johnson, M.D., Kelly, D., Sekercioglu, C.H., Tomback, D.F., Whelan, C.J. (2011): The Need to Quantify Ecosystem Services Provided by Birds. The Auk 128 (1), 1-14. DOI: 10.1525/auk.2011.10248.
Whelan, C.J., Wenny, D.G., Marquis, R.J. (2008): Ecosystem services provided by birds. Annals of the New York Academy of Sciences 1134, 25-60. DOI: 10.1196/annals.1439.003.
Fazit für die Praxis
- Durch die Förderung einer raumstrukturell diversen Vegetation in der Rebfläche und deren Umfeld können nicht nur viele Vogelarten profitieren, sondern diese Arten können zugleich auch wichtige Ökosystemleistungen für den Weinbau übernehmen. Habitatstrukturen in der Reblandschaft zu eliminieren wirkt hingegen kontraproduktiv.
- Randbereiche sind vor allem bei kleinen Rebflächen besonders anfällig für Schäden durch Vögel. Diese sollten bei Bedarf besonders geschützt werden.
- Alternativen wie Nist- und Ansitzhilfen für Sing- und Greifvögel schaffen Habitatelemente für wichtige Arten und locken natürliche Schädlingsbekämpfer in die Rebflächen.
Kontakt

Katharina Adler ist seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Landschaftsplanung und Naturschutz der Hochschule Geisenheim University und fertigt hier ihre Promotion zu Vogeldiversität in deutschen Weinanbaugebieten an. Studium der Biologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Von Katharina Adler und Eckhard Jedicke
Eingereicht am 10. 02. 2021, angenommen am 10. 03. 2021
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen














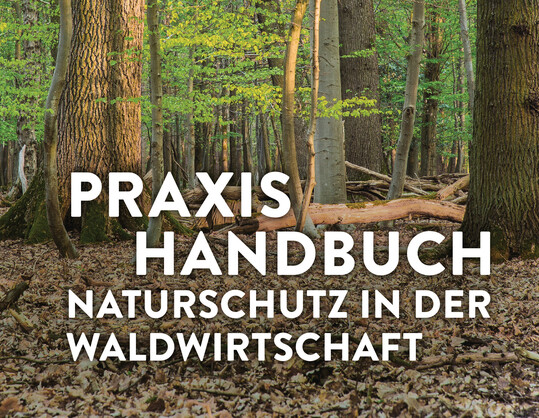
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.