Müssen Faunakartierende auch das Wetter erfassen?
Abstracts
Erfassung und Erfassbarkeit von Tierarten unterliegen zahlreichen Einflussfaktoren, zu denen auch Wetter oder Witterung zählen. Hierauf sowie auf damit verbundene Aspekte von Kartierung und Kartiervorgaben wird exemplarisch eingegangen. Die Frage nach einer genügenden Erfassung ist letztlich an der tatsächlich im Gelände festgestellten Aktivität beziehungsweise den Artnachweisen zu messen. Die eigenen Erfahrungswerte der kartierenden Person zur Auswahl der Kartiertermine und -bedingungen sowie ihre eigene Bewertung der ermittelten Daten sind dabei entscheidend. In der Praxis ist eine Differenzierung angebracht: Für Standarduntersuchungen etwa zur Brutvogel-, Reptilien- oder Tagschmetterlingsfauna im Rahmen von Planungs- und Zulassungsvorhaben genügt der Maßstab einer ausreichenden Qualität. Zudem sind die Aufzeichnung von konkreten Wetterbedingungen der einzelnen Begehung sowie deren Angabe im Rahmen der Projektdokumentation nach Auffassung der Autoren hier entbehrlich. Erhöhte Anforderungen können an Spezialerfassungen zu stellen sein, etwa an die gezielte Prüfung einzelner Arten mit unklarer oder umstrittener Bestandssituation, Erfassungen zu Windkraftplanungen (Mortalitätsrisiken), Monitoringprojekte oder die Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG (FFH-VP), um eine zweckbezogen hinreichende Aussagesicherheit oder Vergleichbarkeit von Daten zu erlangen.
Do fauna mappers also have to record the weather? Sensible versus excessive requirements for faunistic surveys and their documentation
The recording and detectability of animal species are subject to numerous influencing factors, including weather conditions. This, as well as related aspects of mapping and mapping guidelines, will be discussed by way of example. The question of sufficient coverage is ultimately to be indicated by the animals and their activity actually observed in the field. The experience of the investigating person in selecting the date and conditions of field observation, as well as his or her own evaluation of the data collected, are decisive. In practice, a differentiation is appropriate: for standard surveys (e. g. of breeding birds, reptiles or the butterfly fauna within the framework of planning and approval projects), a sufficient level of quality has to be achieved. Moreover, in the opinion of the authors, the recording of actual weather conditions on each survey date, as well as their specification in the project documentation, are dispensable here. Advanced requirements may be posed for special surveys, such as the focused investigation of individual species with an unclear or questionable situation of its local population, surveys for wind power planning (mortality risks), monitoring projects, or assessment according to Article 34 of the German Federal Act for the Protection of Nature (concerning Natura 2000 sites), in order to achieve sufficient reliability or comparability of data for these specific purposes.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Methodische Standards und die Qualitätssicherung von faunistischen Erfassungen sowie von Fachberichten zu Fragen des Arten- und Gebietsschutzes bieten dauernden Diskussionsstoff, auch beim Hinterfragen der eigenen Arbeit. Einer jüngst ergangenen Entscheidung des OVG Nordrhein-Westfalen zufolge (Beschl. v. 15.7.2020 - 8 B 1600/19) gibt es zwar über bestimmte, im Anschluss zu nennende Punkte hinaus bezüglich der im Rahmen einer Brutvogelkartierung „anzuwendenden Maßstäbe und Methoden […], soweit ersichtlich, keine einheitliche, fachlich in jeder Hinsicht anerkannte Meinung“. Jedoch betont das Gericht unter Bezugnahme auf eine entsprechende Entscheidung des BVerwG (Urt. v. 9. 11.2017 - 3 A 4.15, Rn. 46), dass es „zum fachlichen Standard einer Brutvogelkartierung [gehört], für jede Begehung Datum, Beginn und Ende sowie die Witterungsbedingungen zu dokumentieren“. Im zitierten Fall des BVerwG waren sich die beteiligten Sachbeistände hierüber einig; erfolgt war dies bei den infrage stehenden Bestandsaufnahmen allerdings nicht. Diese Aussage erscheint jedoch auch mit Blick auf die Gesamtsituation unzutreffend, denn ein derartiger fachlicher Standard ist weder als allgemein akzeptiert noch als etabliert anzusehen, wie ein Blick in zahlreiche Berichte und Gutachten zu ornithologischen Fragestellungen mit qualitativ hochwertigen Erfassungen, auch zu aktuellen Planungsvorhaben oder solchen der jüngsten Vergangenheit, zeigt.
Hintergründe der Diskussion sind neben rein fachlichen Erwägungen, methodische Ansätze laufend zu prüfen und nach Möglichkeit zu verbessern (unter anderem als wesentliche Basis von Monitoringprojekten, vgl. Südbeck et al. 2005), vor allem andere Aspekte, darunter in der Praxis vermeintliche oder tatsächliche Qualitätsmängel im jeweiligen Verfahren. Dass solche auftreten, ist bekannt, und bietet berechtigten Anlass, sich über deren Vorbeugung Gedanken zu machen (vergleiche zum Beispiel DRL 2017). Darüber hinaus geht es nicht nur um die Qualität von Ergebnissen als solche, sondern teils (eher) um die direkte preisliche Vergleichbarkeit einzuholender Angebote im Vorfeld einer Erfassung und die erhoffte Verfahrenssicherheit etwa im Straßenbau oder bei der Planung von Windenergieanlagen unter Rückgriff auf einen nach Möglichkeit allgemein akzeptierten „methodischen Standard“.
Tatsächlich unterliegt die Erfassung und Erfassbarkeit von Tierarten zahlreichen Einflussfaktoren. Diese erwachsen etwa aus der Person des Kartierenden selbst (zum Beispiel ihrer Erfahrung oder ihrer physischen Voraussetzungen zur Erfassung von Arten, wie etwa Seh- und Hörvermögen), den zu erfassenden Tierarten und deren Lebensweise, die sich in unterschiedlichen, artabhängigen Erfassungswahrscheinlichkeiten niederschlägt (vgl. Diefenbach et al. 2007), den Eigenschaften des jeweiligen Kartiergebiets (zum Beispiel dessen Zugänglichkeit), raum-zeitlichen Aspekten (an welchem Datum wird zu welcher Tageszeit wo kartiert?) sowie aus anderen äußeren Gegebenheiten. Auch die verwendete Technik kann in bestimmten Fällen eine Rolle spielen. Diese Aufzählung ist nicht vollständig und es soll im Weiteren lediglich auf das Wetter als Teil der äußeren Gegebenheiten eingegangen werden, ohne auch dieses vollumfänglich zu behandeln.
2 Wetter- und Witterungseinflüsse
Unter „Wetter“ wird der „physikalische Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem kurzen Zeitraum von Stunden bis hin zu wenigen Tagen“ verstanden. Es wird „durch meteorologische Größen beschrieben, die an den meteorologischen Beobachtungsstationen regelmäßig gemessen und aufgezeichnet werden. Dazu zählen unter anderem Lufttemperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Windrichtung, Luftfeuchte, Bewölkung und Niederschlag“ (Umweltbundesamt o. J.). Unter „Witterung“ versteht man den „durchschnittlichen Charakter des Wetterablaufs an einem Ort oder in einem Gebiet über mehrere Tage bis zu mehreren Wochen“ (Umweltbundesamt o. J.).
Es besteht kein Zweifel, dass bei einem größeren Teil der sogenannten planungsrelevanten Tiergruppen Wetter- oder Witterungseinflüsse die Erfassbarkeit beeinflussen oder begrenzen können.
So sind unter anderem temperaturbedingte Unterschiede der Gesangsaktivität von Vogelarten bekannt und Regen kann die Erfassungswahrscheinlichkeit bestimmter Arten beeinflussen: entweder über eine geringere Effizienz der Kartierenden oder eine geringere Gesangsaktivität (etwa O’Connor & Hicks 1980). Die größten Schwierigkeiten bei der Erfassung von Singvögeln bereitet starker Wind, da die Vögel durch die Bewegung und das Geräusch der Bäume schwerer zu hören und zu sehen sind. Dagegen ist leichter Regen kein Problem. Bei sehr heißem Wetter lässt die morgendliche Aktivität der Vögel früher nach, bei kühlem Wetter kommt sie hingegen erst später in Gang (Bibby et al. 1995). Die tageszeitliche Verteilung und die Flugbewegungen wandernder Greifvögel werden unter anderem durch verschiedene Wetterfaktoren gesteuert, darunter Bewölkungsgrad und Windgeschwindigkeit (etwa Vansteelant et al. 2014); auch beim Schwarzstorch ist beispielsweise eine Korrelation zwischen Maxima der Flugaktivität und der Thermik belegt (Chevallier et al. 2010).
Bei Fledermäusen kann die Kombination aus Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Luftdruck die Wanderung beeinflussen und dabei „optimale Wandernächte“ abbilden (Dechmann et al. 2017); auch weitere Aktivitäten wie das Ausflugsverhalten oder die Nahrungssuche von Fledermäusen werden durch Wetterfaktoren beeinflusst.
Bei Tagschmetterlingen sind Zusammenhänge der Flugaktivität und fliegend zurückgelegter Strecken mit Temperatur (positiv) und Bewölkungsgrad (negativ) nachgewiesen (beispielsweise Cormont et al. 2011). Gerade bei tagaktiven Insekten, aber auch zum Beispiel bei Reptilien, kann die Erfassungswahrscheinlichkeit unter ungünstigen Wetterumständen so stark reduziert sein, dass keine oder allenfalls einzelne Individuen mit den üblicherweise anzuwendenden Methoden registriert werden können. Ähnliches gilt etwa für die Erfassung der Raumnutzung von Greifvögeln.
Teils sind auch nicht das aktuelle Wetter, sondern Witterungsbedingungen der letzten Wochen entscheidend für besonders gute oder besonders schlechte Erfassungsergebnisse. Beispiele hierfür sind Eidechsenkartierungen an den ersten sonnigen Tagen nach langen Kälte- und Regenphasen (günstig) oder die Suche nach Libellenexuvien nach Starkregen- und Hochwasserphasen an Fließgewässerufern (meist ungünstig). Im Frühjahr können Schlechtwetterphasen bei Zugvögeln einen Zugstau auslösen, was günstig für Rastvogelerfassungen sein kann (etwa Volet & Leuzinger 1998), kurz vor Gewitter zeigen viele thermiksegelnde Großvögel während der Brutzeit einen Aktivitätspeak (günstig).
3 Das beste Wetter nutzen – und definieren?
Vor diesem Hintergrund mag erstaunlich sein, wie heterogen sich die Formulierung von Erfassungsbedingungen oder Hinweisen bezüglich des Wetters in methodischen Handreichungen darstellt. Hier ist teilweise lediglich von günstigen oder „optimalen“ Bedingungen die Rede, wobei ergänzend auf weitere Literatur verwiesen wird (da der Begriff „optimal“ eine relative Einstufung bezogen auf die jeweils herrschenden Verhältnisse darstellt – s. https://www.duden.de/ –, wäre ein anderer Begriff vorzuziehen). Teilweise finden sich aber auch detaillierte Vorgaben, die sich auf Wetterparameter selbst beziehen oder mittelbar (etwa über die Tageszeit) mit diesen in Verbindung stehen. Dann besteht die Gefahr, dass solche Vorgaben über das Ziel hinausschießen oder sich gar als kontraproduktiv erweisen. Beispiele dazu finden sich etwa in den für Straßenplanungen inzwischen oft herangezogenen Leistungsbeschreibungen von Albrecht et al. (2014), wo für die Kartierung bestimmter Tagfalterarten ein unnötig strikt „bewölkungsfreies Wetter“ (S. 115) gefordert wird – was als „wolkenfrei“ (= 0/8) im Sinne der Einteilung des DWD zu werten ist und bedeutet, dass „am Himmel keine Spuren von Wolken zu sehen sind“ (DWD o. J.) –, oder unter den Erfassungsbedingungen für Reptilien eine Temperaturspanne von 22–30 °C (Methodenblatt R1, S. 236).
Letztere ist zunächst praxisfern, da diese Temperaturspanne in ansonsten günstigen Schwerpunktzeiträumen der Reptilienerfassung an vielen Tagen gar nicht erreicht wird. So hätten sich etwa für den durch die Messstelle Stuttgart-Flughafen repräsentierten Raum im April und Mai des Jahres 2020 immerhin noch 17 Tage (rund 28 %) ergeben, an denen die Höchsttemperatur überhaupt den unteren Wert jener Spanne überschritten hat, im Jahr 2019 waren es aber lediglich acht Tage (rund 13 %; nach www.wetterkontor.de basierend auf Daten des Deutschen Wetterdienstes). Darüber hinaus ist die Vorgabe aber kontraproduktiv, da die günstigsten täglichen Erfassungszeiträume etwa für die Zauneidechse oft gerade nicht jene mit der Tageshöchsttemperatur sind und Eidechsenaktivität bei Eignung etwa von Exposition und Untergrund bereits im einstelligen °C-Bereich der Lufttemperatur beginnen kann. Bei Einhaltung jener Vorgabe würde man demnach oft zu ungünstiger Zeit kartieren.
Wenn in anderen Handreichungen für die Zauneidechse „Begehungen an warmen/schwülen Tagen ohne direkte Sonneneinstrahlung“ und „keine Erfassung in den sonnigen Mittagstunden“ gefordert werden (MKULNV 2017, Anhang 4, S. 33), so mag dies insgesamt besser zutreffen als die zuerst genannte Vorgabe, spiegelt aber immer noch unzureichend die günstigen Kartierbedingungen wider. Hier kann das Kapitel zur Tagesaktivität der Art in Blanke (2010: 76) empfohlen werden, unter anderem mit der auch persönlichen Erfahrungen der Autoren entsprechenden Bemerkung, dass die Luft während Nachweisen „nach eigenen Beobachtungen vielfach deutlich kühler [ist], als in Publikationen […] angegeben“. Dort wird etwa auch auf die Arbeit von Innes (1996) hingewiesen, der auf unsere Verhältnisse übertragbar darstellt, dass bei niedrigeren Temperaturen bis etwa 15 °C sonniges Wetter, bei höheren Werten dagegen zunehmende Bewölkung günstig sei.
Es ist daher gar nicht so einfach, Wetter- und Witterungsbedingungen zu formulieren, die eng genug sind, um eine in diesem Aspekt unpassende oder nicht-sachgemäße Kartierung auszuschließen, zugleich aber diejenigen Spielräume zu belassen, die Kartierende unbedingt im Rahmen einer praxisnahen Gestaltung ihrer Tätigkeit einschließlich der Auswahl günstiger Erfassungstage benötigen. In MKULNV (2017, Anhang 4, S. 33) wird treffend formuliert: „Das Hauptkriterium einer erfolgreichen Reptilienkartierung ist das richtige Einschätzen von ‚günstigem Reptilienwetter‘, ein Kartierungserfolg hängt daher wesentlich von der Erfahrung des Erfassers ab.“
Die Frage nach einer ausreichenden Erfassung ist letztlich an der tatsächlich im Gelände festgestellten Aktivität beziehungsweise den Nachweisen vor dem Hintergrund von Erfahrungswerten der jeweils kartierenden Personen zu messen. Deren Einschätzung ist entscheidend, und nicht einzelne Wetterdaten oder ihre Kombination. Es wird im Gelände in aller Regel auch nicht anhand von (gemessenen) Wetterparametern über Fortführung oder Abbruch der Arbeiten entschieden, sondern danach, ob die relevanten Arten noch im für die jeweilige Fragestellung ausreichenden Maße feststellbar sind. Dies kann etwa bei Brutvogelbestandsaufnahmen durchaus auch bei regnerischem Wetter noch der Fall sein.
Im Standardwerk „Methoden der Feldornithologie“ führen Bibby et al. (1995: 51) aus: „Am besten vermeidet man Erfassungen bei schlechtem Wetter vollständig, wobei es nicht ganz einfach ist, dazu genaue Angaben zu machen, weil die Witterungsfaktoren sich oft gegenseitig beeinflussen und auch im Zusammenhang mit der Tages- bzw. Jahreszeit stehen. Unter gewissen Umständen kann es möglich sein, das Wetter genau zu protokollieren und bei der Erfassung zu berücksichtigen, dies bringt aber selten Erfolg.“
4 Die Rolle von Wetteraufzeichnungen der Kartierenden
Etwaige Aufzeichnungen Kartierender zu Wetter und Witterung, die bei Bedarf angefertigt werden, sind primär als „Rohdaten“ im Sinne der Entscheidungen des OVG Nordrhein-Westfalen (Urt. v. 29.03.2017 - 11 D 70/09.AK) und des OVG Niedersachsen (Urt. v. 22.4.2016 - 7 KS 27/15, Rn. 298, 302) zu sehen. Sie erlangen „erst mit weiteren in den Begutachtungsprozess einfließenden Parametern eine Aussagekraft“ und ihre Auswertung und Interpretation obliegt insoweit den Kartierenden/GutachterInnen.
Sollte tatsächlich einmal die Plausibilität erhobener Daten infrage stehen, mag ohnehin die objektive Sachlage anhand üblicher Notizen und bei Abweichung zu Daten meteorologischer Stationen nicht sicher geklärt werden können. Dies insbesondere dann nicht, wenn keine Standardisierung zu notierender Wetterparameter, dabei zu verwendender Messgeräte und der Zeitreihen von Messungen durch die Kartierenden vorgegeben ist, was aber jedenfalls überschießend wäre. Eine Ahnung, in welche Richtung sich diesbezügliche Diskussionen – vorbei am Kern eigentlicher artenschutzfachlicher und -rechtlicher Probleme – entwickeln können, gibt eine Passage im Urt. des VGH Bayern v. 10.8.2020 - Az.: 15 N 19.1377, Rn. 44: Zur Erwiderung von Einwendungen durch eine Prozessbeteiligte, wonach „an den von den Kartierern nach subjektivem Empfinden als ‚kühl‘ bzw. ‚kühl-warm‘ vermerkten Tagen laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes jahreszeitgemäße Temperaturen und damit grundsätzlich gute Flugbedingungen [hier auf Greifvögel bezogen] geherrscht“ hätten, wirft der VGH – nachvollziehbarer Weise – die Frage auf, ob diesbezüglich „für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Ermittlungspflicht gem. § 2 Abs. 3 BauGB zumindest die Einholung einer nachträglichen Stellungnahme der Kartierenden geboten gewesen wäre“.
Dass sich im Übrigen ab bestimmten Wetterverhältnissen eine sinnvolle wie ausreichende Kartierung nicht (mehr) durchführen lässt, für viele Arten etwa bei Starkregen, starkem Wind oder auch dichtem Nebel, bleibt unbenommen. Kartierende mit ausreichend Erfahrung werden dies aber ohnehin berücksichtigen und andere sollten nicht als verantwortlich Kartierende oder Fachgutachterinnen zum Einsatz kommen. Dies bedeutet keineswegs, dass man jedweder „gutachterlicher“ Aussage vertrauen muss oder soll. Die Aussage des Kartierenden, dass die Wetterbedingungen für eine Erfassung geeignet oder ausreichend waren (siehe folgenden Abschnitt), sind zusammen mit den Ergebnissen der Kartierung und einer Einschätzung ihrer Plausibilität aber in der Regel nicht von geringerem Gewicht, als wenn sie durch eine Auflistung mit – nach welchen Standards auch immer erhobenen – Wetterdaten ergänzt wären. Dem Einwand, die Dokumentation realer Wetterdaten am Erfassungsort sei deshalb wichtig, weil vorhandene Wetterstationen häufig zu weit entfernt lägen, um für eine direkte Prüfung herangezogen werden zu können, lässt sich recht einfach begegnen: Geht man für einen solchen Fall von einer zutreffenden Einschätzung der Kartierenden (also von ausreichenden Wetterbedingungen) aus, werden keine Vergleichsdaten benötigt. Geht man davon aus, dass die Kartierenden bei nicht geeignetem Wetter kartiert haben, hätte man sowieso keine Vergleichsdaten zur Verfügung, um das Gegenteil zu belegen. Dass Kartierende die Ungeeignetheit ihrer Kartierbedingungen selbst dokumentieren, ohne entsprechende Kartierdurchgänge unter besseren und dann für die Aufgabenstellung ausreichenden Bedingungen zu wiederholen, dürfte der Ausnahmefall sein.
5 Anforderungen an Standard- und spezielle Erfassungen
Eigene Bewertung ermittelter Daten
In der – immer erforderlichen – eigenen Bewertung der ermittelten Daten, die Wetter und Witterungsbedingungen mit in den Blick nimmt, kann auf die folgenden Begriffe oder Stufen (und ihre Alltagsbedeutungen laut duden.de oder de.wikipedia.org) abgestellt werden:
- ideal (vollkommen; eher ständiges Ziel als in der Praxis tatsächlich erreichbar)
- geeignet (den Anforderungen vollumfänglich genügend)
- ausreichend (den Anforderungen genügend, angemessen)
- bedingt geeignet (nicht uneingeschränkt; nur mit Einschränkungen, die dann zu präzisieren sind und für die klargestellt werden muss, welche Konsequenzen hieraus erwachsen).
- ungeeignet
Üblicherweise erreichbar wird die Stufe „ausreichend“ insbesondere bei Standarderfassungen in großen Untersuchungsgebieten sein, deren Kartierung vor allem aufgrund der Zeitbudgets innerhalb der geeigneten Zeiträume eines Jahres in der Praxis zwangsläufig auch unter Einbezug „noch“ akzeptabler Witterungsphasen erfolgt. Dies dürfte im Einklang mit der Rechtsprechung des BVerwG stehen, wonach eine naturschutzfachliche Meinung oder Methodik einer anderen Einschätzung nicht bereits deshalb als überlegen oder ihr vorzugswürdig einzustufen ist, weil sie aufwendigere oder umfangreichere Ermittlungen und „strengere“ Anforderungen für richtig hält (BVerwG, Urt. v. 9.7.2008 - 9 A 14.07; Rn. 66).
5.1 Vorgehen bei Standarderfassungen
Mit Standarderfassungen sind solche Erfassungen gemeint, die sehr häufig als Grundlage für Planungs- und Zulassungsverfahren durchgeführt werden und die auf die Erfassung von Artengruppen oder planungsrelevanten Ausschnitten derselben in Planungsräumen unterschiedlicher Größe mit mehreren Begehungen abstellen, etwa Bestandsaufnahmen der Brutvogelfauna, der Reptilien-, Amphibien-, Tagfalter- oder Heuschreckenarten sowie der Abgrenzung und Bewertung ihrer Lebensräume. Auch die regelhaft vorgenommene Kartierung einzelner planungsrelevanter Arten wie der Zauneidechse oder der Haselmaus, die zu den eher einfach zu kartierenden Arten zählen, werden hier hinzugerechnet.
Seitens der Autoren wird die Auffassung vertreten, dass es im Rahmen solcher Standarduntersuchungen – neben dem Abstellen auf die oben genannte Qualitätsstufe „ausreichend“ – auch ausreichend sein muss, die angewandte Methodik einschließlich einer Nennung der Erfassungstage oder -zeiträume summarisch zu beschreiben und zu bewerten. (Auch Albrecht et al. 2014 fordern übrigens weder im Haupttext noch in den einzelnen Methodenblättern explizit, Wetter oder Witterung zu erfassen und zu dokumentieren.) Diese Bewertung kann auch vor dem Hintergrund der Gesamtschau der Ergebnisse (etwa nach erfolgter Revierauswertung bei Brutvögeln oder nach der Abgrenzung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei Eidechsen) erfolgen. Sollten diese vor dem Hintergrund der vorhandenen Habitatstrukturen und dem bekannten Verbreitungsmuster der relevanten Arten das entsprechend zu erwartende Bild zeigen oder gar darüber hinausreichen, wären die größtenteils während der Erfassungen herrschenden Wetterbedingungen grundsätzlich als ausreichend einzustufen.
Nur für den Fall, dass die eigene gesamthafte Bewertung der Daten nicht mindestens die Stufe ausreichend erreicht, sind ergänzend Einschränkungen zu beschreiben und zu beurteilen. Nur zu hierfür in Folge des Wetters entscheidenden Ereignissen müssen, als Grundlage für eine entsprechende Bezugnahme im Bericht, auch wetterbezogene Notizen im Gelände angefertigt werden, etwa bei Abbruch einer Begehung, insbesondere soweit für diese kein Ersatztermin durchgeführt werden kann.
Ansonsten ist es in solchen Untersuchungen sinnvoll, wenn die Kartierenden ihre Zeit zunächst für die Erfassung von Arten verwenden, statt Wetterbedingungen zu notieren, und danach auch ihre Berichte schlank halten, statt sie mit überschießenden Tabellen zu Wetter und Witterung zu beschweren.
5.2 Vorgehen bei Spezialerfassungen
Unter Spezialerfassungen werden seitens der Autoren Erfassungen verstanden, die von den vorstehend behandelten Standarderfassungen insbesondere dadurch abweichen, dass sie spezifischeren Fragestellungen nachgehen, sich auf einzelne schwieriger erfassbare Arten fokussieren, besonders hohe Anforderungen an die Kartierenden stellen oder die Erzeugung langjähriger Datenreihen (Monitoring) zum Ziel haben.
Bei diesen Spezialerfassungen kann eine erhöhte Anforderung an die Dokumentation der Wetter- und Witterungsbedingungen während des Untersuchungszeitraums geboten sein.
Gerade im Rahmen von Monitoringprojekten müssen in der Regel mehrere zum Teil langjährige Datenreihen miteinander verglichen oder Daten zur Bestandssituation einzelner Arten detailliert interpretiert werden, sodass Einflussfaktoren wie etwa das Wetter eine wesentliche Rolle spielen können. (Südbeck et al. 2005: 32 formulieren hierzu passend: „Für die langfristigen Monitoringprogramme und Wiederholungskartierungen ist […] die genaue Einhaltung der methodischen Vorgaben eine Grundvoraussetzung für die Reproduzierbarkeit und daher für die Interpretierbarkeit der Ergebnisse.“)
Zu Spezialaufgaben sind auch Untersuchungen zu zählen, die darauf ausgerichtet sind, ein aktuelles Vorkommen einer früher in einem Gebiet nachgewiesenen Art zu überprüfen, bei der die Bestandssituation unklar oder umstritten ist. Gerade in solchen Fällen wird man sich bei Wetter und Witterung – wie auch bei anderen Rahmenbedingungen der Kartierung (etwa den Erfassungszeiträumen) – gegenüber Standarduntersuchungen verstärkt an den oben genannten Qualitätsstufen „günstig“ bis „ideal“ orientieren und auch eine weitergehende Dokumentation und Diskussion zu methodenbedingten Einflüssen erwarten können.
Dies gilt ebenso für Untersuchungen zur Beurteilung geplanter Windkraftanlagen und insbesondere damit verbundener Mortalitätsrisiken, da vor allem der Rahmen geeigneter Bedingungen zur Erfassung von Greifvögeln insgesamt enger zu fassen ist als für Standard-Brutvogelerfassungen. Daher sind bei diesem Vorhabentyp – neben der üblicherweise nötigen hohen fachlichen Qualifikation – hohe Anforderungen an die Fähigkeit der Bearbeitenden zur korrekten Einschätzung der für die Erfassung adäquaten Wetterbedingungen zu stellen.
Auch die Frage nach der genauen Bestandsgröße einer gegebenenfalls schwer erfassbaren Art oder danach, ob sich signifikante Veränderungen gegenüber einem früheren Zustand ergeben haben, wären hier einzuordnen. Für die Bestimmung einer Populationsgröße können ohnehin auch insgesamt andere und aufwendigere Methoden als die heute planungsüblichen einzusetzen sein.
Und schließlich kann im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG (FFH-VP) unter dem Gesichtspunkt der geforderten besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und der zu erlangenden „Gewissheit“ der zuständigen Behörden (vgl. EuGH, Urt. v. 7.11.2018 - C 461/17, Rn. 33) eine erhöhte Anforderung an die Berücksichtigung und die Dokumentation von Wetter bzw. Witterung zu stellen sein.
6 Schlussbemerkungen
Weitergehende Anforderungen, die sich beispielsweise aus zwingend zu berücksichtigenden Vorgaben der Länder oder aus konkreten vertraglichen Vereinbarungen mit der beauftragenden Stelle ergeben, bleiben unabhängig von ihrem fachlichen Erfordernis oder ihrer sonstigen Relevanz vom oben Ausgeführten unberührt.
Die Qualitätssicherung faunistischer Daten für die Praxis von Planungs- und Zulassungsverfahren muss insbesondere über die Förderung einer frühzeitigen außerschulischen Beschäftigung mit Arten, verbesserte Möglichkeiten der Qualifizierung im Ausbildungs- und Berufsweg, eine in Teilen geänderte Vergabe- und Kontrollpraxis sowie weitere, etwa berufsständische Maßnahmen erfolgen.
Dokumentationspflichten, noch dazu überschießende, helfen hier nicht weiter.
Literatur
Albrecht, K., Hör, T., Henning, F.W., Töpfer-Hofmann, G., Grünfelder, C. (2014): Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Schlussbericht 2014: 311 S. + Anhang.
Blanke, I. (2010): Die Zauneidechse – zwischen Licht und Schatten. Zeitschr. Feldherpetol. Beih. 7: 176 S.
Bibby, C.J., Burgess, N.-D., Hill, D.A. (1998): Methoden der Feldornithologie. Bestandserfassung in der Praxis. 270 S., Radebeul, Neumann.
Chevallier, D., Hendrich, Y., Georges, J.-Y., Baillon, F., Brossault, P., Aurouet, A., Le Maho, Y., Massemin, I. (2010): Influence of weather conditions on the flight of migrating black storks. Proc. R. Soc. B. 277: 2755-2764; doi.org/10.1098/rspb.2010.0422
Cormont, A., Malinowska, A.H., Kostenko, O., Radchuk, V., Hemerik, L., DeVries, M. F.W. (2011): Effect of local weather on butterfly flight behaviour, movement, and colonization: significance for dispersal under climate change. Biodivers. Conserv. 20: 483-503.
Dechmann, D.K.N., Wikelski, M., Ellis-Soto, D., Safi, K., O’Mara, M.T. (2017): Determinants of spring migration departure decision in a bat. Biol. Lett. 13: 0170395, dx.doi.org/10.1098/rsbl.2017.0395
Diefenbach D.R., Marshall, M.R., Mattice, J.A., Brauning, D.W. (2007) Incorporating Availability for Detection in Estimates of Bird Abundance. The Auk 124 (1): 96-106, https://doi.org/10.1093/auk/ 124.1.96
DRL (Deutscher Rat für Landespflege, Hrsg.) (2017): Qualifikation und Zertifizierung von Fachgutachtern. Bonn.
DWD, Deutscher Wetterdienst, Hrsg. (o. J.): Wetterlexikon. https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=100932&lv3=101016 (letzter Zugriff am 29.03.2021).
Innes, H. (1996): Survey guidelines for the widespread British reptiles. English Nature Science Series 27: 134-137.
MKULNV (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Hrsg.) (2017): Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen – Bestandserfassung und Monitoring. Anhang 4: Artspezifisch geeignete Kartiermethoden (Methodensteckbriefe).
O’Connor, R. J., Hicks, R. K. (1980): The influence of weather conditions on the detection of birds during Common Birds Census fieldwork, Bird Study 27 (3): 137-151, doi 10.1080/00063658009476672
Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C., Hrsg. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Im Auftrag der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten und des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten. 777 S., Radolfzell.
Umweltbundesamt, Hrsg. (o. J.): Was ist eigentlich Klima? https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-eigentlich-klima (letzter Zugriff am 29.03.2021).
Vansteelant, W.M.G., Verhelst, B., Shamoun-Baranes, J., Bouten, W., van Loon, E.E., Bildstein, K.L. (2014): Effect of wind, thermal convection, and variation in flight strategies on the daily rhythm and flight paths of migrating raptors at Georgia’s Black Sea coast. J. Field Ornithol. 85 (1): 40-55, doi: 10.1111/jofo.12048
Volet, B., Leuzinger, H. (1998). Aussergewöhnliche Ansammlungen von Kiebitz Vanellus vanellus und Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria in der Schweiz während der Heimzugperiode 1996. Ornithol. Beob. 95: 137-142.
Weitere Internetquellen sowie Gerichtsentscheidungen sind im Text benannt.
Fazit für die Praxis
- Wetter und Witterung sind für Kartieraufgaben relevant und müssen durch die Kartierenden beachtet werden.
- Für Standarduntersuchungen etwa zur Brutvogel-, Reptilien- oder Tagschmetterlingsfauna im Rahmen von Planungs- und Zulassungsvorhaben sind jedoch die Aufzeichnung konkreter Wetterbedingungen der einzelnen Begehung sowie ihre Angabe im Rahmen der Projektdokumentation entbehrlich. Sie haben dort meist keine Relevanz und liefern zudem ohne aufwendige Standardisierung kaum zusätzliche Erkenntnisse gegenüber Daten meteorologischer Beobachtungsstationen.
- Stattdessen wird als passend erachtet, wenn die Kartierenden insgesamt beurteilen, ob die ermittelte Datenlage für die im Projekt relevanten Fragestellungen ausreichend ist. Die Methodik ist ansonsten ausreichend und summarisch zu beschreiben.
- Wird die Datenlage als bedingt ausreichend oder ungeeignet beurteilt, ist auf Ursachen, Einschränkungen und Konsequenzen hinzuweisen. Nur für in diesem Rahmen bedeutsame Wetter- oder Witterungsbedingungen sind Notizen erforderlich.
- Erhöhte Anforderungen gelten für Spezialerfassungen, etwa die gezielte Prüfung einzelner Arten mit unklarer oder umstrittener Bestandssituation sowie Erfassungen zu Windkraftplanungen (Mortalitätsrisiken) oder für Monitoringprojekte. Auch für die Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG (FFH-VP) kann eine erhöhte Anforderung bestehen. In diesen Fällen können die Orientierung an günstigen bis idealen Kartierbedingungen sowie die weitergehende Dokumentation konkreter Wetter- oder Witterungsbedingungen geboten sein, um eine hinreichende Aussagesicherheit oder Vergleichbarkeit von Daten zu erlangen.
Kontakt

Jürgen Trautner ist Landschaftsökologe, seit 1987 Inhaber der Arbeitsgruppe für Tierökologie in Filderstadt und seit Ende 2019 deren geschäftsführender Gesellschafter. Arbeitsschwerpunkte im europarechtlich begründeten Arten- und Gebietsschutz sowie der Bewertungs- und Planungsmethodik. Mitarbeit unter anderem am Zielartenkonzept und der Ökokonto-Verordnung Baden-Württemberg sowie an der Erarbeitung der bundesweiten Fachkonventionen zur Beurteilung der Erheblichkeit in der FFH-Verträglichkeitsprüfung.

Johannes Mayer ist Dipl.-Geograph, seit 2004 Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe für Tierökologie in Filderstadt und heute stellvertretender Institutsleiter. Arbeitsschwerpunkte in der Vorhabenbegleitung sowie der artenschutzfachlichen Bewertung von Eingriffsvorhaben. Fachlicher Tätigkeitsbereich vor allem die Ornithologie mit Schwerpunkten in Brutvogelkartierungen, Siedlungsornithologie und Vogelzugbeobachtung.

Florian Straub ist Dipl.-Forstwissenschaftler und seit 2009 Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe für Tierökologie in Filderstadt. Arbeitsschwerpunkte in der artenschutzfachlichen Untersuchung von Naturschutz- und Eingriffsvorhaben einschließlich der Arterfassung sowie der Methodik von Datenauswertungen und -erfassungen.
Von Jürgen Trautner, Johannes Mayer und Florian Straub
Eingereicht am 18. 12. 2020, angenommen am 29. 03. 2021
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen








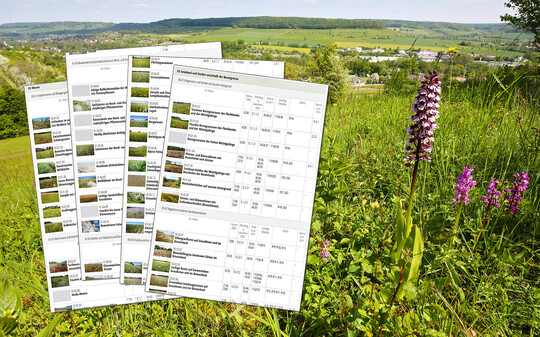


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.