Empfindlichkeit des Landschaftsbildes
Abstracts
Das Landschaftsbild wird in der Planungspraxis oft vernachlässigt, da es an standardisierten, validen, praktikablen und akzeptierten Bewertungsmethoden fehlt. Allerdings ist eine Operationalisierung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes großflächig und hochauflösend anhand einer Einsehbarkeitsanalyse möglich, wie in diesem Beitrag gezeigt wird. Als Anwendungsbeispiel wird der Freistaat Thüringen betrachtet. Kenntnisse zur Empfindlichkeit des Landschaftsbildes sind essenziell, um die erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die besonders von Vertikalbauwerken wie Windkraftanlagen oder Freileitungsmasten ausgehen, zu vermeiden und zu vermindern. Kenntnisse der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes ermöglichen eine fundierte Abwägung von Planungsalternativen von der Raum- bis zur Bauleitplanung, um besonders empfindliche Landschaften zu schützen.
Sensitivity of the visual landscape – assessment through large-scale visibility analyses
In planning practice, scenic landscape qualities and impacts concerning the visual landscape are often neglected because standardized, valid, feasible, and accepted assessment methods are lacking. Nevertheless, this article shows how the sensitivity of the visual landscape can be operationalized for large areas using high resolution visibility analyses. We use the federal state of Thuringia (Germany) as an example. Knowledge of visual landscape sensitivity is crucial to avoid and mitigate the negative impacts which are caused particularly by large vertical objects such as wind turbines or transmission pylons. The knowledge gained about visual landscape sensitivity enables an informed assessment of planning alternatives within regional and urban land-use planning to protect especially sensitive landscapes.
- Veröffentlicht am

Eingereicht am 03.02.2020, angenommen am 03.04. 2020
1 Einführung
Zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende in Deutschland ist der Ausbau der erneuerbaren Energien essenziell. Besonders die Windenergie bietet noch ungenutzte Potenziale der Energieerzeugung. Allerdings findet die Produktion vor allem im Norden Deutschlands statt, während die Verbrauchszentren im Süden der Bundesrepublik liegen (BMWI 2017). Die hieraus entstehende ungleichmäßige Verteilung von Energie erfordert als Teil der Energiewende einen Ausbau der Stromübertragungsnetze, um deren Leistungsfähigkeit und Stabilität sowie die Versorgungssicherheit in ganz Deutschland zu gewährleisten.
Die Realisierung der Stromtrassen als Freileitung sowie die Errichtung von Windkraftanalagen zur Stromproduktion führen zu erheblichen Eingriffen in das Landschaftsbild. Der technische Charakter und die Dimensionierung der Anlagen im Vergleich zur restlichen Landschaft beeinträchtigen das Landschaftsbild in weiten Wirkbereichen (BfN 2019), weshalb Neuplanungen von der ansässigen Bevölkerung oft abgelehnt werden (Lienertet al. 2018). Obwohl „Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ gemäß § 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu schützen sind, wird das Landschaftsbild in Planungen oft vernachlässigt, da keine standardisierten, validen, praktikablen und in Planungspraxis sowie bei Behörden akzeptierten Bewertungsmethoden und Planungsgrundlagen vorhanden sind. Infolgedessen haben sich Ersatzzahlungen als gängiges Mittel der Kompensation etabliert, da oft eine Naturalkompensation sogar in landesweiten Verordnungen als nicht möglich angesehen wird (vgl.Roth & Bruns2016).
Die Voraussetzung, um die notwendige Kompensation festzulegen, ist eine angemessene Bewertung des Landschaftsbildes. Oft wird, wenn eine Bewertung überhaupt stattfindet, nur die Landschaftsbildqualität betrachtet. Dabei wirken sich noch andere Eigenschaften des Schutzguts auf die Beeinträchtigung aus. Besonders die Kenntnis der spezifischen Empfindlichkeit des Landschaftsbildes, beschrieben als die Fähigkeit der Landschaft, störende Objekte zu verbergen (Roth & Bruns2016: 52 f.), ist wichtig. In der Praxis wird die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes oft durch die Einsehbarkeit der Landschaft ausgedrückt (Gerhards2003). Die Einsehbarkeit beschreibt, von wie vielen Orten ein fiktives im Raum platziertes Objekt einsehbar wäre. Sie wird durch die Sichtbarkeitshäufigkeit ausgedrückt. Im Rahmen der Einsehbarkeitsanalyse kann die Einsehbarkeit heutzutage in einem geografischen Informationssystem (GIS) berechnet und somit operationalisiert werden. Dabei werden grundlegende Methoden der Sichtbarkeitsanalyse verwendet: Eine Einsehbarkeitsanalyse besteht aus einer Vielzahl von Sichtbarkeitsanalysen für viele fiktive im Raum platzierte Zielobjekte und Beobachter. Die so generierten Ergebnisse sind durch standardisierte (Sichtbarkeits-)Algorithmen und standardisierte Landschaftsdaten objektiv, reliabel und valide.
Einsehbarkeitsanalysen bilden die Grundlage, um die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber visuell wirksamen Vorhaben zu bewerten, und sind somit besonders für die vorhabenbezogene Landschaftsplanung von Bedeutung. Wenn fundierte Kenntnisse vorliegen, die helfen können, Eignungs- und Meideräume für bestimmte Infrastrukturen zu qualifizieren, führt dies zu einer Stärkung des Schutzgegenstandes Landschaftsbild in Planungs- und Abstimmungsprozessen. Außerdem wird es möglich, unterschiedliche Regionen hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit zu vergleichen und Standortalternativen bezüglich ihrer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu bewerten. So können das Vermeidungs- und Minderungsgebot des BNatSchG umgesetzt, eine landschaftsverträgliche Entwicklung ermöglicht und besonders empfindliche Teile der Landschaft geschützt werden.
Im Folgenden wird erläutert, wie durch die Anwendung eines Clusters aus parallel rechnenden GIS-Workstations (vergleicheRoth & Fischer2018) die Einsehbarkeit der Landschaft für den Freistaat Thüringen flächendeckend operationalisiert und die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes quantifiziert werden kann. Der Auftrag wurde von der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG; jetzt Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz – TLUBN) im Spätsommer 2018 an das Institut für Landschaft und Umwelt (ILU) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) vergeben, um eine fundierte Grundlage für zukünftige Abwägungsentscheidungen zur Realisierung von Vertikalobjekten bereitzustellen.
Einsehbarkeitsanalysen wurden für drei unterschiedliche Höhen von Vertikalbauwerken (60 m für Freileitungsmasten, 200 m für heutige Windkraftanlagen, 250 m für zukünftige Windkraftanlagen) als Eingriffstypen erstellt. Indem die lokalen Gegebenheiten hinsichtlich der Einsehbarkeit/Empfindlichkeit der Landschaft berücksichtigt werden, kann so die strategische Planung und Standortwahl verbessert werden.
2 Methodischer Ansatz und Datengrundlagen
2.1 Einsehbarkeitsanalysen
Die Einsehbarkeit der Landschaft wurde in einem geografischen Informationssystem (GIS) berechnet, um die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes zu quantifizieren. Einsehbarkeitsanalysen unterscheiden sich grundlegend von herkömmlichen Sichtbarkeitsanalysen: Bei einer herkömmlichen Sichtbarkeitsanalyse wird ermittelt, ob ein reales Objekt mit konkretem Standort sichtbar ist, und, wenn das der Fall ist, für welche weiteren Positionen im definierten Umfeld dies ebenfalls gilt. Eine Einsehbarkeitsanalyse betrachtet für jede Position in der Landschaft , wie stark ein fiktives Objekt an dieser Stelle von einer definierten Umgebung aus einsehbar wäre. Einsehbarkeitsanalysen erfassen also, von wie vielen möglichen im Raum verteilten Beobachtern ein geplantes Objekt, wie etwa eine Windkraftanlage oder ein Freileitungsmast, in einem festgesetzten Umkreis um dieses Objekt gesehen werden kann. Dieser Unterschied zwischen den Analysetypen ist zu beachten. Die Berechnung der Einsehbarkeit geschieht auf der Basis von Rasterdaten, namentlich digitalen Geländemodellen (DGMs) oder digitalen Oberflächenmodellen (DOMs). Durch die Berechnung der Sichtbarkeitshäufigkeit pro Rasterzelle kann die Einsehbarkeit verschiedener Objektstandorte verglichen werden. Besonders die strategische Planung kann von diesen Erkenntnissen profitierten. Die Einsehbarkeitsanalyse besteht aus einer Vielzahl von Sichtbarkeitsanalysen, deren zugrunde liegendes Prinzip Abb. 1 schematisch veranschaulicht.
Auf der Basis der Höhe des Reliefs sowie der Landnutzungshöhe wird im GIS berechnet, ob ein fiktives Objekt vom Standort des auf dem Relief platzieren Beobachters sichtbar wäre. Ein Beobachter repräsentiert einen durchschnittlich großen Menschen an einer bestimmten Position in der Landschaft. Für diesen wird die Objektsichtbarkeit analysiert. Hierfür wird eine Sichtlinie zwischen Augenhöhe und Objektspitze des Zielobjektes gezogen, um zu prüfen, ob sichtverschattende Strukturen in Form von Topografie oder Landnutzung die Linie schneiden (oranger und blauer Beobachter). Zur Darstellung des Reliefs wird ein digitales Geländemodell (DGM) verwendet. Zur zusätzlichen Abbildung der Landnutzungshöhe kann das DGM entweder überhöht werden oder es wird ein digitales Oberflächenmodell (DOM) verwendet, wobei letzteres für eine realitätsnahe Abbildung zu bevorzugen ist (Schulte-Braucks2011: 110). Eine Auflösung von 10 m des Rasterdatensatzes ist ein geeigneter Kompromiss zwischen erforderlicher Genauigkeit und bei feinerer Auflösung exponentiell steigender Rechenzeit, denn es können noch Kleinstrukturen wie Hecken abgebildet werden, die zu Sichtverschattungen führen (Schulte-Braucks2011: 125f.). Das Ergebnis der Einsehbarkeitsanalyse entspricht in der Auflösung dem Geländemodell, das heißt, es können fein aufgelöste Aussagen zur Einsehbarkeit der Landschaft (Zehn-Meter-Ergebnisraster) geliefert werden.
Analysen zur Sichtbarkeit werden in der Praxis mit einem gängigen visuellen Wirkradius von 10 km für Windkraftanlagen durchgeführt (Täuber&Roth2011), wobei es sich nachRoth & Gruehn(2014) um ein Mindestmaß handelt. Weitere Autoren beschreiben den Wirkradius als Funktion der konkreten Anlagenhöhe (Roth & Bruns2016). Dabei wird die Sichtachse vom Beobachter zur Mastspitze betrachtet (Haubaum & Roth2015). Im Fall von Freileitungen besitzen die Leitungsseile zwar ebenfalls eine visuelle Wirkung, jedoch sind sie nur in bis zu 2 km Entfernung wahrnehmbar (Haubaum & Roth2015). Aus diesem Grund wird innerhalb des hier verwendeten Ansatzes ein Analyseradius von 10 km verwendet. Weiterhin ist die visuelle Wirkung von Objekten auch entfernungsabhängig, das heißt in direkter Umgebung stärker als in weiter Entfernung. Im hier beschriebenen Projekt wurde jedoch keine Entfernungsgewichtung vorgenommen, in der nahe fiktive Beobachter stärker gewichtet werden würden (vergleiche dazu beispielsweiseChamberlain & Meitner2013).
Der Einsehbarkeitsanalyse liegen fiktive Beobachter zugrunde. Es handelt sich um ein Punkt-Shape-File, wobei jeder Punkt einen Beobachter repräsentiert. Die Anzahl der Beobachter (abhängig von ihrer Dichte im Raum) beeinflusst die Rechenzeit neben der Auflösung des DGM stark.Schulte-Braucks(2011: 126) kam zu dem Ergebnis, dass eine Anordnung der Punkte in einem regelmäßigen Raster mit einem Abstand von 500 m der beste Kompromiss zwischen Rechenzeit und Genauigkeit ist. Dennoch wurden in der Vergangenheit aufgrund der extrem langen Rechenzeit (vgl.Augenstein2002) selten großräumige Gebiete untersucht.
Kenntnisse der Einsehbarkeit und Empfindlichkeit sind besonders für die vorhabenbezogene Planung essenziell. Durch die Umsetzung einer flächendeckenden Einsehbarkeitsanalyse ist es möglich, Teilräume und Standorte bezüglich ihrer Eignung und ihres Konfliktrisikos aus Sicht des Landschaftsbildes miteinander zu vergleichen. Resultierend können innerhalb einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) oder einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) die Belange des Landschaftsbildes besser abgebildet und Planungsvarianten mit einem geringeren Konfliktrisiko für das Landschaftsbild gewählt werden.
2.2 Eingangsdaten der Einsehbarkeitsanalyse für den Freistaat Thüringen
Innerhalb dieser Studie wurde ArcMap der Firma ESRI in der Version 10.6 verwendet. Die grundsätzliche Vorgehensweise orientiert sich anRoth & Fischer(2018). Die entwickelte und erfolgreich umgesetzte Methode ermöglichte durch die Nutzung eines parallel rechnenden Workstation-Clusters die Bestimmung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber Höchstspannungsleitungen in Baden-Württemberg.
Zur Berechnung der Einsehbarkeit der Landschaft für den Freistaat Thüringen standen die in Tab. 1 zusammengefassten Datensätze zur Verfügung. Die Grenze des Freistaats wurde mit 10 km gepuffert und die Daten und Analysen auf diesen Pufferstreifen ausgedehnt, um Randeffekte auszuschließen. Aus diesem Grund musste die für Thüringen vorhandene Datengrundlage außerhalb der Grenze ergänzt werden, wofür Daten Verwendung fanden, die im Rahmen des Forschungsprojekts „Entwicklung eines Bewertungsmodells zum Landschaftsbild beim Stromnetzausbau“ von einem Autorenteam unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Roth erarbeitet worden waren. Als Grundlage dienten dort das DGM10 und das ATKIS-Basis-DLM, welche 2016 durch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bereitgestellt worden waren. Das überhöhte DGM im Pufferbereich wurde mithilfe des ATKIS-Basis-DLM und der nutzungsabhängigen generalisierten Höhenwerte nachTäuber & Roth(2011) gebildet.
Um eine realitätsnahe Landbedeckungshöhe zu erhalten, wurde die Differenz von DOM und DGM bereinigt, indem sehr große und sehr kleine Werte, bei denen es sich um Interpolationsfehler handelt, ausgeschlossen wurden. Außerdem blieben bei der Landbedeckungshöhe Freileitungstrassen unberücksichtigt, da es sich bei vorhandenen Freileitungsmasten und -seilen um überwiegend visuell transparente Objekte und nicht um sichtverschattende Hindernisse handelt. Die bereinigte Landnutzungshöhe und das DGM2 wurden in eine Auflösung von 10 m (statt 2 m) interpoliert, um die Rechenzeit der Analyse zu reduzieren, und anschließend addiert, um ein flächendeckendes Oberflächenmodell zu erhalten. Innerhalb des Pufferstreifens wurde das überhöhte Geländemodell ergänzt.
Für die Einsehbarkeit werden die gängigen Parameter für den Untersuchungsradius (10 km), die Augenhöhe (1,57 m, vgl.Jürgens2004) und die Beobachteranordnung (regelmäßiges Raster von 500 m) verwendet.
2.3 Verteilung der Beobachter
Die Beobachter wurden in einem regelmäßigen Raster von 500 m angeordnet, sodass stets 500 m zwischen den einzelnen Beobachterpunkten liegen (vgl.Schulte-Braucks2011: 126f.). Der Ausschluss von Beobachtern beziehungsweise Punkten, die sich innerhalb sichtverschattender Nutzungen (Wald, Siedlung, Gehölz) nach dem ATKIS-Basis-DLM-Datensatz befanden, erfolgte auf der Grundlage der bereinigten Landnutzungshöhe. War diese größer als die durchschnittliche Augenhöhe von 1,57 m, wurde der Beobachterpunkt von der Einsehbarkeitsanalyse ausgeschlossen. Es wird dann davon ausgegangen, dass keine weitreichenden Sichtbeziehungen des Beobachters möglich sind und damit Vertikalobjekte in weiterer Entfernung nicht gesehen werden können.
Die Dichte der resultierenden Beobachter im Radius von 10 km/km2ist in 2 dargestellt.
Die höchste Beobachterdichte ist im Thüringer Becken und im Osterland festzustellen, während vor allem der Thüringer Wald und der Harz geringe Dichten aufweisen. Dies ist auf die dortige vorherrschende Landbedeckung mit Wald zurückzuführen. Durch große Waldflächen wurde eine Vielzahl von Beobachtern in den Mittelgebirgen ausgeschlossen, woraus eine geringere Dichte resultiert. Dagegen handelt es sich vor allem im Thüringer Becken bei der vorherrschenden Landnutzung um Ackerbau. Beobachter sind zumeist in der Lage, die Flächen zu überblicken, da die Augenhöhe größer als die Vegetationshöhe ist.
Die Darstellung veranschaulicht darüber hinaus den Randeffekt. Die äußeren Bereiche der Pufferzone besitzen eine geringere Beobachterdichte und weisen damit als Areale an der Freistaatgrenze hellere Farben auf. Dies liegt daran, dass außerhalb des Puffers keine Beobachter vorhanden sind. Es sehen also weniger Beobachter die Landschaft in einem 10-km-Umkreis ein. Um eine fälschlicherweise zu geringe Einsehbarkeit an der Freistaatgrenze auszuschließen, ist die Pufferung mit dem Radius der Einsehbarkeitsanalyse zwingend notwendig, um genügend Beobachter zu platzieren.
2.4 Parallelisierte Berechnung der Einsehbarkeit
Die Einsehbarkeit wurde für die drei Zielhöhen 60 m, 200 m und 250 m berechnet. Es wurde das Werkzeug „Sichtfeld 1“ (engl. „viewshed 1“) in ArcMap verwendet, um pro Rasterzelle zu berechnen, von vielen Beobachtern die Spitze eines fiktiven Objekts gesehen werden kann. Für das Werkzeug lassen sich Parameter spezifizieren. So wird durch den OFFSETA-Wert die Augenhöhe des Beobachters und durch den OFFSETB-Wert die Anlagenhöhe festgelegt. Bei der Berechnung werden beide Werte stets zur Höhe des zugrundeliegenden Rasters (Geländemodells) hinzuaddiert. Dies führt besonders in bewaldeten Gebieten zu einer zu großen Objekthöhe und damit zu einer fehlerhaften Berechnung der Einsehbarkeit. Indem die Objekthöhen um die Landnutzungshöhe verminderte und die Beobachter hinsichtlich ihrer Höhe absolut über dem DGM (unter Verwendung des SPOT-Wertes) platziert wurden, konnten diese Fehler ausgeschlossen werden.
Die resultierende Datenmenge war allerdings für eine einzelne Workstation zu groß, um eine flächendeckende Einsehbarkeitsanalyse durchführen zu können. Aus diesem Grund wurde die Fläche des Freistaats Thüringen in 60 Kacheln von zumeist 20 x 20 km, zum Teil aber auch 40 x 20 km Größe aufgeteilt. Letzteres war notwendig, um die Gesamtzahl der Kacheln auf 60 zu begrenzen, was der Zahl der parallel zur Verfügung stehenden Workstations für die Berechnung entsprach. Abb. 3 zeigt die Aufteilung des Untersuchungsgebietes. Größere Kacheln sind nur in den Randbereichen zu finden, da die zu berechnende Fläche dort aufgrund der Grenzverläufe kleiner ist, als sie bei zwei vereinten Kacheln im Landesinnern gewesen wäre.
In Abb. 3 ist neben der Kacheleinteilung auch die Pufferung einer Kachel beispielhaft dargestellt. Damit die Einsehbarkeit jeder Kachel ohne Randeffekte berechnet werden konnte, erfolgte eine Pufferung von 10 km. Dies entspricht dem Radius in der Sichtbarkeitsanalyse.
Zur Berechnung der Einsehbarkeit wurde jeder der 60 Workstations eine Kachel zugewiesen. Anschließend wurden die Eingangsdaten auf dem lokalen Laufwerk abgelegt. Hierdurch wird die Berechnung beschleunigt. Die Grundlagendaten pro Kachel beinhalteten das bereinigte DOM und die sichtbaren Beobachter jeweils im 10-km-Puffer der Kachel. Auch Informationen zur Landnutzungshöhe sowie die automatisierten GIS-Modelle zur Berechnung der Einsehbarkeit und zur Zusammenfassung der Teilergebnisse waren in diesen Datenpaketen enthalten. Die nachfolgend beschriebene Berechnung wurde auf jeder Workstation parallel und sukzessive für alle drei Zielhöhen durchgeführt.
Die Einsehbarkeitsanalyse erfolgte durch ein im ArcGIS ModelBuilder erstelltes Modell mit dem Werkzeug „Sichtfeld 1“ (engl. „viewshed 1“). Die Sichtbarkeitshäufigkeit in einer Auflösung von 10 m mit Erdkrümmungsfaktor im 10-km-Umfeld pro Zelle wurde auf der Grundlage des DOM und der Beobachter berechnet. Anschließend wurde die zuvor gepufferte Kachel (siehe oben) auf ihre eigentliche Ausdehnung maskiert, um nur den Teil der Ergebnisse zu verwenden, der durch die Pufferung frei von Randeffekten ist.
Ein grundsätzliches Problem des ArcGIS-Algorithmus ist, dass das Werkzeug „Sichtfeld 1“ nur mit einer Zielhöhe des Untersuchungsobjekts (OFFSETB-Wert; 200 m für Windkraftanlagen) arbeiten kann, die flächendeckend angewendet wird. Das hat zur Folge, dass diese Höhe stets zur Landnutzungshöhe und dem Geländemodell hinzuaddiert wird und die Einsehbarkeit fälschlicherweise für die Summe der Höhen berechnet wird. Daher wurde die Landnutzungshöhe in neun Klassen unterteilt und es wurden neun Einsehbarkeitsanalysen mit den Werten der Differenz von Zielanlagenhöhe (OFFSETB-Wert) und Landnutzungshöhe durchgeführt. Somit entsprach die Addition von Landnutzungshöhe und veränderter Anlagenhöhe der Zielanlagenhöhe. Nur so konnte eine korrekte Berechnung der Einsehbarkeit auf Basis des DOM erfolgen (siehe oben). Die neun Rasterdateien wurden zum Gesamtergebnis hinzuaddiert, da für jede Zelle nur ein Wert abhängig von der Landnutzungshöhe vorlag. Nachdem die Ergebnisse für jede Kachel vorlagen, wurden diese für jede Anlagenhöhe separat zu einem flächendeckenden Ergebnis zusammengeführt und auf die Grenzen des Freistaats Thüringen zugeschnitten.
4 Ergebnisse
Im Ergebnis wurde die Einsehbarkeit als Sichtbarkeitshäufigkeit für die drei Anlagenhöhen 60 m, 200 m und 250 m mit einer Auflösung von 10 m quantifiziert. Die Sichtbarkeitshäufigkeit gibt die Anzahl der fiktiven Beobachter im Umkreis von 10 km um jeden beliebigen Standort an, die die Spitze eines Objekts in der vorgegebenen Höhe sehen würden, wenn das Objekt an diesem Standort platziert werden würde. Von der Sichtbarkeitshäufigkeit kann direkt auf die Einsehbarkeit geschlossen werden. Ausgehend von dieser Grundlage kann die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes für den Freistaat Thüringen abgeleitet werden.
Aufgrund des parallelisierten Ansatzes konnte die Einsehbarkeit innerhalb von rund 30 Stunden Rechenzeit auf 60 Workstations berechnet werden. Hätte nur eine Workstation zur Verfügung gestanden, wären rund 40 Tage Rechenzeit benötigt worden. Zu der eigentlichen Berechnung kam noch zusätzlicher Zeitaufwand durch das Verteilen der Daten auf die Workstations, das Vorbereiten der Modelle und das Bilden eines Gesamtergebnisses für den Freistaat Thüringen hinzu. So wurden insgesamt etwa 40 Stunden Rechenzeit benötigt.
Im Folgenden werden beispielhaft die Sichtbarkeitshäufigkeit für 200 m hohe Mastobjekte in Abb. 4 und die klassifizierte Einsehbarkeit des Freistaats in Abb. 5 gezeigt, welche die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber derart hohen Strukturen hinreichend annähert.
Zumeist besitzen Flusstäler eine geringere Einsehbarkeit. Auch Landschaften, die durch einen hohen Anteil von Waldflächen geprägt sind, besitzen eine geringere Einsehbarkeit, was zum Beispiel auf den Thüringer Wald, das Thüringer Schiefergebirge oder den Harz zutrifft. In allen Einsehbarkeitsanalysen besitzen das Thüringer Becken und das Osterland die höchste Einsehbarkeit. In der klassifizierten Darstellung in Abb. 5 sind diese prägnanten Raumgrenzen nochmals besser erkennbar.
Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes wird durch die relative Einsehbarkeit ausgedrückt. Die Klassifizierung erfolgt in Quantilen, damit jede Klasse in etwa den gleichen Flächenanteil des Freistaats von einem Siebtel abdeckt. Quantile basieren auf einer linearen Verteilung und sind somit objektiv. Damit wird die Untersuchung ihrem Ziel gerecht, eine fundierte Grundlage für planerische Abwägungsentscheidungen in der Alternativenprüfung zu schaffen. Mithilfe der Daten kann für einen Anlagentyp mit einer bestimmten Höhe ein Vergleich der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes für verschiedene Alternativen erfolgen.
Ein Vergleich der Ergebnisse unterschiedlicher Untersuchungshöhen untereinander ist nur anhand der absoluten Anzahl einsehender Beobachter möglich. Es kann keine Aussage getroffen werden, ob und um wie viel mehr eine Landschaft durch andere Masthöhen beeinträchtigt wird.
Beispiele für Landschaften mit einer sehr hohen und einer geringen Einsehbarkeit sind in Abb. 6 und 7 zu sehen.
5 Diskussion der Methode
Innerhalb einer Einsehbarkeitsanalyse werden reale Zusammenhänge vereinfacht dargestellt, wodurch Abweichungen von der realen Landschaft möglich sind. Nur eine Begehung vor Ort kann diese Abweichungen bereinigen, was aber nur für realisierte Objekte möglich ist und nicht für die Ergebnisse von flächendeckenden Einsehbarkeitsanalysen (Rothet al. 2015).
Um eine Validierung der Ergebnisse der Einsehbarkeit der Landschaft durchzuführen, wurden Fotoaufnahmen herangezogen, die während einer Begehung verschiedener Thüringer Landschaften entstanden sind. Das Landschaftsgefüge auf den Fotos und die hierdurch abgebildete Transparenz, das Relief und der Sichtraum der Landschaft wurden mit den kartografischen Ergebnissen der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes verglichen. Die ausgewählten Fotostandorte zeigten eine hohe Übereinstimmung zwischen der wahrgenommenen Einsehbarkeit und der berechneten Einsehbarkeit der Landschaft.
Die GIS-gestützte Analyse zur Einsehbarkeit der Landschaft hat gezeigt, dass eine geringe Empfindlichkeit des Landschaftsbildes in Bereichen mit ausgeprägtem Relief und/oder hohem Waldanteil vorliegt (vergleiche auchFischer2018,Roth & Fischer2018). Das Wechselspiel zwischen Bergen und Tälern sowie die Vertikalstruktur des Waldes führen zu einer Sichtverschattung potenzieller Anlagen, indem das Sichtfeld des Beobachters beschränkt wird. Der Zusammenhang zwischen Beobachterdichte und Sichtbarkeitshäufigkeit wird durch den Vergleich von Abb. 2 und Abb. 4 deutlich. Dementsprechend sind offene Landschaften ohne sichtverschattende Strukturen besonders empfindlich gegenüber Vertikalbauwerken. Eine Besonderheit im Freistaat Thüringen stellt die Rhön dar. Obwohl dort sowohl Wald als auch Relief vorzufinden sind, sind weitreichende Fernsichten möglich. Dies ist auf die offenen Kuppenlagen zurückzuführen, die eine hohe Einsehbarkeit bewirken.
Ausgehend von den gewonnenen Vor-Ort-Erfahrungen, der Validierung der Ergebnisse anhand von Fotos und den mit anderen Studien übereinstimmenden Beobachtungen wird die Plausibilität der Vorgehensweise zur Operationalisierung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes begründet. Darüber hinaus sind durch die Automatisierung aufgrund der Nutzung eines geografischen Informationssystems Nachvollziehbarkeit und Objektivität gewährleistet. Die Berechnung führt unabhängig von den Bearbeitern bei Nutzung derselben Daten zu identischen Resultaten. Dies trägt zu Reproduzierbarkeit und Reliabilität bei. Die Verwendung von gültigen und aktuellen Daten (vgl.Rothet al. 2015) ermöglichte gute Ergebnisse der Einsehbarkeit der Thüringer Landschaft. Da die Ergebnisse sachgerecht auf die Realität übertragen werden können, sind Anforderungen an die Validität wissenschaftlicher Methoden ebenso gegeben. Hinsichtlich der Übertragbarkeit auf andere als die untersuchten Zielobjekthöhen gilt: Die Sichtbarkeitshäufigkeit kann für andere Objekte von ähnlicher Höhe herangezogen werden, um die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes zwischen Standortalternativen abzuschätzen und tendenzielle Aussagen zu treffen. Jedoch wäre eine eigenständige Einsehbarkeitsanalyse mit der entsprechenden Höhe valider.
6 Schlussfolgerungen für die Praxis
Es konnte gezeigt werden, dass es möglich ist, die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes durch die Einsehbarkeit der Landschaft zu quantifizieren. Durch die Operationalisierung auf parallel rechnenden Workstations können innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit für einen großen Untersuchungsraum Ergebnisse mit sehr hoher Auflösung erzeugt werden. Ob die Errichtung eines Freileitungsmastes oder einer Windkraftanlage in den Gebieten überhaupt zulässig ist, wird in diesem Projekt allerdings nicht betrachtet.
Die Analyse der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes fungiert als Planungsgrundlage auf übergeordneten Ebenen. So können fundierte und raumkonkrete Entscheidungen in der Bauleitplanung, der Raumordnung oder der Landschaftsplanung unterstützt werden, besonders in Kombination mit anderen Datengrundlagen. Ausführungsplanung und Eingriffsregelung müssen durch konkrete Sichtbarkeitsanalysen unterstützt werden, wenn konkrete Anlagenstandorte beziehungsweise Alternativen feststehen.
Die besondere Stärke der Einsehbarkeitsanalyse liegt aber in der feinräumigen Auflösung. Besonders die Alternativenprüfung der strategischen Umweltprüfung oder der Umweltverträglichkeitsprüfung kann von einer Berechnung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes profitieren, um Vermeidungsgebot und Vorsorgeprinzip des BNatSchG umzusetzen. So können aufgrund der nun verfügbaren Kenntnisse Bereiche, die von einer besonders hohen Einsehbarkeit geprägt sind, geschützt werden. Durch die Auflösung von 10 m können die Ergebnisse darüber hinaus für die konkrete Stationierung von Mastobjekten in der Mikroplanung herangezogen werden. Bereits die Verschiebung einer Windkraftanlage oder eines Freileitungsmastes um wenige hundert Meter kann signifikante Auswirkungen auf die spätere Sichtbarkeit der Anlage haben. Die hier vorgestellte Quantifizierung der Einsehbarkeit ermöglicht die raumkonkrete Reduzierung des Bereichs, der durch die visuelle Wirkung der Anlage beeinträchtigt ist.
Die Ergebnisse indizieren Täler als weniger einsehbare Bereiche und geben somit den Planungshinweis, diese bei der Errichtung von Vertikalbauwerken zu bevorzugen. Ob dies allerdings unter den lokalen Gegebenheiten tatsächlich sinnvoll ist, ob zudem Platz vorhanden ist und das Vorhaben dort realisiert werden kann, ist stets im Einzelfall zu prüfen.
Auch in Wäldern wird eine geringe Empfindlichkeit festgestellt. Wenn allerdings Schneisen für den Bau von Mastbauwerken geschlagen werden müssen, verändert dies das Wirkgefüge, was wiederum die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes beeinflusst.
Insgesamt wird durch das vorliegende Projekt nur ein kleiner Teil der möglichen Umweltauswirkungen betrachtet, die mit der Errichtung von technischen Vertikalbauwerken in der Landschaft einhergehen. Selbst in der Empfindlichkeitsbewertung des Landschaftsbildes, wie sie hier vorgestellt wurde, wird nur der quantitative Aspekt der Sichtbarkeitshäufigkeit betrachtet. Weiterhin wichtig sind qualitative Wertminderungen der Erlebnisdimensionen Vielfalt, Eigenart und Schönheit und deren besondere Ausprägung, Seltenheit oder Schutzwürdigkeit.
Innerhalb der Abwägungsentscheidungen müssen auch die Belange der anderen Schutzgüter des UVPG beziehungsweise weitere Aspekte der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Landschaft und des Naturhaushaltes (Eingriffsregelung) betrachtet werden, um die naturschutzfachlich günstigste Alternative zu ermitteln. Diese Entscheidungsfindung wird durch wirtschaftliche, soziale und politische Interessen zusätzlich beeinflusst. Dennoch sind die Autoren dieses Beitrags davon überzeugt, dass durch die Datengrundlage zur Einsehbarkeit/Empfindlichkeit des Landschaftsbildes ein „blinder Fleck“ der vorhabenbezogenen Umweltplanung gefüllt werden kann. Damit können das Landschaftsbild in der Umweltplanung im Besonderen und eine holistische Umweltbewertung im Allgemeinen gestärkt werden.
7 Ausblick
Der vorgestellte Ansatz kann problemlos auf andere Gebiete und Objekte übertragen werden, wenn entsprechende Datengrundlagen vorhanden sind. So könnte das Wissen um besonders empfindliche Bereiche für einen Ausschluss als Tabuflächen in Planungen verwendet werden, um besonders empfindliche Landschaften von Landschaftsbildbeeinträchtigungen freizuhalten.
Die vollständige Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes erfordert die Integration weiterer Informationsebenen in die Bewertung. Zwar ist die Verwendung der Sichtbarkeitshäufigkeit als Indikator für die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes eine gute Grundlange, jedoch ist eine Erweiterung der Analyse denkbar. So wäre eine Gewichtung der einsehenden Beobachter mit zunehmender Entfernung zum Standort denkbar (vergleichePaulet al. 2004), da Vertikalbauwerke im Nahbereich eine stärkere visuelle Wirkung besitzen. Weitere Möglichkeiten, eine Gewichtung der Einsehbarkeit vorzunehmen, wären die Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte bei der Verteilung der fiktiven Beobachterpunkte, die Betonung von Räumen mit besonderer Bedeutung für den Tourismus oder die Einbeziehung durchschnittlicher Sichtweiten im Raum. Kenntnisse der Vorbelastung der Landschaft würden eine noch spezifischere Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes ermöglichen.
Literatur
Augenstein, I. (2002): Ästhetik der Landschaft. Ein Bewertungsverfahren für die planerische Umweltvorsorge. Berliner Beiträge zur Ökologie, Bd. 3. Weißensee Verlag, Berlin.
BfN (Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., 2019): Erneuerbare Energien Report. Die Energiewende naturverträglich gestalten. Bonn-Bad Godesberg.
BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Hrsg. 2017): Ergebnispapier Strom 2030. Langfristige Trends Aufgaben für die kommenden Jahre. Berlin.
Chamberlain, B., Meitner, M.(2013): A route-based visibility analysis for landscape management. Landscape and Urban Planning 111, 13-24.
Fischer, C.(2018): GIS-basierte Einsehbarkeitsanalyse zur flächendeckenden Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbilds gegenüber oberirdischen Höchstspannungsleitungen. UVP-Report 32, 129-134.
Gerhards, I.(2003): Die Bedeutung der landschaftlichen Eigenart für die Landschaftsbildbewertung. Dargestellt am Beispiel der Bewertung von Landschaftsbildveränderungen durch Energiefreileitungen. Culterra 33. Freiburg im Breisgau, Universität Freiburg, Institut für Landespflege.
Haubaum, C., Roth, M.(2015): GIS-gestützte Sichtbarkeitsanalysen von Hochspannungsleitungen – Grundlage zur landschaftsästhetischen Beurteilung von Energietrassen. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (7), 209-214.
Jürgens, H.(2004): Erhebung anthropometrischer Maße zur Aktualisierung der DIN 33 402 – Teil 2. Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Forschungsbericht, Fb 1023. Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven.
Lienert, P., Sütterlin, B., Siegrist, M.(2018): Public acceptance of high-voltage power lines: The influence of information provision on undergrounding. Energy Policy 112, 305-315.
Paul, H.-U., Uther, P., Neuhoff, M., Winkler-Hartenstein, K., Schmidtkunz, H., Grossnick, J.(2004): GIS-gestütztes Verfahren zur Bewertung visueller Eingriffe durch Hochspannungsfreileitungen. Naturschutz und Landschaftsplanung 35 (5), 139-144.
Roth, M., Bruns, E.(2016): Landschaftsbildbewertung in Deutschland – Stand von Wissenschaft und Praxis. BfN-Skripten 439.
–, Fischer, C.(2018): Großräumige hochauflösende Einsehbarkeitsanalysen als Beitrag zur Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber oberirdischen Hochspannungsleitungen. AGIT – Journal für angewandte Geoinformatik 4-2018, 404-414.
–, Gruehn, D.(2014): Digital Participatory Landscape Planning for Renewable Energy – Interactive Visual Landscape Assessment as Basis for the Geodesign of Wind Parks in Germany. In: Wissen Hayek, U., Fricker, P., Buhmann, E. (Hrsg.): Peer Reviewed Proceedings of Digital Landscape Architecture 2014 at ETH Zurich. Berlin, Offenbach, Herbert Wichmann Verlag, 84-94.
–, Junker, S., Tilk, C., Haubaum, C., Schulte-Braucks, K.(2015): To See or not to See: A Critical Investigation of Validity in Visibility Analysis for Assessing Landscape Impacts of Energy Infrastructure. In: Buhman, E., Ervin, S., Pietsch, M. (Hrsg.): Peer Reviewed Proceedings of Digital Landscape Architecture 2015 at Anhalt University of Applied Sciences. Berlin, Offenbach, Herbert Wichmann Verlag, 82-89.
Schulte-Braucks, K.(2011): Vorsorgender Einsatz GIS-basierter Sichtbarkeitsanalysen bei der Ausweisung von Anlagenstandorten in der Flächennutzungsplanung. Diplomarbeit, Technische Universität Dortmund.
Täuber, M.-A., Roth, M.(2011): GIS-basierte Sichtbarkeitsanalysen. Ein Vergleich von digitalen Gelände- und Landschaftsmodellen als Eingangsdaten von Sichtbarkeitsanalysen. Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (zfv) 136 (5), 293-301.
Fazit für die Praxis
- Einsehbarkeitsanalysen ermöglichen die flächendeckende Operationalisierung der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber Vertikalobjekten.
- Die Berechnung der Einsehbarkeit mittels eines parallel rechnenden Clusters von GIS-Workstations ermöglicht auch für großflächige Gebiete eine hohe Auflösung des Ergebnisses bei gleichzeitiger Beschränkung der Rechenzeit.
- Kenntnisse der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes sind essenziell, um das Landschaftsbild in der Planungspraxis sachgerecht abbilden zu können.
- Die Ergebnisse können beispielsweise für die Alternativenprüfung der SUP oder für die Standortbestimmung im Planfeststellungsverfahren herangezogen werden. Somit sind fundierte Entscheidungen möglich, die erhebliche Eingriffe in das Landschaftsbild vermeiden und vermindern. Besonders empfindliche Landschaften können geschützt werden.
Kontakt
Caroline Fischer B.Eng. ist seit 2018 Forschungsmitarbeiterin am Institut für Landschaft und Umwelt der HfWU in Nürtingen. Forschungsschwerpunkte: Landschaftsbild und Empfindlichkeit des Landschaftsbildes. Studium Landschaftsplanung und Naturschutz B. Eng. an der HfWU in Nürtingen. Laufendes Studium Landscape Ecology an der Universität Hohenheim.
Prof. Dr. Michael Roth ist seit 2013 Professor an der HfWU in Nürtingen. Forschungsschwerpunkte: Landschaftsbild, Landschaftsbewertung und Landschaftsplanung, GIS und Partizipation. Studium der Landespflege an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden; Promotion an der TU Dortmund, Fakultät Raumplanung. Von 2002 bis 2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin und von 2006 bis 2013 an der TU Dortmund. Längere Lehr- und Forschungsaufenthalte an der Michigan State University (2011 bis 2012) und University of British Columbia (2013).
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

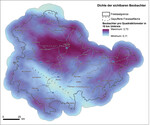

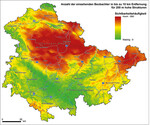
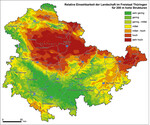









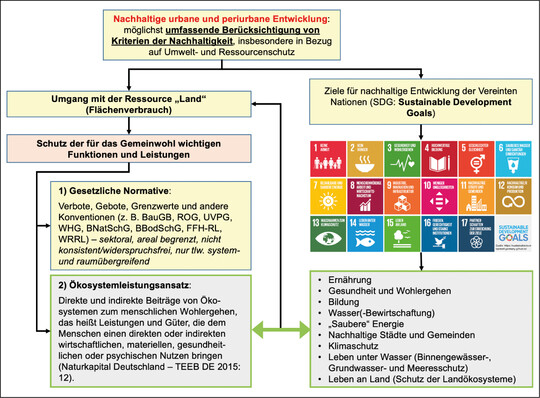

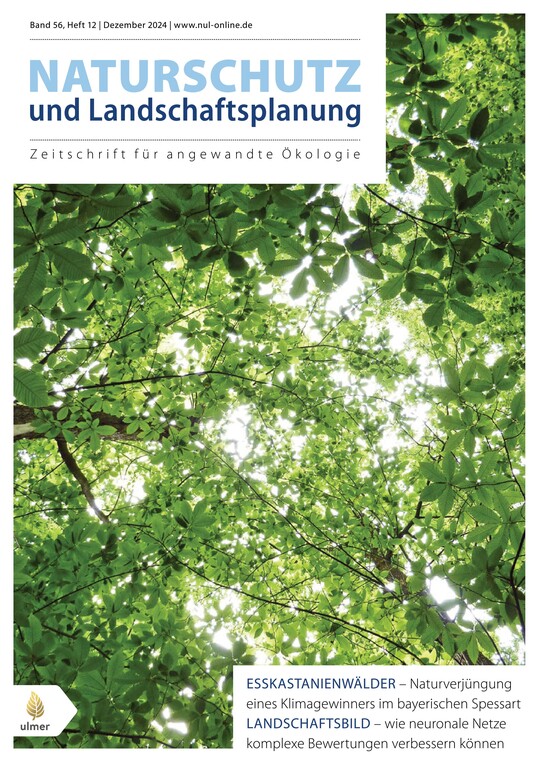
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.