Zur Renaturierung mariner Ökosysteme
Abstracts
Die Renaturierung von anthropogen degradierten Ökosystemen ist weltweit zu einer Herausforderung für die Gesellschaft geworden. Sowohl die Praxis der Ökosystemrenaturierung als auch die Wissenschaft der Renaturierungsökologie haben in den vergangenen Jahrzehnten umfangreiche Erfahrungen zur Wiederherstellung der Ökosystemleistungen auf terrestrischen Standorten, einschließlich der Seen, der Flüsse mit ihren Auen und der Feuchtgebiete gesammelt. Im Gegensatz hierzu bestehen zur Renaturierung von marinen Ökosystemen noch erhebliche konzeptionelle Defizite, obwohl die anthropogene Belastung der Meeresökosysteme weltweit ein erhebliches Ausmaß erreicht hat. Während einige grundsätzliche Konzepte, Zielsetzungen und Renaturierungsmaßnahmen vom terrestrisch-limnischen Bereich auf marine Ökosysteme übertragen werden können, bedarf es auch spezifischer Herangehensweisen zur Renaturierung von Meeresökosystemen, die deren große horizontale und vertikale Dimension in Betracht ziehen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund der bestehenden biologisch-ökologischen Wissenslücken bzgl. der Meeresökosysteme mit ihren Organismen. Bei der Renaturierung mariner Ökosysteme werden, bezogen auf Nord- und Ostsee, drei räumlich differenzierte Handlungsebenen unterschieden. Die umweltpolitischen Rahmenbedingungen auf nationaler wie auch internationaler Ebene sind für eine Renaturierung mariner Ökosysteme in Europa gegeben.
Restoration of marine ecosystems – Examples from the North Sea and Baltic Sea - an international challenge
Worldwide, the restoration of anthropogenically degraded ecosystems has become a challenge for human society. Practical ecosystem restoration, as well as restoration ecology as the related science, has gathered comprehensive experience in restoring ecosystem services during recent decades, in particular on terrestrial sites including lakes, rivers with their floodplains, as well as on wetlands. In contrast, there are considerable conceptional knowledge gaps with regard to marine ecosystems, although the environmental damage to marine ecosystems has reached a tremendous degree.
Whereas some basic concepts and objectives as well as restoration measures can be transferred from terrestrial and limnic to marine ecosystems, there is also a need for specific approaches for the restoration of marine systems; these take their huge vertical and horizontal dimension into account and address the ecological knowledge gaps with regard to these marine ecosystems and their organisms. With a focus on the North Sea and the Baltic Sea, three spatially differentiated areas of operational activity for ecosystem restoration are identified. Environmental policy at the national as well as the international level provides a framework for ecosystem restoration action in Europe.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Die Renaturierung von anthropogen degradierten Ökosystemen ist weltweit zu einer Herausforderung für Wissenschaft und Praxis geworden.Walder(2018) bringt dies auf den Punkt, indem sie konstatiert, dass die Ökosystemrenaturierung einen der wichtigsten Schritte zum Überleben der Menschheit auf unserem Planeten darstellt. Sowohl die Praxis der Ökosystemrenaturierung als auch die Wissenschaft der Renaturierungsökologie haben in den vergangenen Jahrzehnten umfangreiche Erfahrungen zur Wiederherstellung der Ökosystemleistungen auf terrestrischen Standorten, einschließlich der Seen, der Flüsse mit ihren Auen und der Feuchtgebiete gesammelt. Von 1980 (Bradshaw & Chadwick1980) bis heute sind die Ergebnisse in eine große Zahl von Lehr- und Fachbüchern eingeflossen.Zerbe(2019) stellt über 50 Fachbücher für den Zeitraum 1980 bis 2018 zusammen, die sich thematisch bzw. geografisch übergreifend mit der Renaturierung von Ökosystemen befassen. Hierbei werden sowohl naturnahe Ökosysteme wie Wälder, Moore, Seen, Flüsse und alpine Matten als auch Nutzungssysteme wie beispielsweise Grünland, Trockenrasen, Heiden, Äcker und Agroforstsysteme berücksichtigt. Das Maßnahmeninventar zur Renaturierung von Ökosystemen bzw. zur Wiederherstellung der eingeschränkten oder verlorengegangenen Ökosystemleistungen bedient sich einerseits der gängigen Ansätze der konventionellen Landnutzung (z. B. Mahd), des Biotopmanagements (z. B. extensive Beweidung) und der Ingenieurbiologie (z. B. Raseneinsaaten, Transplantation von Rasensoden), andererseits sind neue Ansätze entwickelt worden, wie etwa die Phytoremediation oder die Wiedervernässung und Flachabtorfung bei Mooren. Die internationale Society for Ecological Restoration (SER) bietet eine Plattform des Wissens- und Erfahrungsaustauschs und stellt konzeptionelle und praktische Empfehlungen für die Ökosystemrenaturierung zur Verfügung (Clewellet al. 2005, SER 2004).
Vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit wird allerdings bisher der Renaturierung mariner Ökosysteme gewidmet. Dies mag einerseits daran liegen, dass es immer noch erhebliche Wissenslücken bezüglich der Meeresökosysteme und insbesondere der Tiefsee gibt (Elliottet al. 2007,Ramirez-Llodraet al. 2011), und andererseits daran, dass die z. T. enorme horizontale und vertikale Dimension der Meere die herkömmlichen und im terrestrischen und limnischen Bereich erprobten Renaturierungsansätze an ihre Grenzen bringt. In der Vergangenheit nahm man an, dass die Meere allein durch ihre große Ausdehnung und ihre Fähigkeit zur Selbstregeneration durch menschliche Eingriffe nicht wirklich geschädigt werden könnten. Die Meere stellten eine Art der „Allmende“ dar, die allerdings, anders als bei sozialen, ihre gemeinsamen Ressourcen nachhaltig nutzenden Gemeinschaften (Ostrom1990), ausgebeutet und nicht nachhaltig genutzt wurde. Überfischung, direkter und indirekter Nähr- und Schadstoffeintrag sowie der stete Eintrag von Müll, welcher vom Festland über die Flüsse oder von den Küstenstädten direkt in die Meere gespült wird, stellen heute globale Umweltprobleme dar. Für die sehr verzögerten umweltpolitischen Initiativen zum Schutz der Meeresökosysteme dürfte eine Rolle spielen, dass die Auswirkungen der Umweltbelastungen nicht unmittelbar wahrgenommen werden, sondern sich mitunter in großer räumlicher und zeitlicher Distanz und eher im Verborgenen abspielen.
NachHalpernet al. (2008) gehört die Nordsee zu den am stärksten belasteten Meeren der Erde, wenn alle anthropogenen Einflüsse kumulativ berücksichtigt werden. Für die Ostsee wurde bereits Anfang dieses Jahrhunderts davon ausgegangen, dass ca. 90 % der marinen und der Küstenlebensräume gefährdet sind (HELCOM 2003,Nordheim & Boedecker2000). Die aktuelle Rote Liste der Meeresorganismen beurteilt bei ca. 1750 berücksichtigten Taxa der Fische, der bodenlebenden Wirbellosen und der Großalgen der deutschen Küsten- und Meeresgebiete 30 % als gefährdet (Beckeret al. 2013).
In Europa sind der Schutz und die Wiederherstellung von Ökosystemleistungen der Meeresökosysteme spätestens mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) der EU (2008) auf die internationale umweltpolitische Agenda gerückt. Ein nachhaltiges Umweltmanagement der Nord- und Ostsee mit ihren Küstenökosystemen kann sich auf bereits vorliegende umfangreiche biologisch-ökologische Grundlagen, ein kontinuierliches Monitoring und daraus abgeleitete praktische Handlungsempfehlungen stützen (u. a.Liedlet al. 1992,Lozánet al. 1990,Salomon2018,Schernewski & Schiewer2002). Umweltpolitisch richtungsweisend sind hier insbesondere die Berichte zur Umsetzung der Europäischen Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie in Deutschland, mit denen für jede Meeresregion eine Anfangsbewertung und eine Beschreibung des Umweltzustandes vorgenommen und entsprechende Umweltqualitätsziele formuliert werden (z. B. BMU 2012a, b). Beispielsweise spiegelt auch die Schwerpunktsetzung des Deutschen Naturschutztages 2018 wider, dass der Schutz der Meeresökosysteme auf nationaler wie internationaler Ebene zunehmend in die öffentliche Debatte rückt.
Im Folgenden werden, mit einer Schwerpunktsetzung auf die Nord- und Ostsee, einige konzeptionelle Überlegungen zur Renaturierung mariner Ökosysteme diskutiert, wobei hier der Definition der Ökosystemrenaturierung vonZerbe(2019) gefolgt wird. Hierzu werden die drängende Handlungsnotwendigkeit dargestellt, die sich aufgrund der marinen Umweltprobleme ergibt, eine allgemeine Renaturierungsstrategie eingeführt und einige Beispiele aus der Renaturierung mariner Ökosysteme bzw. von deren Kompartimenten umrissen.
2 Zur Ökologie und naturschutzfachlichen Bedeutung von Nord- und Ostsee
Die Nordsee mit ca. 750 000 km2Fläche gehört aufgrund ihrer geringen Meerestiefe (im Mittel 90 m, max. 725 m) und der engen Verzahnung mit den europäischen Küsten zu einem der weltweit produktivsten Meere. Neben den reichen Fischbeständen besteht aufgrund des Vorkommens von Gas und Öl im Meeresboden ein direkter und hoher Nutzungsdruck. Hinzu kommt der, in globaler Perspektive, außerordentlich hohe Schiffsverkehr. Mit den Küstenanrainern England, Schottland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich hat die Nordsee als ein internationales Meer ein Wassereinzugsgebiet von ca. 850 000 km2Fläche (Walday & Kroglund2008a), in dem ca. 184 Mio. Menschen leben (OSPAR 2000). Die Küstenlebensräume sind sehr vielfältig und umfassen beispielsweise felsige Fjorde (Norwegen), Kliffs und Kiesstrände (England und Schottland), ausgedehnte Sandstrände bzw. Dünen (Dänemark), das Wattenmeer mit seinen typischen Salzwiesen (die Niederlande, Deutschland, Dänemark) und zahlreiche Ästuare, die Mündungsgebiete der großen Flüsse.
In der Nordsee kommen ca. 230 Fischarten vor, mit in der Regel höherer Artenvielfalt in Küstennähe, wobei bei zahlreichen Fischarten ein Wanderverhalten im Jahresverlauf bzw. im Verlauf ihres Lebenszyklus zu beobachten ist (ICES 2008). Somit verknüpfen einige Fischarten die Lebensräume Meer und Fluss durch ihre Lebensweise, wie z. B. der Atlantische Lachs. Die Gesamtbiomasse der Fische in der Nordsee wurde in den vergangenen Jahrzehnten auf 10–12 Mio. t geschätzt, wobei im Zeitraum 1950 bis 2000 jährlich 2–4 Mio. t abgefischt wurden (ICES 2008, OSPAR 2010,Walday & Kroglund2008b). Die Vogelpopulationen der Nordsee werden als global bedeutsam angesehen (Walday & Kroglund2008b). Im Küstenbereich brüten ca. 30 Arten und ca. 10 Mio. Vögel halten sich während der meisten Zeit des Jahres dort auf. Insbesondere kommt dem Wattenmeer mit dem Vorkommen von über 50 Brut- bzw. Zugvogelarten und Individuenzahlen von jährlich bis zu 12 Mio. Tieren eine hohe Bedeutung als Lebensraum zu (ICES 2008, OSPAR 2000, 2010).
Das Binnenmeer der Ostsee mit einer Flächengröße von ca. 370 000 km2und einer mittleren Meerestiefe von 57 m (max. 459 m) ist mit dem geringen Salzgehalt (ca. 6–18 ‰) und der nur schmalen Verbindung des Kattegats und Skagerraks zur Nordsee ein Brackwassersystem mit einem nur geringen Tidenhub. Die ausgeprägten horizontalen und vertikalen Salinitätsgradienten der Ostsee beeinflussen die Vielfalt von Lebensgemeinschaften, mit der höchsten Biodiversität im Südwesten der Ostsee. Süßwasserarten können gemeinsam mit typischen Arten des Meeres auftreten. Mit den Anrainerstaaten Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, der Russischen Föderation, Estland, Lettland, Litauen und Polen hat die Ostsee ein internationales Wassereinzugsgebiet von 1 650 000 km2, in dem ca. 80 Mio. Menschen leben (Walday & Kroglund2008a).
Die Fischfauna der Ostsee umfasst ca. 100 Arten des Meeres und des Süßwassers. Rund 80 Vogelarten nutzen das Gebiet der Ostsee als Nahrungs- bzw. Bruthabitat oder zur Rast und zum Überwintern, insbesondere die sandigen Flachwasserbereiche und Ästuare (HELCOM 2017). Über ein Drittel dieser Vogelarten ist als stark bis potenziell gefährdet eingestuft, darunter z. B. Alpenstrandläufer ( Calidris alpina ; Abb. 1), Dreizehenmöwe ( Rissa tridactyla ), Schwarzkopfmöwe ( Larus melanocephalus ) und Terekwasserläufer ( Xenus cinereus ) (HELCOM 2013).
In beiden Meeren werden zudem die Säugetiere Kegelrobbe ( Halichoerus grypus ) und Seehund ( Phoca vitulina ) und in der Nordsee 16 Wal- und Delphinarten, wie z. B. Gemeiner Delfin ( Delphinus delphis ), Grindwal ( Globicephala melas ), Rundkopfdelfin ( Grampus griseus ), Weißseitendelfin ( Lagenorhynchus acutus ) und Schwertwal ( Orcinus orca ) regelmäßig beobachtet (OSPAR 2000,Walday & Kroglund2008b). In der Ostsee kommen der Gewöhnliche Schweinswal ( Phocoena phocoena ) und die Ostsee-Ringelrobbe ( Pusa hispida botnica ) hinzu.
3 Bedeutung der Meeresökosysteme für den Menschen: Ökosystemleistungen
Dem Konzept der Ökosystemleistungen folgend (Grunewald & Bastian2012, MEA 2005), lässt sich auch für Meeresökosysteme die hohe Bedeutung für den Menschen qualitativ und quantitativ erfassen. Für die Nord- und Ostsee, auch weltweit übertragbar auf andere Meeresökosysteme, sind diese vielfältigen Ökosystemleistungen zusammenfassend in Tab. 1 dargestellt.
4 Ökologischer Zustand der Ost- und Nordsee und Ableitung des Renaturierungsbedarfs
Weltweit ist der Zustand vieler Meeresökosysteme aus der Sicht des Umwelt-, Natur- und Ressourcenschutzes besorgniserregend. So sind z. B. bis zu 50 % der Kommunen im östlichen Ostseeraum, d. h. insbesondere in Russland, Polen und Litauen, noch nicht an Wasserkläranlagen angeschlossen (COWI 2007,Haahtiet al. 2010), so dass dort große Mengen an Stickstoff und Phosphor in die Ostsee gelangen (Hautakangaset al. 2014). In der Tat sind die Meere die Sammelbecken für das gesamte Wasser aus den terrestrischen Einzugsgebieten und den darin enthaltenen Nähr- und Schadstoffen, aber auch für die direkt ins Meer eingeleiteten Stoffe, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Qualität des Meerwassers und die darin lebenden Organismen.
Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Meeresökosysteme mit einer Veränderung des Meeresspiegels und der Wassertemperaturen (Hoegh-Guldberg & Bruno2010) und einer Versauerung des Meerwassers (Doneyet al. 2009). Während früher insbesondere die Küstenräume bzw. das küstennahe Meer genutzt und anthropogen verändert wurden (Abb. 2), bestehen heute durch die Hochseefischerei, den Offshore-Abbau von Rohstoffen (Abb. 3) und den Abfalleintrag hohe Umweltbelastungen auch in den tieferen bzw. küstenfernen Meeresbereichen (Ramirez-Llodraet al. 2011). Aufgrund der vielfältigen anthropogenen Belastungen, die auf Nord- und Ostsee wirken, sind zahlreiche Lebensräume mit ihrer typischen Artenzusammensetzung gefährdet (Tab. 2). Die in Tab. 2 angegebenen Einflussfaktoren stehen hierbei untereinander in einem zum Teil komplexen Wirkungsgefüge.
Eine Übersicht über die Umweltbelastungen von Nord- und Ostsee wird in Tab. 3 gegeben, wobei die Auswirkungen auf die biotischen Faktoren in komplexen Wechselwirkungen mit den abiotischen Faktoren stehen können und umgekehrt, wie z. B. bei einer Eutrophierung und der Algenblüte. Für weiterführende Erläuterungen mit den entsprechenden Literaturangaben sei aufZerbe(2019) und das kürzlich erschienene „Handbook on Marine Environment Protection“ (Salomon & Markus2018) verwiesen.
Es muss hervorgehoben werden, dass diese Umweltbelastungen nicht allein ein ökologisches bzw. naturschutzfachliches Problem darstellen, sondern auch erhebliche negative Auswirkungen auf die sozioökonomischen Bedingungen der Meeresanrainerstaaten haben können, wie dies beispielsweise für die Beifänge belegt ist. Wenn kommerziell nutzbare Fische als Beifänge wieder über Bord gehen und dabei zu einem hohen Anteil verenden, gehen diese dem Bestand und seiner Produktivität verloren (SRU 2011). Für die dänische Baumkurrenfischerei (mit Grundschleppnetzen) und die Fischerei auf Rundfische in Großbritannien wurde z. B. berechnet, dass der direkte Verlust an möglichem Einkommen durch den Rückwurf 70 bzw. 42 % des Wertes der jährlichen Anlandung ausmacht (Cappell2001).
5 Räumlich differenzierte Renaturierungsansätze für marine Ökosysteme
Aus den in Tab. 3 zusammengefassten Umweltbelastungen der beiden Meeresökosysteme Nord- und Ostsee ergibt sich zwingend ein Renaturierungsbedarf, um die in Tab. 1 dargestellten Ökosystemleistungen wiederherzustellen bzw. nachhaltig zu gewährleisten. Hierbei werden drei räumlich differenzierte Handlungsebenen für die Renaturierung der Meeresökosysteme bzw. Kompartimente derselben identifiziert (Tab. 4):
1) Renaturierung des terrestrischen Einzugsgebiets der Meere, einschließlich der Flüsse und Seen,
2) Renaturierung von Küstenlebensräumen als Übergangszone vom Land zum Meer (vgl.Duarteet al. 2015 undMoksnesset al. 2009 zum Integrated Coastal Zone Management ) und
3) Renaturierungsmaßnahmen im Meer, d. h. sowohl im Hinblick auf den Wasserkörper und den Meeresboden als auch auf die marinen Organismen und Lebensgemeinschaften.
Für die Renaturierung terrestrischer bzw. limnischer Lebensräume (Handlungsebene 1) und von Küstenlebensräumen als Übergangszonen vom Land zum Meer (Handlungsebene 2; Abb. 4) liegen tragfähige Konzepte und in der Praxis z. T. vielfach erprobte und erfolgreiche Renaturierungsmaßnahmen vor (z. B.Zerbe & Wiegleb2009,Andel & Aronson2012,Zerbe2019).
Direkte Renaturierungsmaßnahmen im Meer (Handlungsebene 3) stellen jedoch vor dem Hintergrund der bestehenden Wissensdefizite hinsichtlich der Ökosystemfunktionen der Meere und der Interaktionen zwischen ihren abiotischen und biotischen Komponenten sowie einer bisher nur ansatzweise entwickelten Renaturierungsökologie mit dem Schwerpunkt auf marine Ökosysteme sowie der oft ungeklärten Finanzierung von Maßnahmen zum Schutz und zur Renaturierung von Meeresökosystemen eine große Herausforderung dar. Einige Erfahrungen hierzu liegen jedoch inzwischen aus dem marinen Bereich vor und sollen in Abschnitt 6 kurz im Überblick dargestellt werden.
6 Beispiele für die Renaturierung mariner Meeresökosysteme bzw. ihrer Ökosystemkompartimente
Die bisher in Wissenschaft und Praxis erprobten Renaturierungsansätze für marine Ökosysteme bedienen sich im Wesentlichen der Herangehensweisen und Konzepte terrestrischer und limnischer Ökosysteme, die sich in ihren Eingriffsintensitäten unterscheiden (Abb. 5). Diese umfassen beispielsweise:
- die passive Renaturierung (Nichtstun), wie dies in Nationalparken und Meeres- bzw. Küstenschutzgebieten umgesetzt wird (vgl.Salomon&Dross2013 zu Marine Protected Areas ),
- die Wiedereinführung von Arten bzw. Individuen zur Stabilisierung der Populationen von Meeresorganismen,
- den Abtrag von nährstoff- bzw. schadstoffbelasteten Sedimenten z. B. in Häfen bzw. im Küstenbereich,
- die Tiefenwasserbelüftung zur Sauerstoffzufuhr bzw. Demobilisierung von Phosphor oder
- die Verringerung der Nutzungsintensität von vormals intensiver hin zu extensiver Nutzung von Meeresorganismen oder eine intensive Nutzung, die auf die Reproduktionsbiologie bzw. -ökologie der Meeresorganismen abgestimmt wird, um die Populationen nachhaltig zu stabilisieren und zu erhalten (z. B. durch Fischfangquoten).
Eine generelle Strategie, die Belastungen im terrestrischen Wassereinzugsgebiet der Meere und an den Küsten zu reduzieren, löst nicht die Problematik des im Meer bereits akkumulierten Abfalls sowie der persistenten Schadstoffe bzw. Altlasten und der Schädigungen des Sediments mit seinen Lebensgemeinschaften (Benthos). Hier bedarf es Renaturierungsstrategien, die direkt in das Ökosystem Meer eingreifen. Der nachfolgende kurze Überblick über Renaturierungsansätze im marinen Bereich (Tab. 4: Handlungsebene 3), bei dem sich die drei Handlungsebenen z. T. überlappen, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll das Potenzial, aber auch die bisherigen Grenzen der Renaturierung mariner Ökosysteme aufzeigen.
6.1 Fischfangquoten
Fangquoten, die auf der aktuellen Bestandssituation sowie der Kenntnis von Biologie und Ökologie der entsprechenden Arten basieren, tragen heute zu einer Stabilisierung bzw. Zunahme der Fischpopulationen und damit zu einer nachhaltigen Nutzung der Meeresökosysteme bei (EC 2018). Das kontinuierliche Monitoring der Fischbestände bietet hierfür eine wichtige Grundlage (ICES 2017a, b). Dies betrifft auch die Fischfangpraktiken bzw. -techniken, die im Sinne einer nachhaltigen Nutzung der Meere und des Meeresgrundes umweltverträglich angepasst werden müssen. Sind veränderte Fang- bzw. Erntepraktiken von Meeresorganismen für die Fischerei mit höheren Kosten verbunden, müssen hier ggf. Fördermaßnahmen ansetzen, wie dies z. B. beim Natur- und Umweltschutz in der Landwirtschaft der Fall ist.
Ähnlich wie bei terrestrischen Ökosystemen der Fall, lassen sich aber auch die Populationen mariner Organismen nur wiederherstellen bzw. stabilisieren, wenn eine Regeneration durch noch vorhandene reproduktionsfähige Individuen (oder entsprechende Entwicklungsstadien) oder eine natürliche Rückwanderung aus dem lokal-regionalen Artenpool gegeben ist. Ansonsten müssen die Organismen künstlich wieder eingebracht werden (vgl. Abschnitt 6.3).
6.2 Nachhaltige Ernte von Meerespflanzen
Auch für die Nutzung pflanzlicher Rohstoffe der Meere können Schwellenwerte festgelegt werden. So weisen beispielsweiseChristieet al. (1998) nach, dass sich die Bestände der Braunalge Laminaria hyperborea , die an der norwegischen Küste geerntet wird, nach einigen Jahren regenerieren. Jedoch empfehlen sie längere Ernteintervalle (> 5 Jahre), um auch die Tierlebensgemeinschaften in den Braunalgenbeständen vollständig wiederherzustellen.
6.3 Wiedereinführung von Arten
Insbesondere im Hinblick auf kommerziell genutzte Meeresorganismen hat sich die Wiedereinführung von Individuen oder Arten bewährt. Die Wiedereinführung der Wanderfischarten Lachs ( Salmo salar ) und Meerforelle ( Salmo trutta trutta ) im Rhein kann hier als erfolgreiches Beispiel genannt werden (IKSR 2015). Teile des Wi1edereinführungsprogramms umfassen Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Fischwanderwege sowie der Flusshabitat- und Uferstrukturen. Während sich die Verbesserung der Flusshabitate positiv in den Reproduktionsdaten der Fischarten widerspiegelt, wirken sich allerdings im marinen Lebensraum die immer noch mangelnde Durchlässigkeit der Fluss-Meer-Verbindungen, Fischerei bzw. illegale Fänge, die hohe Mortalität der Beifänge, Parasiten sowie der Klimawandel nach wie vor negativ auf die Lachspopulationen aus (ICES 2018,Nicolaet al. 2018).
Die Europäische Auster ( Ostrea edulis ) ist seit dem 19. Jahrhundert in ihrem Bestand sehr stark zurückgegangen, zum einen durch verminderte Reproduktion aufgrund der Übernutzung, zum anderen durch die Zerstörung der Habitate durch spezielle Erntetechniken (Gercken & Schmidt2014). Heute gilt die Europäische Auster als gefährdete Art und der Schutz und die Renaturierung von Austernbänken werden angestrebt, mit einem Fokus auf dem Wattenmeer und der Deutschen Bucht. Die Renaturierungsbestrebungen zielen einerseits auf die Reproduktion und andererseits auf die Schaffung der notwendigen Habitate (Austernbänke) ab. Für die Wiederherstellung von stabilen Austernpopulationen kann auf die langjährigen Erfahrungen der ökonomisch motivierten Einführung von Larven bzw. adulten Austern zurückgegriffen werden (z. B.Kennedy & Roberts1999,Lainget al. 2006,Gercken & Schmidt2014). Allerdings muss mit langen Zeiträumen von bis zu 25 Jahren für die Wiederherstellung stabiler Populationen gerechnet werden (Lainget al. 2006). Damit ist, zumindest kurz- bis mittelfristig, eine weitere kommerzielle Nutzung der Austern an den Renaturierungsstandorten ausgeschlossen.
Weitere Initiativen zur Wiedereinführung von Arten in marine Lebensräume liegen für Seegraswiesen im Wattenmeer vor. So wurde im niederländischen Wattenmeer dem starken Rückgang des Echten Seegrases ( Zostera marina ) mit Ansiedlungsversuchen begegnet (Jongeet al. 1996, 2000). Seegraswiesen tragen zur Biodiversität in Küstenräumen der Nord- und Ostsee bei, indem sie z. B. Brut- und Nahrungshabitat für die marine Fauna bieten, das Sediment stabilisieren und einen biologischen Filter darstellen. Dass Anpflanzungen bzw. Transplantationen von Echtem Seegras mit geeigneten Verfahren erfolgreich sein können, belegen Versuche im niederländischen Wattenmeer (Boset al. 2005).
6.4 Tiefenwasserbelüftung
Aufgrund der starken Sauerstoffabnahme in tieferen Wasserschichten (> 70 m) der Ostsee, die seit den 1960er Jahren als Folge erhöhten Nährstoffeintrags und damit verbundener Zunahme des Algenwachstums stattfindet, wird vorgeschlagen, Wasser aus weniger tiefen, sauerstoffreicheren Schichten mit Hilfe von Methoden des Geoingenieurwesens in die tieferen Schichten zu pumpen (Stigebrandt & Kalén2013). Dies würde auch den Eintrag von anorganisch gelöstem Phosphor unter anoxischen Bedingungen verhindern. Entsprechende Verfahren sind seit vielen Jahrzehnten in limnischen Ökosystemen erprobt worden (z. B.Björk2014). Erste Versuche im Rahmen eines zweieinhalbjährigen Pilotprojekts wurden im Byfjord an der schwedischen Westküste durchgeführt (Stigebrandtet al. 2015). Als weitere Methoden werden der Sedimentabtrag oder die chemische Bindung von Phosphor im Sediment vorgeschlagen.Conley(2012) gibt allerdings zu bedenken, dass für eine künstliche Sauerstoffzufuhr zum Meeresgrund der gesamten Ostsee ca. 100 Pumpen notwendig wären, mit einer Betriebszeit von mehreren Jahrzehnten und einem geschätzten Finanzvolumen von mindestens 200 Mio. Euro. Damit ist eine solche Maßnahme zur Sauerstoffanreicherung des Meeresgrundes in großem Maßstab wohl eher ausgeschlossen. Dies verdeutlicht auch die bereits angesprochene grundsätzliche Problematik der großen Dimensionen mariner Ökosysteme, die den Einsatz von im terrestrischen und limnischen Bereich erprobten Konzepten und Maßnahmen im marinen Raum an seine Grenzen führt.
6.5 Bioremediation
Bakterien (z. B. Alcanivorax spec.), die natürlicherweise Öl abbauen, können potenziell gegen Ölverschmutzungen im Wasser und im Küstenbereich eingesetzt werden. Diese Bioremediation mit Hilfe indigener oder dem System von außen zugeführter Bakterien ( bioaugmentation ) kann durch Stickstoffzugaben beschleunigt werden (Atlas & Bragg2009,Kubeet al. 2013). Hinsichtlich der wissenschaftlichen Grundlagen (z. B. räumlich-zeitliche Abbauprozesse, beteiligte Bakterien, abiotische Abbaubedingungen) und der Anwendungspraxis bestehen aber noch erhebliche Wissensdefizite (z. B.Chronopoulouet al. 2015). Bedenken bestehen insbesondere auch beim Zusatz von Nährstoffen und Chemikalien, die den Prozess des bakteriellen Ölabbaus beschleunigen sollen (Swannellet al. 1996). Eutrophierung oder Verunreinigung des Meerwassers könnten die ohnehin bereits bestehenden Umweltbelastungen der Meere verstärken.
7 Umweltpolitische Rahmenbedingungen und internationale Renaturierungsbestrebungen
Die große Bedeutung der beiden Meere Nord- und Ostsee für den Menschen und für die Funktion der marinen Interaktion mit den terrestrischen Lebensräumen ist auf nationaler wie auch internationaler umweltpolitscher Ebene bereits seit Ende der 1960er Jahre erkannt worden. Die Anrainerstaaten der beiden Meere haben sich verpflichtet, sich mit den Umweltproblemen auseinanderzusetzen und den Zustand der Meere kontinuierlich zu beobachten. Nach ersten internationalen Initiativen zum Schutz des Meeresökosystems Nordsee (z. B. Bonn-Übereinkommen 1969, Oslo-Konvention 1972) wurde 1992 die OSPAR-Kommission zum Schutz des Nordostatlantiks gegründet (OSPAR 2017). Hierbei wurden fünf Themenfelder des marinen Natur- bzw. Umweltschutzes identifiziert, nämlich (1) Schutz und Erhalt der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt, (2) Schadstoffe und Eutrophierung, (3) radioaktive Stoffe, (4) anthropogene Einflüsse und (5) Umweltziele und Management der den Küsten vorgelagerten Industrie. Eine ähnliche internationale Initiative besteht für die Ostsee mit der Helsinki-Konvention (Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission), die 1992 in Kraft trat (HELCOM 2017). Die Schwerpunktthemen sind Schifffahrt, Landwirtschaft, Arten und Biotope, Monitoring und mariner Abfall. Die Strategien, Beschlüsse und Empfehlungen dieser Institutionen haben inzwischen „insbesondere auf der Zielsetzungsebene weitgehend ein anspruchsvolles Niveau erreicht“ (SRU 2004: 213). Aus der Zielsetzung, die Situation für die degradierten bzw. einer Umweltbelastung ausgesetzten Bereiche zu verbessern, leitet sich direkt ein Handlungsbedarf zur Renaturierung mariner Ökosysteme ab.
Während bereits für den terrestrischen Bereich mit seinen Flüssen und Seen im Jahre 2000 die Wasserrahmenrichtlinie für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union formuliert wurde (EU 2000), folgte die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) der EU im Jahr 2008. Damit wurde ein internationaler Rahmen geschaffen, innerhalb dessen die europäischen Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um spätestens bis zum Jahr 2020 einen guten Zustand der Meeresumwelt zu erreichen oder zu erhalten. Der gute Umweltzustand wird anhand von elf qualitativen Deskriptoren festgelegt, für die von verschiedenen Arbeitsgruppen in den Jahren 2009 bis 2010 entsprechende Indikatoren für die Operationalisierung erarbeitet wurden. Mit der Aussage, dass die Meeresumwelt „geschützt, erhalten und – wo durchführbar – wiederhergestellt werden muss“ (EU 2008: Nr. 3), wird explizit eine Renaturierung der Meere mit deren Küstenräumen in diese Strategie miteinbezogen. Maßnahmen zur Regulierung des Fischereimanagements und zur Erzielung des guten Zustands der Meeresumwelt können im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik ergriffen werden, „einschließlich der vollständigen Schließung bestimmter Gebiete für die Fischerei, so dass die Integrität, Struktur und Funktion der Ökosysteme erhalten oder wiederhergestellt und unter anderem gegebenenfalls Laich-, Brut- und Futtergebiete geschützt werden können“ (EU 2008: Nr. 39).
8 Schlussfolgerungen
Auf der Grundlage eines seit Jahrzehnten im Gebiet der Nord- und Ostsee durchgeführten Monitorings der Umweltsituation der beiden Meeresökosysteme und der qualitativ und quantitativ festgestellten Umweltbelastungen (vgl. Tab. 3) lässt sich kaum bezweifeln, dass eine Renaturierung bzw. Wiederherstellung mariner Ökosysteme oder ihrer Kompartimente unabdingbar und dringend geboten ist. Die dargestellten Umweltprobleme im Bereich der Meeresökosysteme haben, neben den hier vertieften ökosystemaren Auswirkungen, z. T. auch erhebliche Folgen für die Sozioökonomie der Nordsee- bzw. Ostseeanrainerstaaten (z. B.Brouweret al. 2017,Elofsson2010). Für den terrestrischen Bereich liegen beispielsweise Studien über den volkswirtschaftlichen Schaden einer Eutrophierung der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor (COWI 2007,Prettyet al. 2003).
Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene sind die umweltpolitischen Rahmenbedingungen gegeben, eine Renaturierung mariner Ökosysteme auf den in Tab. 4 dargestellten drei Handlungsebenen durchzuführen. Diese Rahmenbedingungen umfassen die nationale Gesetzgebung (z. B. Naturschutzgesetze) und insbesondere die internationalen Vereinbarungen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Nutzung von Ökosystemen (vgl. Zerbe 2019). Hierzu gehören v. a. die europäische Wasserrahmenrichtlinie und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie.
Mit zu den wichtigsten Hürden einer Renaturierung mariner Ökosysteme gehört der noch bestehende Kenntnismangel. Neben den Konzepten und Maßnahmen, die für terrestrische und limnische Ökosysteme in Wissenschaft und Praxis langjährig erprobt und nur bedingt oder gar nicht auf marine Ökosysteme übertragbar sind, müssen neue Strategien und Maßnahmen entwickelt werden, die von der internationalen Staatengemeinschaft finanziert und umgesetzt werden.
Literatur
Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (WebcodeNuL2231 ) zur Verfügung.
Fazit für die Praxis
- Die Umweltbelastungen von Nord- und Ostsee machen eine Renaturierung und damit die Wiederherstellung und Sicherung der vielfältigen Ökosystemleistungen dieser marinen Ökosysteme unabdingbar.
- Ziele der Ökosystemrenaturierung wie z. B. Erhöhung der Biodiversität, Wiedereinführung von Arten bzw. Stabilisierung von Populationen, Förderung der natürlichen Dynamik und Verminderung der Eutrophierung und der Schadstoff- und Abfallbelastung greifen auch bei marinen Ökosystemen.
- Während für die räumlichen Handlungsebenen terrestrischer und limnischer Bereich sowie für die Küstenregion tragfähige Konzepte und Maßnahmen zur Ökosystemrenaturierung verfügbar sind, bedarf es für den marinen Bereich der Entwicklung spezifischer Konzepte und Maßnahmen, die für die große vertikale und horizontale Dimension der Meeresökosysteme angepasst werden müssen.
- Die umweltpolitischen Rahmenbedingungen sind sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene in Europa gegeben, um die notwendigen Initiativen und Maßnahmen einer Renaturierung mariner Ökosysteme einzuleiten bzw. konsequent weiterzuführen.
Kontakt
Prof. Dr. Stefan Zerbe leitet die Arbeitsgruppe Interdisziplinäre Landschaftsökologie an der Freien Universität Bozen in Südtirol. Hat seinen Lehr- und Forschungsschwerpunkt in der Renaturierungsökologie, dabei Beschäftigung mit konzeptionellen Grundlagen wie auch mit praktischen Renaturierungsproblemen verschiedener Lebensräume. Verfasser von mehr als 250 wissenschaftlichen Publikationen und einem interdisziplinären Fachbuch zur Ökosystemrenaturierung. Gründung zweier internationaler Master-Studiengänge zur Landschaftsökologie und zum Umweltmanagement.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen











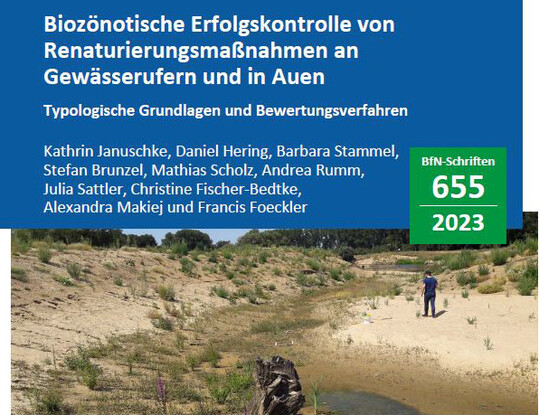






Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.