Windenergieplanung im Naturpark
Abstracts
Windenergieprojekte werden häufig wegen ihrer unübersehbaren Wirkungen auf das Landschaftsbild kontrovers diskutiert. Insbesondere für Planungen und Projekte innerhalb von Gebieten, in denen die Landschaft in besonderer Weise zu schützen oder zu entwickeln ist (z. B. Naturparke oder Landschaftsschutzgebiete), werden immer häufiger umfangreiche Untersuchungen zum Nachweis der Verträglichkeit mit den jeweiligen, die Landschaft betreffenden Schutzzielen gefordert. Der folgende Artikel beschreibt anhand eines konkreten Beispiels eine mögliche Vorgehensweise, wie auf Ebene der Flächennutzungsplanung potenzielle Flächen für die Windenergie unter dem Gesichtspunkt des Landschaftsbildes bewertet werden können. Durch die Anwendung von üblichen Analyse- und Bewertungsverfahren werden Aussagen getroffen, wie besonders starke landschaftliche Beeinträchtigungen innerhalb eines konkreten Landschaftsraumes vermieden oder zumindest vermindert werden können. Mithilfe umfangreicher Analysen und Bewertungen können die visuellen Wirkungen von Planungen veranschaulicht und die Verteilung und Dichte von Windparks gesteuert werden.
Weiterhin wird ein kurzer Ausblick gegeben, wie beim weiteren Ausbau der Windenergie die Eigenart, Vielfalt und Schönheit der jeweiligen Landschaft Berücksichtigung finden können.
How many wind turbines can a landscape tolerate? Wind energy planning in the nature park
Wind energy projects are often a source of controversy due to their highly visible effects on the landscape. Planning and projects in areas where it is of special importance to protect or develop the landscape (e.g., nature parks or protected landscape areas) are increasingly required to undergo extensive scrutiny in order to validate their compatibility with the conservation targets for the respective landscape.
Using an actual example from a nature park, it will be shown how, with the help of common methods of analysis and evaluation, reliable statements regarding land use planning can be made about severe disturbances within a particular landscape and how they can be avoided or at least diminished. This type of analysis and evaluation is comprehensive and complex, but enables the distribution and density of wind parks to be assessed and regulated according to the landscape.
Furthermore, we will briefly examine the means by which the future development of wind energy can take better take into account the uniqueness, diversity, and beauty of each individual landscape.
- Veröffentlicht am
1 Einführung in das Konfliktfeld Landschaftsbild
In Zeiten der Energiewende wird deutschlandweit in Gesellschaft und Politik diskutiert, welche landschaftsbildverändernde Dimension der Windenergieausbau entfalten darf, welche visuellen Auswirkungen akzeptabel sind und wie Sehgewohnheiten in der Windenergieplanung berücksichtigt werden können (Fachagentur Windenergie an Land o. J.). Eine Übersicht über die Begrifflichkeiten zum Thema Landschaftsbild sowie den aktuellen Diskussionsstand zu den Auswirkungen von Windenergieanlagen bietet eine diesbezügliche Grundlagenarbeit des Deutschen Naturschutzrings (DNR 2012: 85–121). Dort werden u. a. unterschiedliche Positionen bei der Bewertung der Auswirkungen von Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild beschrieben, die sich teilweise kontrovers gegenüberstehen. Aktuelle Untersuchungen zeigen zwar, dass Windenergieanlagen weiterhin eine insgesamt hohe Akzeptanz genießen (Fachagentur Windenergie an Land o. J., Simons2012), dennoch werden die dabei auftretenden Veränderungen der Landschaft und des Landschaftsbildes unterschiedlich wahrgenommen und so auch in den Medien thematisiert (z. B. Spektrum.de 2014, WirtschaftsWoche 2012).
Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen und die damit verbundenen Bewertungen von Windenergieanlagen in der Landschaft führen auf der Ebene konkreter Projekte häufig zu Konflikten mit teilweise sehr kontrovers geführter Diskussion. Vor dem Hintergrund, dass die Wahrnehmung von Natur und Landschaft letztendlich subjektiv ist, erscheint eine Entschärfung dieser Konflikte schwierig. Weiterhin ist die Art der Wahrnehmung durch das individuelle Wertesystem bestimmt, so dass mit dem Ausbau der Windenergie auch eine Diskussion über gesellschaftliche und individuelle Werthaltungen verbunden ist. Vor diesem Hintergrund gilt es Beurteilungsansätze und -kriterien zu entwickeln, die einen an die landschaftlichen Bedingungen ausgerichteten Ausbau der Windenergie ermöglichen.
Der vorliegende Beitrag beschreibt die gutachterliche Vorgehensweise bei der Beurteilung von Flächen für die Windenergie hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Landschaft. Erarbeitet wurde diese gutachterliche Vorgehensweise im Rahmen der Flächennutzungsplanung innerhalb eines Naturparks, in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Naturschutzbehörde und unter Verwendung üblicher Visualisierungsmethoden. Nachfolgend werden, nach einer kurzen Übersicht über die allgemeinen Planungsvorgaben zum Thema Landschaftsbild, die verschiedenen Instrumente zur Darstellung und Bewertung von Windenergieanlagen beschrieben und erläutert.
Weiterhin wird gezeigt, mit welchen Methoden und Kriterien Eingriffsintensitäten sowie Dominanz- und Summationswirkungen ermittelt und welche Empfehlungen für die Planung daraus abgeleitet werden können. Zum Schluss wird ein Ausblick über gestalterische Ansätze und Möglichkeiten zur Integration von Windenergieanlagen in die Landschaft gegeben.
2 Allgemeine Planungsvorgaben zum Thema Landschaftsbild
Die Errichtung von Windenergieanlagen stellt angesichts der aktuellen Bauhöhen von > 200 m in der Regel eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar und ist damit als erheblicher Eingriff im Sinne des Naturschutzrechts zu werten (FA Wind 2016). Allerdings ist „eine bloße Beeinträchtigung des Landschaftsbildes als Hinderungsgrund für die Zulassung von Windenergieanlagen (WEA) mit Blick auf deren Privilegierung abzulehnen. Vielmehr bedarf es einer verunstaltenden Wirkung, damit das Landschaftsbild einer WEA als entgegenstehender öffentlicher Belang (§ 35 (3) S. 1 Nr. 5 BauGB) entgegengehalten werden kann“ (MASLATON 2015). Aufgrund der Privilegierung der Windenergie im Außenbereich sind die damit verbundenen Beeinträchtigungen grundsätzlich hinzunehmen. Seitens der Gerichte wurde eindeutig festgestellt, dass „Windenergieanlagen (…) das Landschaftsbild regelmäßig nicht verunstalten“ (Gatz2013). Daraus resultiert, dass die üblichen und im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren angewendeten Bewertungsmodelle (z. B.Nohl1993, Darmstädter Modell) in erster Linie zur Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen oder -zahlungen dienen.
Auf Ebene der Bundesländer existieren weiterhin verschiedene Vorgaben zur Suche und Bewertung von Standorten für die Windenergie. In Rheinland-Pfalz sind gemäß dem „Rundschreiben Windenergie“ (MWKELet al. 2013)für den Landschaftsschutz folgende Kriterien zu betrachten und abzuwägen:
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung der Naturlandschaften (vom menschlichen Einfluss verhältnismäßig unbeeinflusst gebliebene Landschaften),
- historisch gewachsene Kulturlandschaften auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern sowie die Sichtbarkeit der Anlage im Nah- und Fernbereich,
- UNESCO-Welterbestätten.
Diese Vorgaben zielen darauf ab, besonders schützens- und erhaltenswerte Landschaften zu identifizieren und sie von Windenergie grundsätzlich freizuhalten. Dabei gilt es zu ermitteln, welche Landschaften als „Kulturlandschaftsgedächtnis“ von derlei Eingriffen verschont bleiben sollen und welche Räume zu modernen Energielandschaften weiterentwickelt werden können.
Weiterhin ist in Rheinland-Pfalz gemäß „Rundschreiben Windenergie“ des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung (MWKELet al. 2013) „in Landschaftsschutzgebieten die erforderliche Genehmigung regelmäßig zu erteilen, da das öffentliche Interesse an der Erzeugung und Versorgung der Gesellschaft mit erneuerbaren Energien in der Regel andere, in die Abwägung einzustellende Belange überwiegt“. Dies verdeutlicht den politischen Willen des Landes, dass auch Landschaften innerhalb von Landschaftsschutzgebieten für die Nutzung der Windenergie herangezogen werden sollen.
Weiterhin gilt, dass in Naturparken Genehmigungen für Windenergieprojekte bei Beachtung des Schutzzweckes der jeweiligen Rechtsverordnung erteilt werden können. Hinweise, wie beim Ausbau der Windenergie der für Naturparke übliche Schutzzweck einer„Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, Schönheit und des Erholungswertes“ beachtet werden kann und wie dies miteinander zu vereinbaren ist, werden seitens des Ministeriums allerdings nicht gegeben.
Insofern stellt sich insbesondere für Naturparke in Rheinland-Pfalz die Frage, wie der Ausbau der Windenergie gestaltet und dabei der jeweilige Schutzzweck beachtet werden kann. Diese Frage muss hier bereits auf Ebene der Flächennutzungspläne beantwortet werden, da die Befugnis für eine abschließende Steuerung durch die Ausweisung von Konzentrationsflächen für die Windenergie auf die Bauleitplanung übertragen wurde.
Anhand des nachfolgend dargestellten Falls aus Rheinland-Pfalz soll beispielhaft gezeigt werden, welche Analyse- und Bewertungsmethoden im Rahmen einer Flächennutzungsplanaufstellung innerhalb eines Naturparks Anwendung finden können.
3 Standortplanung im Naturpark
Im Rahmen der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes für die Windenergie wollte eine Verbandsgemeinde insgesamt sechs neue Sondergebiete für Windenergie ausweisen, die einen Zubau von insgesamt 56 WEA ermöglicht hätten. Dabei musste der Planungsträger die Verträglichkeit der Planung mit den Schutzzielen des Naturparks „Saar-Hunsrück“ (die „Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, Schönheit und des für Langzeit- und Kurzurlaub besonderen Erholungswertes des südwestlichen Hunsrücks und des Saartales mit den begleitenden Höhenzügen“) prüfen. Die zuständige Genehmigungsbehörde forderte einen Nachweis, ob und welche der geplanten Sondergebiete mit dem Schutzzweck des Naturparks vereinbar wären und welche Bereiche des Planungsgebietes von Windenergie freizuhalten seien. Für die Beurteilung wurde u. a. eine Ermittlung der Dominanzwirkungen einzelner Anlagen und Anlagengruppen auf hochwertige Landschaftsbereiche verlangt. Die Dominanzwirkungen wurden mithilfe umfangreicher Sichtbarkeitsberechnungen und Visualisierungen ermittelt.
Dabei stellte eine im Auftrag des Landkreises erstellte Risikoanalyse (Fischer2012) eine wichtige Bewertungsgrundlage dar. Im Rahmen dieser Analyse erfolgte bereits eine Unterteilung des gesamten Kreisgebietes in verschiedene Landschaftsbild- und Landschaftsraumeinheiten, die hinsichtlich ihrer Qualität sowie ihrer Empfindlichkeit gegenüber potenziellen Windenergieanlagen kategorisiert und in insgesamt zehn Qualitäts- bzw. Empfindlichkeitsstufen unterteilt wurden.
Für die von der Fachbehörde geforderte Bewertung von Dominanzwirkungen und Eingriffsintensitäten konkreter Anlagen und Anlagengruppen musste ein Bewertungsansatz erarbeitet werden, mit dem sowohl dem Planungs- als auch dem Schutzziel angemessene Ergebnisse erreicht werden konnten. Dabei wurde insbesondere Wert auf eine möglichst objektive und nachvollziehbare Bewertung sowie auf für die Planung anwendbare Maßnahmenvorschläge gelegt. Nachfolgend werden die verschiedenen Arbeits- und Bewertungsschritte genauer beschrieben.
3.1 Sichtbarkeitsanalysen und Visualisierungen
Zentrale Grundlage für eine Bewertung der Wirkungen von WEA auf die Landschaft sind Sichtbarkeitsberechnungen und Visualisierungen. Mithilfe eines speziellen Programms (im Fallbeispiel das Programm WindPro) wurden dabei zunächst die Bereiche innerhalb des Untersuchungsgebietes ermittelt, von denen aus die WEA sichtbar sind. Dabei wurden die Abstandsklassen (Wirkungsbereiche) von bis 2,5 km und bis 5 km festgelegt, für die differenzierte Berechnungen erfolgen (Abb. 2). Diese Abstände wurden in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde auf Grundlage verschiedener Bewertungsmodelle (eine Zusammenfassung dieser Modelle zeigt Hildebrand im UVP-Report Heft 2/15) und Gerichtsurteile (z. B. VGH Kassel, 9B1918/11) sowie eines weiteren Fachgutachtens des Landes zu Kulturlandschaften (MWKEL 2013) ermittelt.
Bei diesen Sichtbarkeitsanalysen werden Topografie, Vegetation und Bebauung berücksichtigt, die die Sichtbarkeit von WEA einschränken. Durch einen Vergleich zwischen Ausgangszustand – innerhalb des Planungsraumes sind bereits einige Windenergieanlagen vorhanden – und dem Planungszustand können Aussagen getroffen werden, wie sich der Anteil von Flächen innerhalb des Planungsraumes, von denen aus WEA zu sehen sind, durch den Anlagenzubau verändert. Diese Analysen bilden die Grundlage für die seitens der Genehmigungsbehörde geforderte Ermittlung der prozentualen Anteile im Naturpark, in denen zukünftige Anlagen dominant wirken (Abb. 3).
Durch die Überlagerung einzelner Sichtbarkeitskarten mit den Bewertungskarten der kreisweiten Risikoanalyse (Fischer2012) wird weiterhin gezeigt, ob und in welcher Intensität insbesondere hochwertige Landschaftsbereiche durch den Zubau von WEA visuell betroffen sein würden (Abb. 4). Die Planungsanforderung, dass mind. 50 % der Fläche innerhalb der Verbandsgemeinde eine hohe Landschaftsbildqualität aufweisen müssen und diese nicht unmittelbar durch WEA in Anspruch genommen werden dürfen, kann anhand dieser Darstellungen überprüft werden und die Planungen lassen sich entsprechend beurteilen.
Diese nummerischen Ergebnisse geben Hinweise auf die Dimension und Quantität der Veränderungen bei der Sichtbarkeit von WEA. Die geforderte Bewertung der Dominanzwirkung der geplanten Anlagen muss aber v. a. qualitativ dargestellt und bewertet werden. Für die dazu erforderlichen Visualisierungen wurden von repräsentativen Standorten mit guten Sichtbeziehungen zu den geplanten WEA innerhalb der einzelnen Sonderbauflächen Fotos erstellt und die geplanten Anlagen hineinprojiziert. Anhand dieser Visualisierungen, die für jede Sonderbaufläche gesondert angefertigt wurden, konnte die Dominanzwirkung einzelner WEA quantitativ abgeleitet und bewertet werden. Diese Dominanzwirkung ergibt sich aus der Entfernung und dem sichtbaren Teil der einzelnen Anlagen. Die Bewertungsmethodik dazu ist dem entsprechenden Fachgutachten (MWKEL 2013) entnommen.
3.2 Eingriffsintensität und Dominanzwirkung
Mithilfe der Visualisierungen wurden Eingriffsintensitäten und Dominanzwirkungen für die WEA der einzelnen Sonderbauflächen getrennt ermittelt. Dazu wurde im Rahmen der durchgeführten Landschaftsbildbewertung (Gutschker-Dongus 2016) das o. g. Fachgutachten herangezogen. In Anlehnung an das darin dargestellte Bewertungsschema wurden je nach Entfernung und Sichtanteil sogenannte Indexwerte (von 1–9) für verschiedene WEA ermittelt, mit denen sich die spezifische Wirkungs- bzw. Eingriffsintensität beziffern ließ. So erhalten WEA, die in einer Entfernung von bis zu 1500 m vollständig sichtbar sind, den Indexwert 9 für die stärkste visuelle Wirkung. Anlagen von denen in einer Entfernung zwischen 7500 und 10 000 m nur ein Rotorblatt sichtbar ist, erhielten den Indexwert 2.
Mithilfe der ermittelten Indexwerte wurden einzelne WEA identifiziert, die eine besonders dominierende Wirkung in der Landschaft entfalten. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass Dominanzwirkungen in der Regel bis in eine Entfernung von 5 km auftreten können (Hessischer VGH, Urteil vom 14.04.2012, 9 B 1918/11, openjur, Rn 45). In größeren Entfernungen hat die Wirkungsintensität von WEA bereits so weit abgenommen (Hildebrand2015), dass die Landschaftselemente im näheren Umfeld eines Betrachtungspunktes überwiegen und die Anlagen auch bei voller Sichtbarkeit keine dominierende Wirkung mehr entfalten können. Entsprechend werden Dominanzen ab einem Indexwert > 7 wirksam bzw. für die Beurteilung relevant. Im Rahmen der Einzelbewertungen der verschiedenen Standortbereiche wurden mithilfe der Indexwerte die Anlagen identifiziert, die auf die durch Risikoanalyse (Fischer2012) ermittelten hochwertigen Landschaftsbereiche besonders hohe visuelle Wirkungen bzw. Dominanzwirkungen entfalten würden.
3.3 Bewertung der Summationswirkungen
Nachdem die einzelnen Standortbereiche mithilfe der beschriebenen Analyse- und Bewertungsmethoden jeweils getrennt untersucht wurden, war das Zusammenwirken von mehreren, im räumlichen Zusammenhang wahrnehmbaren Anlagengruppen zu beurteilen. Dafür wurden erneut Sichtbarkeitsberechnungen und Visualisierungen erstellt, aber dabei immer mehrere Standortbereiche in die Berechnungen und Darstellungen einbezogen.
Somit waren weitläufigere Panoramaaufnahmen erforderlich, die einen größeren Landschaftsausschnitt zeigen als die Visualisierungen der Einzelbewertungen. Durch diese Art der Darstellung wurden die Wirkungen von Anlagen im gesamträumlichen Zusammenhang verdeutlicht und das optische Zusammenwirken verschiedener Anlagengruppen dargestellt (Abb. 5). Die in der Einzelfallprüfung als besonders dominant bewerteten WEA wurden hierbei auch hinsichtlich ihrer Wirkung im gesamträumlichen Zusammenhang beurteilt. Auch hier wurden die beschriebenen Indexwerte gebildet. Die Anlagen, die sowohl bei der Einzelfallprüfung als auch in der Gesamtbetrachtung die höchsten Indexwerte erhielten, wurden als die Landschaft in besonderer Weise dominierend eingestuft.
3.4 Ermittlung von besonderen und die Eigenart prägenden Landschaftsbereichen
Die Erfassung der landschaftlichen Situation und die Auswahl geeigneter Visualisierungspunkte erfolgte durch mehrere umfassende Ortsbegehungen. Dabei wurden u. a. auch die besonderen, die Eigenart der Landschaft prägenden Landschaftsbereiche identifiziert. Während durch die kreisweite Risikoanalyse (Fischer2012) verschiedene Landschaftsräume abgegrenzt wurden, die vergleichbare Landschaftselemente und -situationen aufwiesen, wurden im Rahmen des für den Flächennutzungsplan erstellten Gutachtens (Gutschker-Dongus 2016) singuläre räumliche Situationen mit einer für die Landschaft prägenden Wirkung erfasst und beschrieben. Dabei galt es, besondere räumliche Situationen zu erkennen und deren spezifische und individuelle Funktion zu analysieren und zu beschreiben. Diese besonders prägenden Landschaftsbereiche sind in Abhängigkeit des jeweils spezifischen Landschaftsraumes zu ermitteln. Im untersuchten Mittelgebirgsraum waren dies insbesondere Kuppen oder Erhebungen, auf denen WEA sehr exponiert und dominierend erscheinen würden. Weiterhin waren dies Sichtachsen zwischen hochwertigen und prägenden Landschaftsräumen, die eine besondere und weitreichende Wahrnehmung der Landschaft ermöglichen. Hier würden WEA zu einer erheblichen Einengung dieser Räume und damit zu einer erheblichen Verminderung der gesamträumlichen Wahrnehmungsfähigkeit der Landschaft führen. Diese Landschaftsbereiche und deren Wirkungen konnten durch die Visualisierungen veranschaulicht werden und fanden bei der Gesamtbeurteilung der Planung entsprechende Berücksichtigung.
3.5 Gesamtbewertung und Vorgaben für die Planung
Die im vorangegangenen Punkt dargestellten Analysen und Ergebnisse wurden im Rahmen einer Gesamtbewertung miteinander verschnitten und zusammenfassend beurteilt. Dabei wurden zunächst geplante Sonderflächen identifiziert, die aufgrund ihrer Lage innerhalb von als „hochwertig“ bewerteten Landschaftsbereichen aus der Planung genommen werden mussten. Weiterhin wurden einzelne Anlagen im Randbereich von geplanten Sonderbauflächen ermittelt, die aufgrund ihrer besonders dominierenden Wirkung, ihrer Lage innerhalb von landschaftlich prägenden Bereichen oder in wichtigen Sichtachsen ebenfalls für „nicht im Einklang mit den Schutzzielen des Naturparks stehenden Anlagen“ bewertet wurden. Die Argumentation erfolgte dabei unter Bezugnahme auf die einzelnen Bewertungsschritte verbal-argumentativ und berücksichtigte sowohl quantitative und als qualitative Aspekte.
Im Ergebnis wurden die potenziellen Sonderbauflächen so reduziert, dass von den ursprünglich ca. 56 möglichen WEA mindestens zehn nicht mehr zu realisieren sind. Dadurch wurde der Zuwachs von Flächen mit Sichtbezügen zu WEA um 30 % reduziert und die Wirkungen auf für das Landschaftserleben wichtige Teile des Planungsgebietes deutlich verringert (Abb. 6).
Sowohl der Planungsträger als auch die zuständige Genehmigungsbehörde akzeptierten die Bewertungen und Vorschläge und berücksichtigten sie bei der weiteren Planung.
4 Ausblick
Das vorgestellte Beispiel eines Gutachtens zur Flächennutzungsplanung für die Windenergie in einem Naturpark zeigt, wie mithilfe von Analyse- und Bewertungsverfahren, die bei Genehmigungsverfahren für WEA üblich sind, Aussagen hinsichtlich Eingriffsintensität sowie Dominanz- und Summationswirkungen von geplanten Windenergieanlagen getroffen werden können. Anhand von Sichtbarkeitsberechnungen und Visualisierungen sowie weiteren Bewertungsansätzen und -kriterien werden Planungshinweise erarbeitet, wie starke Beeinträchtigungen innerhalb eines konkreten Landschaftsraumes vermieden oder zumindest vermindert werden können. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes sind diese Art von Analysen und Bewertungen sehr umfangreich und komplex, es können hier aber die Verteilung und Dichte von Windparks vergleichsweise gut gesteuert werden.
Aufgrund der Privilegierung von WEA stehen Belange des Landschaftsschutzes einer Genehmigung von WEA in der Regel nicht grundsätzlich entgegen (Gatz2013). Dies macht aufwendige Prüfungen insbesondere in Großschutzgebieten, in denen die Landschaft ein besonderer Schutzzweck ist (etwa Naturparke oder Landschaftsschutzgebiete), angemessen und erforderlich – zumindest soweit die Gebiete, wie z. B. in Rheinland-Pfalz, nicht pauschal von der Windenergienutzung ausgeschlossen sind. Als Grundlage einer solchen landschaftsbezogenen Prüfung ist jedoch eine großräumigere Bestandsanalyse und -bewertung der Landschaften und ihrer Teilräume erforderlich. Die vorgestellte Methode zeigt Möglichkeiten für Beurteilungsansätze und -kriterien, anhand derer ein an die landschaftlichen Bedingungen ausgerichteter Ausbau der Windenergie erfolgen kann.
Die zu Beginn ebenfalls aufgeworfene Frage, wie bei der Entwicklung von „modernen Energielandschaften“ Eigenart, Vielfalt und Schönheit der jeweiligen Landschaft angemessen berücksichtigt werden können, bleibt dabei aber unbeantwortet. Zur Klärung dieser Frage könnte z. B. der Ansatz weiter untersucht und entwickelt werden, dass Windräder den typischen Reliefformen der Naturräume, den Kanten, Kämmen, Faltungen und Geländesprüngen der Landschaft folgen oder Übergänge von Großlandschaften markieren können. Solche Planungs- bzw. Gestaltungsansätze werden nur vereinzelt diskutiert und finden in der Planungs- und Genehmigungspraxis von WEA keine Anwendung. Auch Studien über eine mögliche Einbindung von Windparks in die Landschaft durch Positionierung der Anlagen nach gestalterischen, landschaftsangepassten oder geometrischen Prinzipien existieren zwar (Netzwerk Baukultur in Niedersachsen 2016,Schöbel2012), werden aber insgesamt kaum wahrgenommen. Neue Szenarien zur Gestaltung der Energiewende im eigentlichen Wortsinn zu entwickeln und Konzepte für das Zusammenspiel von Windenergieanlagen und Topografie auszuarbeiten, wären wichtige Schritte hin zur Beantwortung obiger Frage.
Literatur
DNR (Deutscher Naturschutzring; 2012): Grundlagenarbeit für eine Informationskampagne „Umwelt- und naturverträgliche Windenergienutzung in Deutschland (onshore)“ – Analyseteil. Lehrte.
Fachagentur Windenergie an Land (o. J.): Windenergie und Landschaftsbild. URL: https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/landschaftsbild.html
Fischer, K.(2012): Risikoanalyse Landschaftsbild und Erholung im Hinblick auf die Beurteilung von Windkraftstandorten für das Gebiet des Landkreises Trier-Saarburg, der Stadt Trier und der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf. Gutachten, 62 S. URL: docplayer.org/ 51524142-Kreisverwaltung-trier-saarburg-stadt-trier-verbandsgemeinde-thalfang-am-erbeskopf.html
Gatz, S.(2013): Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis. Bonn.
Gutschker-Dongus (2016): Landschaftsbildbewertung zur Ermittlung der Eingriffsintensitäten und Dominanzwirkungen der potenziellen Windenergieanlagen mit Hilfe von Sichtbarkeitsanalysen und Visualisierungen. URL: https://www.hermeskeil.de/index.php?id=780
Hildebrand, S. (2015):Methoden der Sichtbarkeitsanalyse von Windenergieanlagen – Theorie und Praxis. UVP-report 29 (2), 66-69.
Jessel, B., Jenny, D., Zschalich, A. (2001):Landschaftsvisualisierungen und ihre Anwendbarkeit in der Eingriffsregelung. Stadt und Grün, Heft 12/2001, 877-885.
MASLATON (2015): Windenergieanlagen. Ein Rechtshandbuch. München.
MWKEL (Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung;2013):Fachgutachten zur „Konkretisierung der landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften (Lahikula) zur Festlegung, Begründung und Darstellung von Ausschlussflächen und Restriktionen für den Ausbau der Windenergienutzung.
–et al. (Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung; Ministerium der Finanzen; Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten; Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur;2013):Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz (Rundschreiben Windenergie) vom 28.05.2013.
Netzwerk Baukultur in Niedersachsen (2016): Baukultur für Energielandschaften, Netzwerkdokumentation 10 vom 14. Forum des Netzwerkes am 10. März 2016 in Braunschweig.
Nohl, W. (1993): Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe – Materialien für die naturschutzfachliche Bewertung und Kompensationsermittlung. Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Kirchheim bei München.
Simons, U. (2012):Windräder vergraulen Eifeltouristen nicht. Kölner Stadt-Anzeiger, 08.11.2012.
Schöbel, S. (2012): Windenergie und Landschaftsästhetik – zur landschaftsgerechten Anordnung von Windfarmen. Berlin.
Spektrum.de (2014): Bis zum Horizont und weiter. URL: https://www.spektrum.de/news/wie-beeinflussen-windraeder-die-aesthetik-von-landschaften/1299074
Wirtschaftswoche (2012): Windräder verwandeln unsere Landschaft. URL: https://www.wiwo.de/technologie/umwelt/energiewende-windraeder-verwandeln-unsere-landschaften-/6753958.html
Fazit für die Praxis
- Aufgrund der Diskussion, welche landschaftsbildverändernde Dimension der Windenergieausbau entfalten darf und welche visuellen Auswirkungen akzeptabel sind, steigen die Anforderungen an die Planung.
- Insbesondere innerhalb von Naturparken oder Landschaftsschutzgebieten müssen bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanung die landschaftsbezogenen Schutzziele beachtet und entsprechende Nachweise erbracht werden.
- Mithilfe von üblichen Analyse- und Bewertungsverfahren können Verteilung und Dichte von Windparks in der Landschaft beschrieben und auf Ebene der Flächennutzungsplanung gesteuert werden.
- Anhand von Sichtbarkeitsberechnungen, Visualisierungen und der Ermittlung von Sichbarkeitsindizes lassen sich Eingriffsintensitäten sowie Dominanz- und Summationswirkungen ermitteln und darstellen und Planungsvorgaben daraus ableiten.
- Durch die Überlagerung von Sichtverschattungs- und Risikokarten können in Verbindung mit den ermittelten Sichtbarkeitsindizes die Anlagen mit den stärksten Wirkungen auf das Landschaftsbild identifiziert werden.
- Auf Grundlage dieser Ergebnisse lassen sich konkrete Vorschläge hinsichtlich eventuell erforderlicher Anpassungen bei der Ausweisung von Sonderbauflächen für die Windenergie ableiten.
Kontakt
Dieter Gründonner ist seit 2002 Landschaftsplaner im Planungsbüro Gutschker-Dongus in Odernheim und leitet die Abteilung Bauleitplanung sowie zahlreiche Projekte im Bereich der Windenergie. Zwischen 1993 und 2001 freie Mitarbeit in verschiedenen Planungsbüros sowie fünf Jahre Anstellung im Umweltamt des Bezirks Spandau, Berlin.
Studium an der Fachhochschule in Bingen am Rhein, Fachrichtung Umweltschutz, sowie an der TU-Berlin, Fachrichtung Landschaftsplanung mit dem Schwerpunkt Regional- und Stadtplanung mit entsprechenden Abschlüssen als Dipl.-Ing.
> dieter.gruendonner@gutschker-dongus.de
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen




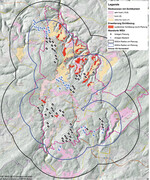




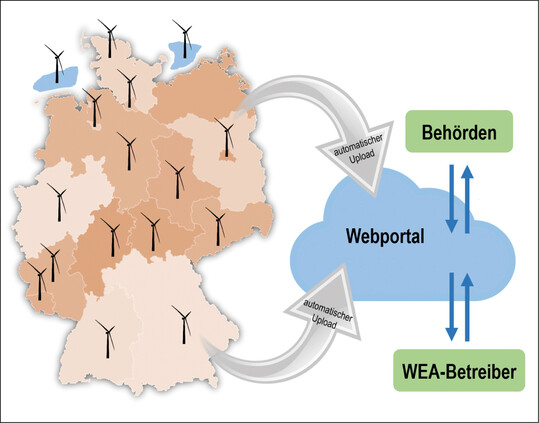





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.