Natura 2000 in Bayern
Abstracts
Die Etablierung des EU-weiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000, das Naturschutzziele und unterschiedliche Nutzungsansprüche vereinbar gestalten möchte, hat sich als herausfordernd erwiesen, sodass Gebietsausweisungen und die Umsetzung von Maßnahmen bisweilen eher verspätet erfolgen. Im Freistaat Bayern wurden angesichts anhaltender Konflikte neue Prozesse der Beteiligung und Kommunikation auf den Weg gebracht, für deren Gelingen ein Verständnis der Hürden und Konfliktursachen zielführend ist. Auf der Grundlage von 50 Interviews mit bayerischen Stakeholdern zeigt sich, dass begrenzte Kenntnisse, konfligierende Nutzungsansprüche und Deutungen sowie als unzureichend wahrgenommene Kommunikation mit Betroffenen neben begrenzten Ressourcen zentrale Hürden für die Umsetzung von Natura 2000 darstellen. Intensivierte und frühzeitige Kommunikation mit Stakeholdern sowie unterstützende Öffentlichkeitsarbeit können zu Konfliktregelungen und einer gelingenden Etablierung beitragen, bedürfen aber weitergehender finanzieller wie personeller Ressourcen.
Natura 2000 and the further establishment of the European network of protected areas in Bavaria
The European network of protected areas under the EU Birds and Habitats Directives, Natura 2000, seeks to allow a balancing of conservation objectives and human activities, which has proven to be quite challenging and, in many cases, lead to delayed site designations and implementation of measures. In light of continued conflicts, the Free State of Bavaria introduced new processes of participation and communication, whose success depends on a better understanding of the challenges and sources of conflict. Based on 50 interviews with Bavarian stakeholders, four central challenges for the implementation of Natura 2000 can be identified: a lack of knowledge of Natura 2000; conflicting claims on utilization and processes of interpretation; communication with concerned persons which was perceived as insufficient; and limited resources. Early and intensified communication with stakeholders along with additional public relations work can encourage conflict management and successful establishment of Natura 2000; however, they require additional financial and human resources.
- Veröffentlicht am

1 Einführung: Das EU-weite Schutzgebietsnetz Natura 2000 und der bayerische Fokus
Zum Schutz und Erhalt der Biodiversität verabschiedeten die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1992 die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, kurz FFH-Richtlinie). Gemeinsam mit der Vogelschutzrichtlinie aus dem Jahr 1979 (Richtlinie 79/409/EWG, kodifizierte Richtlinie 2009/147/EG) bildet sie die Grundlage für das heutige EU-weite Biotopverbundnetz Natura 2000 (BfN& BMU2010). Erklärtes Ziel der Richtlinien ist es, neben dem Artenschutz gefährdete Arten und Lebensräume zu bewahren und eine großflächige Biotopvernetzung zum Schutz der Biodiversität über die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu etablieren – und dies bei gleichzeitiger Berücksichtigung der „wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen“ (Europäischer Rat 1992, S. 7). Die hieraus resultierende, oftmals notwendige, Kooperation mit Bewirtschaftern, Landnutzern und Grundeigentümern in der Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen hat sich in der Vergangenheit in vielen Mitgliedstaaten allerdings als Herausforderung erwiesen (Blondetet al. 2017,Henleet al. 2008,Kreiseret al. 2018,Mayr2010,Winkelet al. 2015). Zum Schutzgedanken potenziell konfligierende Interessen wie wirtschaftliche Nutzungsansprüche, die Nachfrage nach Wohnraum und Infrastruktur oder gesellschaftliche Erholungs- und Freizeitbedürfnisse sind zu berücksichtigen und bedürfen Regelungsmöglichkeiten (hierzu u. a. auchCrosseyet al. 2019).
Im deutschen Vergleich erwies sich die Etablierung von Natura 2000 besonders im Freistaat Bayern als schwieriges Unterfangen. Auf Druck der EU-Ebene (mehrere Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission, EuGH-Urteil vom 11.9.2001,Mayr2010) und der nationalen Ebene wurden letztendlich erforderliche Gebiete ausgewiesen, sodass mit Stand 2018 knapp 750 Natura-2000-Gebiete bestehen, die 11,4 % Prozent der bayerischen Landesfläche umfassen (LfU Bayern 2018). Als Ausgleich zu konflikthaft aufeinandertreffenden Interessen wurden neue Beteiligungsprozesse etabliert, in denen „aus Betroffenen […] Beteiligte [werden sollen], die auf gleicher Augenhöhe mit den Behörden diskutieren“ (StMUGV&StMLF 2006, S. 14). Diesen Beteiligungsprozessen wird eine besondere Bedeutung für eine effektive und erfolgreiche weitere Umsetzung von Natura 2000 beigemessen, da die Managementpläne über das Verschlechterungsverbot hinaus „für private Grundeigentümer und Nutzungsberechtigte [...] keine Verpflichtungen“ darstellen (StMUV 2016: 3). Die Umsetzung der in den Managementplänen vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgt also auf freiwilliger Basis, weshalb Kenntnisse um und Akzeptanz von Natura 2000 durch Betroffene grundlegende Voraussetzungen für den Erfolg darstellen. Zur weiteren Unterstützung wurde 2017 das von der EU geförderte Kommunikationsprojekt „LIFE living Natura 2000“ angestoßen. Ein zentrales Anliegen besteht darin, die Bekanntheit von und das Wissen um Natura 2000 sowohl innerhalb der Bevölkerung als auch unter Grundeigentümern und Landnutzern zu erhöhen, um so eine „Steigerung der Kooperations- und Umsetzungsbereitschaft“ zu erreichen (ANL2018, S. 2).
Um eine solche Steigerung herbeiführen zu können, sind die Hürden der bisherigen Kommunikation und Kooperation von Natura 2000 in Bayern eingehender zu beleuchten. Diese wurden 2018 innerhalb der begleitenden Projektevaluierung erfasst, wobei insbesondere Interviews Problemlagen und gleichzeitig Möglichkeiten zugunsten der Regelung von Konflikten (theoretischkonzeptionell in Anschluss anDahrendorf1972) aufzeigten. Insgesamt wurden 50 Interviews geführt (zum Verfahren siehe Textbox), davon 25 mit Vertretern aus von Projektträgerseite relevant erachteten Bereichen – so bezeichneten Stakeholdern – auf Bezirks- und Landesebene: politische Entscheidungsträger, Grundeigentümer und Landnutzer, Interessens- und Verbandsvertreter, Medienvertreter und Jugendliche (siehe Tab. 1). Weitere 25 Interviews mit Stakeholdern aus drei bayerischen Natura-2000-Gebieten ermöglichten vertiefte Einblicke in Erfahrungen und Konflikte auf Gebietsebene. Ausgewählt wurden hierzu das oberbayerische Gebiet „Gräben und Niedermoorreste im Erdinger Moos“ (ein Areal in der durch Nutzungsdruck geprägten Metropolregion München), das oberfränkische „Eger- und Röslautal“ (das sich in Teilen mit dem Naturpark Fichtelgebirge überschneidet) sowie der „Klötzlmühlbach“ im niederbayerischen Landshut (ein von administrativer Seite als konfliktarm beschriebenes Gebiet).
Der vorliegende Artikel nähert sich vor dem beschriebenen Hintergrund Aushandlungsprozessen um Natura 2000 in Bayern an und fragt danach, woraus Probleme erwachsen und wie konflikthafte Situationen Regelungen zugeführt werden könnten. Zunächst werden zentrale Herausforderungen in der bisherigen Umsetzung erörtert: die begrenzte Bekanntheit von Natura 2000, Konflikte um Nutzungsansprüche und Deutungen, als unzureichend wahrgenommene Kommunikation mit den Stakeholdern und Partizipationsmöglichkeiten sowie begrenzte Ressourcen. Hieran anknüpfend werden mögliche Handlungsoptionen dargelegt, bevor mit einem Fazit geschlossen wird.
2 Natura 2000 in Bayern – Herausforderungen bei der Etablierung
2.1 Begrenzte Bekanntheit als Hindernis für die Etablierung
Nach Bekunden der Interviewpartner seien Kenntnisse um Natura 2000 bei denjenigen, die konkret von Gebietsausweisungen betroffen sind, recht gering, was sich direkt wie indirekt auf die Umsetzung auswirke. Denn vor dem Hintergrund eines fehlenden „Grundlagenwissens“ (GEM3) bestünde ein starker Nährboden für „Halbwahrheiten“ (GEM2), die Befürchtungen und so das Konfliktpotenzial vor Ort schüren (könnten). Eine nicht zu unterschätzende Tragweite können hier Berichterstattungen über Zielkonflikte (etwa zwischen Infrastrukturprojekten und dem Schutz von Eidechsen) entfalten, deren ggf. schemenhafte, jedoch einprägsame Darstellungen die gesellschaftliche Wahrnehmung von Naturschutzvorhaben prägten und Befürchtungen im Hinblick auf Nutzungseinschränkungen oder Enteignungen wecken könnten. Wie ein Interviewpartner aus dem Bereich der Naturschutzverwaltung berichtet (GEM3), sei es oftmals im Rahmen von Managementplanerstellungen oder Runden Tischen „das erste Mal, dass viele Landwirte oder Grund- oder Waldbesitzer überhaupt [mit Natura 2000] in Berührung kommen und nur wissen, ,das ist irgendein Schutzgebiet und da wird irgendwas unter Schutz gestellt und jetzt habe ich da Angst, dass ich da enteignet werde oder sonst irgendwas‘.“ Die Kooperation zwischen (Naturschutz-)Verwaltung und Betroffenen werde bereits im Vorfeld durch einen „schlechten Ruf“ (IV1) des Naturschutzes belastet.
Weiterhin seien – wie sich wie ein roter Faden durch die Interviews zieht (bspw. P1, GL2, M5) – begrenzte Kenntnisse der Bevölkerung zu Naturschutz und Natura 2000 ein Hindernis für deren Umsetzung, denn letztendlich seien Ansichten und Forderungen aus der Bevölkerung richtungsweisend für politische Maßnahmen. Hier bestünde im Hinblick auf die bayerische Bevölkerung noch eine „große Diskrepanz“ (GK1), denn für Bürger habe (regionale) Natur zwar – vielen Interviewpartnern zufolge (bspw. IV1, IV4, GEM1, GER2) – durchaus einen hohen Stellenwert (allg. dazu auchBMU &BfN 2018), „aber wenn es dann in Richtung Naturschutz geht, […] also in die Politik rein, […], da geht dann die Wirtschaft wieder vor und das schnelle Geld. […]. Deswegen ist es so wichtig, dass man den Bürgern den Zusammenhang klarmacht, denn das Bestreben ist schon da, also das Interesse an solchen Projekten“ (GK1). Natura 2000 bliebe bisher letztlich aber zu „abstrakt“ (M5, ebenfalls IV4) und „sperrig“ (IV1).
2.2 Konfligierende Nutzungsansprüche und divergierende Deutungen
Vor Ort erweisen sich aus Sicht der Interviewpartner konfligierende Nutzungsansprüche als eine zentrale Herausforderung, wie bspw. ein Gesprächspartner (GEM1) aus dem Bereich der Naturschutzverwaltung resümiert: „Konflikte treten insbesondere da auf, wo gewinnorientierte Nutzung eng mit den Schutzgütern verwoben ist. Die Konflikte sind geringer, wo das gut auseinandersortiert ist“ (hierzu vergleichbar auch P1, P5, GEM1, GL1, GER7, GK7 und weitere). Wo also land-, wasser- oder forstwirtschaftliche Nutzung Hand in Hand mit dem Erhalt von Arten und Habitaten gehen soll, besteht mitunter ein höheres Konfliktpotenzial hinsichtlich der Art und Ziele der Erhaltung. Einen weiteren Faktor bilden die Nähe zu Ballungsräumen und damit einhergehende Bodenspekulationen, „weil Bauland oder Gewerbegebietsflächen natürlich sehr viel mehr wert sind als Flächen, die als FFH-Gebiet belegt sind […] und das merkt man, das Konfliktpotenzial geht stark hoch“ (GEM1). Die Sorge vor Wert- oder Gewinnverlusten in Folge von Nutzungseinschränkungen tritt in Interviews mit Bewirtschaftern und Grundeigentümern deutlich hervor. Ein Interviewpartner (GK7) kritisiert, dass „wir nicht mehr bewirtschaften dürfen, wie wir wollen, […] dass wir die Bäume nicht mehr wegschneiden dürfen – das ist für uns dann ein Eingriff [und] für meinen Betrieb schlecht“. Aus dem Bereich der Landwirtschaft (GL1) wird geäußert, es sei „wichtig, dass man sich vor Augen hält, [ ] dass wir einfach ein dicht besiedeltes Land sind. Ich kann nicht in einer Großstadt wie München Naturschutzziele verfolgen, [ ] das funktioniert nicht.“
Divergierende Nutzungsansprüche stehen oftmals mit unterschiedlichen Zuschreibungen an Natur und Landschaft in Verbindung – ob nun als zwingend schützens- und bewahrenswert oder als sich in stetem Wandel durch den Menschen befindend –, woraus Konflikte resultieren können. Diese divergierenden Wertungen treten in den Interviews mehrfach implizit zutage (z. B. bei den Interviewpartnern GL1, GL4, IV2, IV3), andere Interviewpartner (P1, P3, GL3, IV4, GEM3 und weitere) nehmen diese explizit als Hürde wahr, denn „man kann solche Konflikte natürlich leichter abbauen, wenn man quasi eine gemeinsame Wertebasis hat. Also woran es wahrscheinlich grundlegend mangelt, ist, dass viele Leute einfach [ ] Natur und Natura 2000 nicht diesen Wert geben, der einfach angemessen wäre. [Man stellt fest, dass] halt völlig unterschiedliche Dinge bei den unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Wertigkeit haben“ (IV4). Solche verschiedenen Wertungen werden auch insbesondere von Bewirtschaftern und Grundeigentümern als problematisch empfunden – Vertreter der Naturschutzverwaltung werden als „ideologisch vorgeprägt“ beschrieben, „die auch nur einen relativ engen Horizont haben bezüglich der Sichtweise“ (GK2) bzw. als „grün verbohrt“, womit man „als vernünftiger Mensch natürlich keine Chance“ (GK7) habe, weil Naturschutz keine hinreichenden Spielräume lasse.
2.3 Als unzureichend wahrgenommene Kommunikation und Partizipationsmöglichkeiten
Neben begrenzter Bekanntheit sowie konfligierenden Nutzungsansprüchen und Deutungen kristallisiert sich aus den Interviews eine als unzureichend wahrgenommene Kommunikation mit Stakeholdern vor Ort und deren Einbindung als weitere beschriebene Hürden um Natura 2000 heraus (u. a. bei den Interviewpartnern P2, P3, GL2, GL2, GL4, GL5, IV2, GER1, GER6). Dies liegt in Teilen im Vorgehen zu Beginn der Etablierung in Bayern begründet, die vielfach als einschneidend und ausschlaggebend für den weiteren Verlauf wahrgenommen wird. So kommunizierte das bayerische Umweltministerium nach Ansicht mehrerer Interviewpartner die zu erwartenden Auflagen und Veränderungen unzureichend oder verfälschend. Aus Sicht von Bewirtschaftern wurde „gelogen“ (GL1), was „einen sehr großen Vertrauensverlust“ (GL5) in Naturschutz und Verwaltung zur Folge hatte. Das „gewachsene Misstrauen“ (P3) wirke auch noch nach Jahren und sei „die größte Hürde […] überhaupt“ (P3). Kommunikationsdefizite zwischen Politik, Verwaltung und regionalen und lokalen Stakeholdern beeinflussen aus Sicht mehrerer Befragter bis heute das Verhältnis untereinander und erschwerten die Kooperation.
Gleichzeitig bestünden trotz Bemühungen und angestrebten Neuerungen im Hinblick auf Kommunikation sowie Partizipationsmöglichkeiten weiterhin Rückstände (u. a. bei P3, GL2, GL3, GL5, IV4, GEM2). So beklagt ein Interviewpartner aus dem Bereich der Fischerei (GL3), dass „die Eigentümer von grundgebundenen Rechten in FFH-Gebieten gerne mal ein bisschen unter den Tisch gefallen lassen werden.“ Auch aus dem Bereich der Jagd (GEM9) wird auf eine mangelnde Einbindung hingewiesen, die Konflikte und Unzufriedenheit schüre: „Da gibt es halt oft die Konflikte, da wird irgendwo etwas gemacht, irgendeine Maßnahme durchgeführt“, z. B. durch den Landschaftspflegeverband oder Naturschutzbehörden, und „dann wird hinterher geschimpft, dass das ein Schmarrn ist“. Dies sei jedoch oftmals lediglich in der mangelnden Einbeziehung begründet, denn „oft wird ja bloß geschimpft, weil man sich übergangen fühlt“ (GEM9). Hierzu trügen auch Probleme bei der Organisation von Informationsveranstaltungen bei, die manches Mal nicht ausreichend beworben würden, da „die Bekanntgabe von solchen Terminen nur im Amtsblatt irgendwo erscheint und das liest halt kein Mensch durch“ (GL3). Auch sei problematisch, so ein Interviewpartner (GEM2), dass Informationen den Interessierten nicht in hinreichender Tiefe zur Verfügung gestellt würden.
2.4 Begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen
Die bisher skizzierten Herausforderungen sind in Zusammenhang mit einer als unzureichend beschriebenen personellen wie finanziellen Ausstattung zugunsten von Natura 2000 zu betrachten (Verweise hierzu u. a. bei, P1, GL2, GL3, IV1, IV2, IV3, GEM9, GK3, GK4, GK8). „Forderungen des Managementplans“ seien, so ein Interviewpartner aus der Politik, „auch in die Realität um[zu]setzen – und das wird eine riesige Herausforderung für die Bayern, [für die sie] mit dem jetzigen Personal, mit der Personalstärke nicht gerüstet“ seien (P1). Der Personalmangel bedinge „ein Kapazitätsproblem. Wer soll das Ganze überwachen? Wenn ich die Unteren Naturschutzbehörden anschaue, die sind ja personell gar nicht in der Lage dazu“ (GEM9). Auch im Hinblick auf die begleitende forcierte Öffentlichkeitsarbeit werde die derzeitige Personalstärke der Relevanz der Aufgabe nicht gerecht, denn zurzeit könne „bei [den Behörden] Öffentlichkeitsarbeit nur immer zum kleinen Teil nebenbei laufen“ (GEM1). Nach Aussage eines Interviewpartners (P1) aus dem Bereich der Politik seien Forderungen personeller Aufstockung für die Naturschutzbehörden bislang häufig durch Politiker vereitelt worden, die die Ansicht verträten, „‚viel Personal in Naturschutzbehörden [bedeute] viel Probleme, wenig Personal in Naturschutzbehörden [bedeute] wenig Probleme‘“.
Auch seien die Fördermöglichkeiten für Bewirtschafter nicht ausreichend. Entsprechend vertritt ein Interviewpartner aus dem Bereich des ehrenamtlichen Naturschutzes die Ansicht: „Gäb‘s genügend Geld für die Landwirte, […] hätten wir überhaupt keine widerstreitenden Interessen“ (Bezüge hierzu u. a. auch bei IV1, IV2, P1, P3, GK3, GK4, GK8; vgl. auchKreiseret al. 2018). Weiterhin bemängelt ein Interviewpartner (GK3) aus dem Bereich der Naturschutzverwaltung, dass „die geltende Rechtslage doch sehr zu Ungunsten der Grundeigentümer gestaltet“ sei.
3 Potenzielle Regelungsansätze zur weiteren Etablierung von Natura 2000
Welche möglichen Regelungsansätze ergeben sich im Hinblick auf die angeführten Herausforderungen aus Sicht der Befragten (zur Übersicht Tab. 2)? Viele Interviewpartner (u. a. P1, P3, P4, IV1, IV3, IV4, GL2, GL3, M1, M3) sehen es als notwendig an, Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung zu Natura 2000 mehr Bedeutung beizumessen und zu intensivieren, um langfristig die Öffentlichkeit für die verfolgten Ziele zu gewinnen. Hier sei es wichtig, kritischer Berichterstattung Positivbeispiele gegenüberzustellen, denn „meistens kommt man mit dem [Naturschutz] ja nur negativ in Kontakt, wenn man ihn bewusst wahrnimmt – und unbewusst, dass ich draußen die Erholung habe, das ist eben dann das Positive und das wird gar nicht so richtig wahrgenommen“ (GK1). Weiterhin wird der Kommunikation erfolgreicher „Leuchtturmprojekte“ (GL3) besondere Wirksamkeit zugesprochen, anhand derer ein „Storytelling“ (IV1) zugunsten einer emotionalen Bindung (M4) betrieben werde könne. Im Hinblick auf die Formen und Kanäle der Kommunikation sei hier „[d]as Potenzial [...] bei weitem nicht ausgeschöpft“ (GL3), insbesondere was die Nutzung neuer und insbesondere sozialer Medien – Stichwort Jugendliche – betreffe, aber auch die ,herkömmlichen‘ Medien um Rundfunk, Fernsehen und Presse seien nicht zu vernachlässigen. Ein grundsätzliches „gesellschaftliche[s] Interesse an den Themen“ sei gegeben (IV1), weswegen ein quantitativer wie qualitativer Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit auf Resonanz stoßen könne. Entscheidend sei dabei, „dass man auch in einer Sprache spricht, die der normale Bürger versteht“ (GL2).
Weiterhin lassen sich Handlungsempfehlungen für einen gelingenden Umgang mit Differenzen ableiten. Wie mehrere Interviewpartner (u. a. P4, GL3, GL5, JG1, IV2, IV3, GE4, GE6, GK9, GEM1, GEM3, GEM9) berichten, sei eine frühe Kommunikation auf persönlicher Ebene vielfach in der Lage, potenzielle Konfliktlagen zu entschärfen. So sei es auf Gebietsebene hilfreich, gemeinsam Übereinstimmungen auszuloten: „,Wie können wir das jetzt gemeinsam machen, wo könnt ihr was abgeben, wo können wir euch helfen?‘ und das dann gemeinsam erarbeiten und dann gemeinsam vorstellen. Und dann ist das auf jeden Fall eine viel bessere, runde Sache“ (GK1). Um zu einer solchen Konfliktregelung bzw. -prävention beizutragen, sei es unabdingbar, den „persönliche[n] Kontakt mit Beteiligten“ zu pflegen und diese einzubinden (GK8, ähnlich GEM9) und „ganz offen und durchsichtig darzulegen, wie die Regeln […] und wie die Optionen sind“ (GEM2). Wichtig sei zudem, langfristige Ansprechpartner zu haben (GK6), denn oftmals seien Zuständigkeiten zwischen den Behörden für Stakeholder nicht eindeutig. Ein Interviewpartner (GL1) beklagt, Kommunikation sei „nicht möglich, weil da ist keiner zuständig“, man würde nur „zerrieben zwischen den einzelnen Behörden“. Die Rolle intensivierter und persönlicher Kommunikation mit Landnutzern und das Potenzial von Gebietbetreuern als vermittelnde und konkrete Ansprechpartner vor Ort wird vergleichbar auch in einer Veröffentlichung des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege (DVL 2018) dargelegt.
Es zeigt sich zudem, dass ein ‚Konsens‘ im Sinne einer „gemeinsamen Wertebasis“ (IV4) im Hinblick auf Natur(-Schutz) keine notwendige Voraussetzung für eine Regelung von Konflikten darstellt. Weitaus mehr Tragweite wird der Etablierung und Einhaltung gewisser ‚Spielregeln‘ der Kommunikation und des Umgangs miteinander zugesprochen – häufige Erwähnung finden z. B. Ehrlichkeit, Transparenz, Verbindlichkeit und Verständlichkeit (z. B. GL1, GL3, IV2). Dementsprechend bestünde eine Handlungsoption darin, Vertreter der Naturschutzverwaltung, die mit der Einbindung der Stakeholder beauftragt sind, in Kommunikation insbesondere in Konfliktsituationen zu schulen (vgl. auchDVL2018: 42f.). Unterstützend könnten einheitliche und leicht zugängliche Dokumente, die über Natura 2000 informieren, eine Grundlage bieten, auf der die Kommunikation mit Stakeholdern aufbauen kann und die die Pluralität von Interessen und Belangen nicht „beschönigen“.
Mit der Forderung nach intensivierter Kommunikation mit und Einbindung von Stakeholdern und forcierter Öffentlichkeit steigt allerdings der Bedarf nach hierfür zuständigem Personal, das – wie die Analyse gezeigt hat – als nicht hinreichend gegeben beschrieben wird. Wie auch der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL 2018: 43) festhält, erfordern „Einzelgespräche mit wichtigen Beteiligten, fachliche Abstimmung, Organisation sowie Abrechnung der Maßnahmen und nicht zuletzt eine qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit“ Zeit, die entsprechendes Personal und finanzielle Ausstattung unabdingar machten (u. a. GEM9, P1, IV1). Zusicherungen einer umfangreicheren Mittelausstattung werden daher gefordert, die sich auch positiv auf auszubauendes Vertrauen zwischen Verwaltung und Stakeholdern auswirken könnten, denn bislang bestünde zuweilen „die Angst, [ ] dass die Freiwilligkeit irgendwann wegfällt und dass [die Bewirtschafter] dann in der Kooperation gefangen sind und nicht mehr aussteigen können. Und das ist manchmal eine Bremse, dass das Vertrauen nicht ausreichend vorhanden ist“ (GEM1), womit Handlungsbedarf einhergeht.
4 Fazit – Konfliktregelungen im Rahmen von Naturschutzvorhaben
Zusammenfassend treten im Rahmen von Natura 2000 in Bayern konfligierende Nutzungsansprüche und Deutungen auf, die unterschiedliches Konfliktpotenzial bergen und durch variierende Kenntnisse über Natura 2000 weiterhin befördert werden können. Auf Bestreben der EU- und nationalen Ebene wurden in den vergangenen Jahren neue Beteiligungs- und Kommunikationsmaßnahmen eingeführt, die bereits erste Erfolge erzielen konnten. So zeigt sich, dass eine frühzeitige, intensivierte und persönliche Kommunikation zwischen Grundeigentümern und Bewirtschaftern auf der einen Seite und Vertretern der Naturschutzverwaltung auf der anderen Seite Konfliktpotenziale auf Gebietsebene abmildern konnten. Die Herstellung von ‚Konsens‘ im Sinne geteilter Interessen und Deutungen stellt dabei keine Notwendigkeit dar. Ausschlaggebender für die Aushandlungsprozesse war die Verständigung auf gewisse ‚Spielregeln‘ der Kommunikation wie Verbindlichkeit und Transparenz: Nicht alle müssen einer Meinung sein, doch muss das Gegenüber mit seiner Haltung respektiert werden, um zu einer Konfliktregelung gelangen zu können. Dieser Aspekt zeigt sich vergleichbar auch in anderen Kontexten mit Naturschutzbezügen wie der Energiewende (Berr & Jenal2019,Kühne2018,Weber2018).
Begleitend zu einer intensivierten Einbindung von Stakeholdern kann eine umfangreichere Öffentlichkeitsarbeit Bekanntheit und Akzeptanz von Naturschutzvorhaben in der Bevölkerung befördern. Sowohl im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen als auch auf die Kommunikation mit und Partizipation von Stakeholdern im Speziellen kann sich allerdings eine unzureichende personelle wie finanzielle Ausstattung der Behörden als limitierender Faktor erweisen. Grundlegend wird konfliktbezogen geschultes Personal aus Sicht von Interviewpartnern benötigt. Diese Aspekte können letztendlich auch über Natura 2000 hinaus als relevant erachtet werden. Klima-, Umwelt- und Naturschutz stellen gesamtgesellschaftliche Aufgaben dar, für deren künftige Umsetzung eine Beteiligung von Akteuren mit unvermeidlich konfligierenden Interessen und Deutungen unabdingbar scheint. Das Erproben von Konfliktregelungsansätzen, die nicht zwingend Konsens erfordern, sondern ein gewisses Maß an Divergenzen zulassen, erfährt damit über Natura 2000 hinaus für künftige Naturschutzanliegen hohe Praxisrelevanz. Zu diesen Erkenntnissen gelangte auch der mehrjährige ,Fitness Check‘ der EU-Naturschutzrichtlinien, die Eingang in den aktuellen Aktionsplan zur besseren Umsetzung fanden (Kreiseret al. 2018). In der Auswertung der Stakeholderinterviews lassen sich verschiedene übergreifende, allerdings weniger stark vergleichbare gruppenspezifische Argumentations- und Deutungsmuster erkennen. Diese sind in zukünftigen Forschungsvorhaben einer quantitativen Vertiefung zuzuführen.
Förderhinweis
Die Evaluierung des Projektes „LIFE living Natura 2000“, auf der die im Artikel dargestellten Ergebnisse basieren, erfolgt durch Forschungsteams der Universität Tübingen und der Universität des Saarlandes unter Förderung durch die Europäische Union (LIFE 16 GIE/DE/000012).
Literatur
- ANL(Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege)(2018): LIFE living Natura 2000 – Ein Kommunikationsprojekt für das europäische Naturerbe in Bayern, 4 S., https://www.anl.bayern.de/projekte/life_projekt/doc/ganz_meine_natur_projektflyer_web_barriere frei_small.pdf (zuletzt abgerufen am 12.11. 2019).
- Berr, K.,Jenal, C., Hrsg. (2019): Landschaftskonflikte, Springer VS, Wiesbaden.
- BfN (Bundesamt für Naturschutz), BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)(2010): Natura 2000 in Deutschland – Edelsteine der Natur, Bonn-Bad Godesberg, https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/BFN_Broschuere_deu_lang.pdf (zuletzt abgerufen am 12.11. 2019).
- Blondet, M., Koning, J.de,Borrass, L., Ferranti, F., Geitzenauer, M., Weiss, G., Turnhout, E., Winkel, G. (2017): Participation in the implementation of Natura 2000: A comparative study of six EU member states. Land Use Policy 66, 346–355.
- BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), BfN (Bundesamt für Naturschutz) (2018): Naturbewusstsein 2017 – Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt, Berlin, Bonn, https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/naturbewusstseinsstudie_2017_de_bf.pdf (zuletzt abgerufen am 12.11.2019).
- Crossey, N., Roßmeier, A., Weber, F. (2019): Zwischen der Erreichung von Biodiversitätszielen und befürchteten Nutzungseinschränkungen – (Landschafts)Konflikte um das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 in Bayern. In:Berr, K., Jenal, C.(Hrsg.), Landschaftskonflikte, Springer VS, Wiesbaden, 269–290.
- Dahrendorf, R. (1972): Konflikt und Freiheit – Auf dem Weg zur Dienstklassengesellschaft, Piper, München, 336 S.
- DVL(Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V.)(2018): Natura 2000 – Lebensraum für Mensch und Natur – Leitfaden zur Umsetzung, Selbstverlag, Ansbach.
- Europäischer Rat (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen – FFH-Richtlinie.
- Flick, U. (2011): Das Episodische Interview. In:Oelerich, G., Otto, H.-U.(Hrsg.), Empirische Forschung und Soziale Arbeit. Ein Studienbuch, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 273–280.
- Henle, K., Alard, D., Clitherow, J., Cobb, P., Firbank, L., Kull, T., McCracken, D., Moritz, R., Niemelä, J., Rebane, M., Wascher, D., Watt, A., Young, J. (2008): Identifying and managing the conflicts between agriculture and biodiversity conservation in Europe–A review. Agriculture, Ecosystems & Environment 124 (1-2), 60–71.
- Kreiser, K., Mayr, C., Barnes, K., Weyland, R. (2018): Ziele, Inhalte, Ergebnisse und Konsequenzen des „Fitness-Checks“ der EU-Naturschutzrichtlinien. Natur und Landschaft 93, 510–516.
- Kühne, O. (2018): ‚Neue Landschaftskonflikte‘ – Überlegungen zu den physischen Manifestationen der Energiewende auf der Grundlage der Konflikttheorie Ralf Dahrendorfs. In:Kühne, O., Weber, F.(Hrsg.), Bausteine der Energiewende, Springer VS, Wiesbaden, 163–186.
- LfU Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt)(2018): NATURA 2000 Bayern – Einführung, Augsburg, https://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm (zuletzt abgerufen am 12.11.2019).
- Mattissek, A., Pfaffenbach, C., Reuber, P. (2013): Methoden der empirischen Humangeographie, Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig.
- Mayr, C. (2010): Bilanz der Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie und Forderungen zur Verbesserung des Vogelschutzes aus Sicht des NABU. Drei Jahrzehnte Vogelschutz im Herzen Europas: Rückblick, Bilanz und Herausforderungen. Naturschutz und Biologische Vielfalt 95, 39–54.
- Mayring, P. (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung – Eine Anleitung zu qualitativem Denken, Beltz, Weinheim. 5. Aufl.
- StMUGV(Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz),StMLF (Staatsministerium für Landwirtschaft) (2006): Managementplan und Runder Tisch für FFH-Vogelschutzgebiete in Bayern – Europas Naturerbe sichern. Bayerns Heimat bewahren, Selbstverlag, München.
- StMUV(Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz)(2016): Bayerische Verordnung über die Natura 2000-Gebiete – BayNat2000V, München, 4 S., https://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/biodiversitaet/natura2000/doc/natura2000_verordnung_lesefassung.pdf (zuletzt abgerufen am 12.11.2019).
- Weber, F. (2018): Konflikte um die Energiewende – Vom Diskurs zur Praxis, Springer VS, Wiesbaden, 418 S.
- Winkel, G., Blondet, M., Borrass, L., Frei, T., Geitzenauer, M., Gruppe, A., Jump, A., Koning, J.de,Sotirov, M., Weiss, G., Winter, S., Turnhout, E. (2015): The implementation of Natura 2000 in forests: A trans- and interdisciplinary assessment of challenges and choices. Environmental Science & Policy 52, 23–32.
Qualitativer Zugang zu Natura 2000
Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf einem qualitativen Forschungszugang (vgl. allg. u. a.Mattisseket al. 2013,Mayring2002), der tiefere Einblicke in die Beweggründe, Deutungen und Perspektiven unterschiedlicher Akteure gewährt. Hier wurden offen gehaltene episodische Interviews mit verschiedenen mit Natura 2000 in Verbindung stehenden Stakeholdern geführt (dazu z. B.Flick2011), die es von kurzen Impulsen ausgehend ermöglichten, lange Erzählpassagen zu Einschätzungen rund um Naturschutz, das EU-weite Schutzgebietsnetz Natura 2000 und damit verbundene Herausforderungen zu generieren. Die Vielfalt an Befragten bietet einerseits das Potenzial, divergierende Einschätzungen einzufangen, andererseits konnten gleichzeitig wiederkehrende und damit vergleichbare Herausforderungen identifiziert werden.
Fazit für die Praxis
- Begrenzte Kenntnisse zu Natura 2000 befördern insbesondere bei Bewirtschaftern und Grundeigentümern Befürchtungen vor Nutzungseinschränkungen und Wertverlusten, weswegen eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit Grundsteine für die Umsetzung vorgesehener Maßnahmen legen kann.
- Divergierende Nutzungsansprüche und Bewertungen von Natur(-Schutz) bergen gebietsspezifisches Konfliktpotenzial. Für den Umgang mit Grundsatz- und Interessenkonflikten ist nicht zwingend Konsens erforderlich, hingegen aber eine Aushandlung und Einhaltung gewisser geteilter Regeln, damit Konflikte einer Regelung zugeführt werden können.
- Der limitierende Faktor für eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit und eine intensivierte Kommunikation auf Gebietsebene wird in begrenzten finanziellen wie personellen Ressourcen der entsprechenden Behörden gesehen. Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation aber bedürfen hinreichend und zudem konfliktbezogen geschulten Personals.
Kontakt
M.A. Nora Crossey studierte Liberal Arts and Sciences mit Hauptfach Governance am University College der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Humangeographie an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Seit April 2019 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachrichtung Geographie – Europastudien | Schwerpunkte Westeuropa und Grenzräume – der Universität des Saarlandes tätig und promoviert zu multilevel crossborder governance im Grenzbereich Saarland-Lothringen.
> nora.crossey@uni-saarland.de
M.A. Albert Roßmeier studierte Landschaftsarchitektur und Stadtplanung an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, anschließend Humangeographie an der Universität Tübingen. Er begleitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter das vom Bundesamt für Naturschutz geförderte Vorhaben ‚Landschaftsbild und Energiewende‘ und die Evaluierung des EU-Projektes ‚LIFE living Natura 2000‘. Aktuell promoviert er zu städtischem Wandel in Südkalifornien. Arbeitsschwerpunkte u. a. Landschaftswandel und Stadtentwicklung.
> albert.rossmeier@uni-tuebingen.de
Jun.-Prof. Dr. habil. Florian Weber forscht und lehrt nach Stationen in Erlangen, Würzburg, Kaiserslautern, Freising und Tübingen seit April 2019 in der Fachrichtung Geographie – Europastudien | Schwerpunkte Westeuropa und Grenzräume – der Universität des Saarlandes. Studium der Wirtschafts- und Sozialgeographie an der Universität Mainz, Promotion an der Universität Erlangen-Nürnberg, Habilitation an der Universität Tübingen. Arbeitsschwerpunkte u. a. Diskursforschung, Border Studies, Energiewende sowie Stadt- und Regionalentwicklung.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen










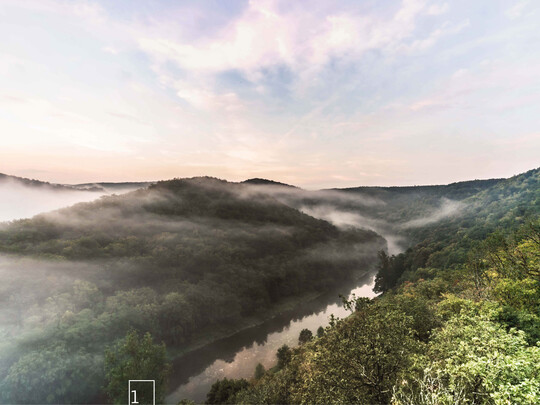



Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.