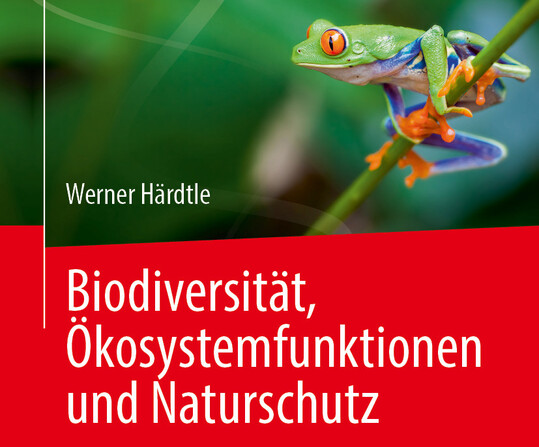
Arten-Einerlei?
Je jünger die Menschen, desto weniger sind sie in der Lage, selbst häufige Tier- und Pflanzenarten zu erkennen. Gleichermaßen sinkt ihre Verbundenheit zur Natur und die Bereitschaft, sich für die Natur einzusetzen. Das ist ein wesentliches Ergebnis einer Studie, die kürzlich in „Ambio“ erschien. Darin wurde unter Leitung von Prof. Dr. Tanja Straka und Prof. Dr. Ingo Kowarik erstmals systematisch untersucht, wie sich Jugendliche sowie junge und ältere Erwachsene hinsichtlich ihres Naturkontakts, der Artenkenntnis, der Naturverbundenheit und der Bereitschaft, sich für die Natur einzusetzen, unterscheiden. Wir haben mit den Studienleitenden gesprochen.
von Julia Bächtle erschienen am 29.07.2025










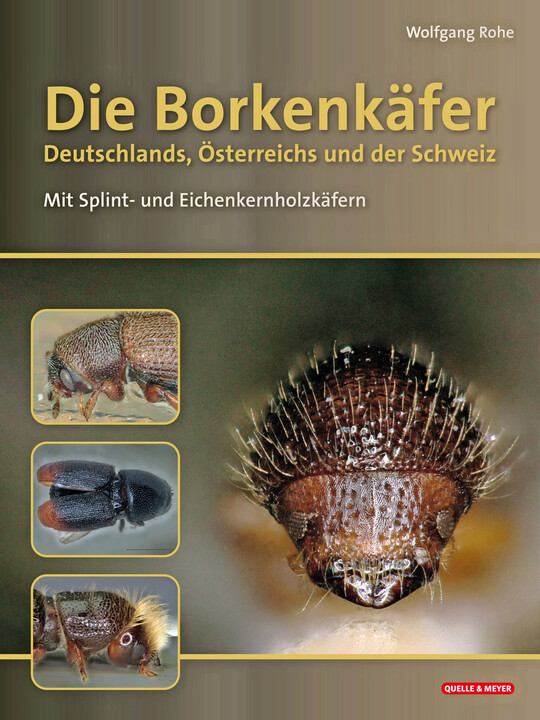
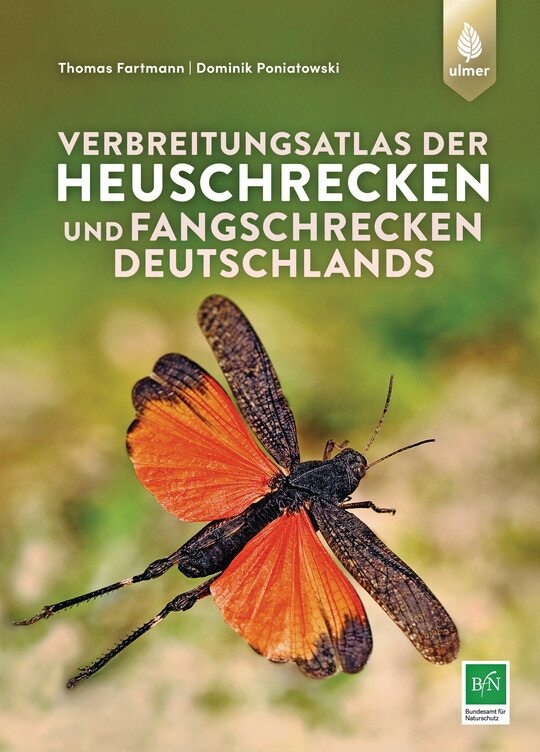
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.