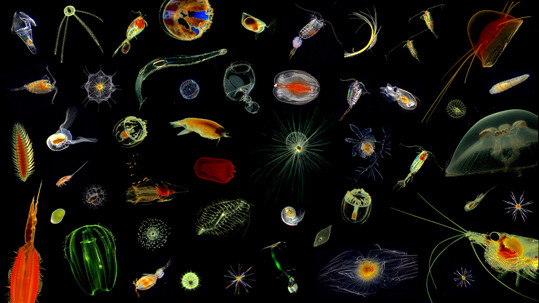
Der Biber, das Streittier
Wenn es einer bedrohten Art gelingt, sich in ihrem ehemaligen Lebensraum wieder anzusiedeln, ist die Freude zunächst groß. Langfristig ist die Ausbreitung jedoch oft mit Konflikten verbunden. Ein Beispiel dafür ist der Biber. Durch seine Wiederansiedlung werden oft wichtige Ökosystemfunktionen wiederhergestellt. Doch gerade wegen seines großen Einflusses auf Gewässer und Ufer polarisiert der Biber. Forschende des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) bringen etwas Farbe in die schwarz-weiße Diskussion.
von Nadja Neumann, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)/Redaktion erschienen am 28.10.2024


Was kann also für Fische in Bibergewässern getan werden? Den Fließgewässern mehr Raum geben, Auen und Nebengerinne revitalisieren, den Wasserrückhalt in der Landschaft stabilisieren und Trockenheit vorbeugen. Wenn Biber ausreichend tiefes Wasser vorfinden, damit ihre Wohnröhren nicht austrocknen, sind sie nicht auf Baumaßnahmen im Sinne von Stauungen angewiesen, und dann können Flussfische und Biber sehr gut koexistieren, was auch dem guten ökologischen Zustand nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie entsprechen würde. Darüber hinaus fördert die Revitalisierung von Kleingewässern wie Forellentieflandbächen den Wasserrückhalt in der Landschaft zugunsten von Bibern und Flussfischarten. Stichwort Wasserrückhalt: Frau Warter, Sie erforschen den Wasserhaushalt in der Landschaft, auch im Demnitzer Mühlenfließ in Brandenburg, wo das IGB eine Feldstation unterhält. Dort ist auch der Biber aktiv. Welchen Einfluss hat er auf den Wasserhaushalt? Wasserknappheit ist ein großes Problem in Brandenburg. Wir müssen in Zukunft alles tun, um das wenige Niederschlagswasser in der Landschaft zu halten. Biber sorgen dafür, dass das Wasser in den Fließgewässern langsamer abfließt und mehr im Grundwasser versickern kann. Unsere Arbeitsgruppe um Prof. Dörthe Tetzlaff hat zum Beispiel die Daten des Demnitzer Mühlenfließes der letzten 30 Jahre ausgewertet und die Wasserführung vor und nach der Renaturierung und Wiederansiedlung von Bibern untersucht. Vor dem Jahr 2000 wurden weniger als 5 % der Niederschläge dem Grundwasser zugeführt. Seitdem hat sich die Grundwasserneubildungsrate aus Niederschlägen fast verdoppelt, ist aber mit rund 10 % des Jahresniederschlags immer noch gering. Es gab aber noch weitere Vorteile: Die durch die Wiederansiedlung des Bibers begünstigte Wiedervernässung und Renaturierung von Moorflächen nördlich des Demnitzer Mühlenfließes führte zu einer längeren Verweildauer des Wassers im Gewässersystem und zu einer Verringerung der täglichen Wasserstandsschwankungen, d.h. zu einem „gedämpften“ Abflussverhalten. Dies ist besonders in Trockenperioden von Vorteil, da die Gewässer länger Wasser führen. Wir haben auch eine Verbesserung der Wasserqualität festgestellt. Ist der Brandenburger Biber also eine Erfolgsgeschichte? Grundsätzlich ist seine Rückkehr und Ausbreitung aus gewässerökologischer Sicht natürlich zu begrüßen. Aber man muss das differenziert betrachten, wie die Kolleginnen und Kollegen schon beschrieben haben. Was den Wasserhaushalt angeht: Der Biber allein kann einen gestressten Wasserhaushalt nicht wiederherstellen. Und um auf das konkrete Beispiel des Demnitzer Mühlenfließes zurückzukommen: Auch der Biber kann von Klimaextremen betroffen sein. Seit der extremen Trockenheit im Jahr 2018 ist die Biberaktivität am Demnitzer Mühlenfließ zurückgegangen. Die Tendenz zu extremeren Wasserstandsschwankungen und Dürreperioden haben seinen funktionalen Lebensraum stark eingeschränkt. Die Moorflächen im Norden und ein Feuchtgebiet im Süden sind die einzigen Orte, an denen das Gewässer ganzjährig Wasser führt.
In natürlichen Gewässern lebten Fische und Biber lange Zeit Seite an Seite Dr. Christian Wolter










Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.