Gefälligkeiten und unbrauchbare Empfehlungen
- Veröffentlicht am
Dirk Bernd beschäftigt sich schon von Kindesbeinen an mit den Artengruppen der Fledermäuse und Vögel, hat sich auch schon früh in Vereinen und Verbänden engagiert. Mit seinem Buch „Windindustrie versus Artenvielfalt“ möchte er die Aufmerksamkeit auf die Konflikte der Windenergie mit dem Artenschutz lenken.
Redaktion:Herr Bernd, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wie kommt es, dass Sie sich so intensiv mit dem Thema Windenergie auseinandersetzen?
Dirk Bernd:Angefangen hat das bei uns im Odenwald, als die Windkraft auch verstärkt in den Wald kam. Das war ungefähr 2012. Da hieß es auf einmal: Die Offenlandstandorte reichen nicht mehr, wir müssen jetzt auch in den Wald gehen. Da wurde es natürlich interessant, da zu erwarten war, dass nun auch verstärkt zahlreiche weitere Arten wie Greifvögel und Fledermäuse betroffen sein können.
Sie schreiben, dass die Windenergieanlagen vor allem für Mäusebussarde, Rotmilane und Schwarzstörche gefährlich sind. Was ist denn die größte Gefahr dieser Anlagen?
Für die meisten Arten ist bekannt, dass sie kein Meideverhalten zeigen, also keine Reaktion auf die freischlagenden Rotoren. Vor allem der Rotmilan fliegt nahrungsuchend regelmäßig in Waldflächen ein. Der jagt über Baumwipfeln, der jagt in der Baumkrone, der jagt aber auch auf Freiflächen und Waldlichtungen. Und so kann er eben mit den Rotoren kollidieren.
Beim Schwarzstorch ist das etwas anders. Da gibt es Individuen, die scheinbar Meideverhalten zeigen und tatsächlich um die Anlagen herumfliegen und abdrehen beziehungsweise die Nahrungshabitate am Boden kaum mehr nutzen. Aber die meisten Vögel fliegen auch hier ohne erkennbare Reaktion obendrüber, mittendurch oder daran vorbei ohne erkennbare Verhaltensreaktion. Sie fliegen teilweise, vermutlich aufgrund der Thermik, auch gezielt in die Windräder.
Anders ist das beispielsweise bei ziehenden Kranichen. Da kann man erkennen, dass die an einem Höhenrücken vor Windrädern in der Thermik plötzlich abdrehen oder höher fliegen. Es ist anzunehmen, dass die Tiere dabei auf den optischen Reiz, die Bewegung, reagieren, sich dadurch gestört fühlen und ihr Flugverhalten ändern, zumindest kann ihnen dies tagsüber gelingen.
Sie stellen Bussard, Milan und Storch im Buch ausführlich vor. Welche Arten sind denn neben den genannten noch betroffen?
Praktisch sind alle Arten betroffen. Wenn wir zum Beispiel einen Blick auf die Sempacher Studie von der Schweizer Vogelschutzwarte werfen, war als häufigstes Schlagopfer das Wintergoldhähnchen betroffen. Theoretisch ist alles betroffen, was in den Höhen ab 80 Meter bis über 250 Meter fliegt.
Maßnahmen zur Vermeidung funktionieren nicht. Weder eine Abschaltung der Anlagen zu bestimmten Zeiten noch Ablenkfütterungen für Rotmilane oder Ausweichteiche für den Schwarzstorch. Ein artökologisches Raumnutzungsverhalten von Vögeln ist immer darin begründet, möglichst viele Nahrungshabitate alternierend anzufliegen, nicht aber nur einige wenige Flächen aufzusuchen. Die Nutzung von Nahrungshabitaten innerhalb der Reviere der Arten ist somit durch Maßnahmen kaum beeinflussbar. Das Gleiche gilt für Vergrämung oder Kamerasysteme. Das alles sind technische Systeme, die sich erst einmal gut anhören, sich aber in der Praxis nicht bewähren.
In Ihrem Buch haben Sie Daten von fast 30 Jahren ausgewertet. Zu welchem Schluss sind Sie dabei gekommen?
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sehr ausführliche phänologische Daten sowie Bestandsdaten zu den Fledermäusen im Odenwald und im Oberrheingraben vorliegen. Und da zeichnet sich ab, dass die beiden am stärksten von der Windkraft betroffenen Arten, die Rauhautfledermaus und der Große Abendsegler, die am deutlichsten zurückgehenden Bestände zeigen. Für die Rauhautfledermaus gilt, dass wir in den Kastengebieten, in denen sie im Herbst Paarungsquartiere aufbauen, noch Anfang der 90er-Jahre hohe Bestände hatten. Aus den Auswertungen zeigt sich, dass die Rauhautfledermäuse seit 2004 kontinuierlich bis heute um etwa die Hälfte im Bestand zurückgegangen sind. Und beim Abendsegler war es sogar so, dass die schwimmenden Populationsanteile, die sich auch in günstigen Lebensräumen gerade in Maikäfergradationsjahren im Oberrheingraben aufhalten, relativ schlagartig in den Jahren 2003 und 2004 zusammengebrochen sind. Zudem ist auch der migrierende Anteil, der jedes Jahr im Herbst an der Bergstraße und im Odenwald zu beobachten ist, im Bestand um über 90 Prozent zurückgegangen.
Ist das denn allein auf die Windenergie zurückzuführen?
Ich habe verschiedene Szenarien diskutiert, begonnen von pathogenen Ursachen über andere anthropogene Ursachen bis zum Klima, von inter- bis zu intraspezifischer Konkurrenz. Das konnte aber alles mehr oder weniger ausgeschlossen werden. Somit bleibt nur die Windenergie. Das ist auch nur logisch, betrachtet man die seit Jahrzehnten anhaltenden und steigenden Verluste.
Wenn jährlich Zehntausende oder Hunderttausende von Schlüsselindividuen einer Population entnommen werden – es wird ja nicht selektiv entnommen, es trifft eben nicht nur die Schwächsten, sondern gerade die, die zugfähig sind, die adulten Tiere, die Jungtiere. Wenn diese einer Population entnommen werden, die wie bei den Fledermäusen nur eine geringe Reproduktionsrate aufweisen, dann ist es logisch, dass das der Population schadet. Ab einer gewissen Schlagopferzahl muss die Population zurückgehen, das geht gar nicht anders. Gleiches gilt natürlich auch für den Mäusebussard und weitere Arten.
Sie setzen sich überwiegend mit dem Odenwald auseinander. Sind Ihre Ergebnisse denn auch auf andere Regionen Deutschlands übertragbar?
Ich habe es verglichen mit weiteren Mittelgebirgsräumen, wie der Schwäbischen Alb, dem Vogelsberg, Spessart und Taunus. Im Prinzip bietet sich vom artökologischen Verhalten und vom Artenspektrum die gleiche Situation: Überall geht die Windkraft in den Wald, überall geht sie auf die Höhenrücken, wo am meisten Wind weht – also genau in die Thermikräume der Vögel. Somit ist das in allen deutschen Mittelgebirgen und auch letztlich im Offenland gar nicht anders zu erwarten, als dass die Windkraft beim derzeitigen Ausbaustand, eigentlich schon seit einigen Jahren, die Populationen schwächt.
Wenn wir das weiterdenken: Was muss sich denn in der Energielandschaft Deutschlands verändern?
Man bräuchte Vermeidungsmaßnahmen, was bei freischlagenden Rotoren aber nicht funktioniert. Es funktionieren ja auch die Abschaltzeiten für Fledermäuse nicht, das konnte nachgewiesen werden. Da findet man häufig zwei tote Individuen innerhalb weniger Tage pro Anlage, was nicht sein dürfte. Zwei Todesfälle pro Jahr sind nur einkalkuliert. Wenn man das hochrechnet, übersteigt das die Prognose um ein Vielfaches, wobei auch zwei zusätzlich getötete Individuen für viele Lokalpopulationen, insbesondere solche mit kleinen Kolonien von nur wenigen Individuen, bereits ein Schlagopfer zu viel sein kann.
Die Modelle kranken allein schon daran, dass es keine rechtliche Grundlage gibt, mit der ich begründen könnte, wie ich bei Windanlagen im Gebiet einer Fledermauskolonie ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko vermeiden will. Selbst wenn ich Abschaltzeiten abhängig von Wind und Temperatur annehme: Das funktioniert nicht. Lebensrealistisch betrachtet ist das eine nette Idee, aber es bleibt bei der Theorie. In der Praxis funktioniert es nicht.
Gibt es Alternativen?
Das wäre dann eine Diskussion über Einsparungen, über bessere Speicher. Man könnte mehr über Fotovoltaik arbeiten. Das wurde aber bisher nicht gemacht. Wir machen eine Stromwende – und die muss man cleverer gestalten. Aber eine politische Vorgabe, 2 Prozent der Landesfläche für Windkraft einzuplanen, ohne zu wissen, ob das überhaupt artenschutzrechtlich vertretbar ist, das ist keine Lösung. Die Konsequenz wäre, den aktuellen Ausbau zu stoppen. Das ist aber schwer in die Köpfe hineinzubekommen.
Hier würde ich gern auf das Thema Artengutachten zu sprechen kommen. Sie kritisieren in Ihrem Buch auch, dass viele Gutachten nicht fachlich korrekt durchgeführt würden. Welche Veränderungen müssten dementsprechend in der Landschaftsplanung erfolgen?
Das ist eine gute Frage. Es gibt ja die Idee, dass die Gutachter von der Behörde zu beauftragen seien. Das halte ich aber für unsinnig, da wird nur der Schwarze Peter weitergegeben. Die Behörde ist ja nur bestrebt, die politischen Forderungen durchzusetzen. Und viele Kollegen sagen: „Irgendwo müssen sie halt hin. Und wenn ich es nicht mache, macht’s wer anders.“ Ich selbst arbeite gar nicht mehr für die Windindustrie. Das Problem ist ja: Man muss etwas generieren. Auch wenn das artökologisch völliger Unsinn ist. Der Gutachter unterschreibt ja quasi, dass er etwas zementiert, das von der Realität so weit weg ist, wie irgendetwas nur sein kann. Die Gutachten sagen eigentlich mehr über denjenigen aus, der beobachtet, als über das Verhalten der Art im Raum.
Wen möchten Sie denn mit Ihrem Buch erreichen und welche Botschaft möchten Sie senden?
Eigentlich möchte ich alle erreichen: die Politik, die Kollegen, die breite Öffentlichkeit. Weil immer noch die Meinung vorherrscht: „Irgendwie geht das schon“. Wenn aber bei eigenen Prüfungen offengelegt wird, dass viel mehr Brutpaare, mehr Horste oder eine andere Raumnutzung existieren, dass mehr Quartiere aufgebaut sind, als von der Planerseite behauptet, dann stimmt generell etwas an der Vorgehensweise nicht. Das muss einmal bewusst werden. Es ist nicht alles machbar, es ist nicht alles vermeidbar, nicht alles minimierbar.
So besteht in eigentlich allen Vorhaben für mindestens eine Art ein erhöhtes Risiko und somit wird die Mehrheit aller Anlagen genau genommen widerrechtlich betrieben. Da würde nur eine Abschaltung der Anlagen nachts und während der Brut- und Zugphase der Vögel helfen. Das wären etwa 300 Tage im Jahr. Es ist stattdessen darüber nachzudenken, wo weltweit CO2eingespart werden kann, wo optimiert werden kann. Da steckt so ein Potenzial, so viele Windräder können wir gar nicht bauen, um das aufzuwiegen.
Herr Bernd, herzlichen Dank für das Interview!
Zum Autor: Dirk Bernd untersucht seit seinem 17. Lebensjahr die Tiergruppe der Fledermäuse. Heute ist er Inhaber des Büros für Faunistik und Landschaftsökologie in Lindenfels und Mitherausgeber von landesweiten Artenlisten und deren Verbreitungsgebieten. Durch seine Arbeit zählt der südhessische Raum heute zu den am besten untersuchten Gebieten in Hessen, in dem beispielsweise für mehrere seltene Arten die höchsten Siedlungsdichten im überregionalen Betrachtungsraum bekannt sind.
Bestellen können Sie „Windindustrie versus Artenvielfalt“ als Printexemplar für 39,90 Euro unter dem Webcode NuL4028 . Digital erhalten Sie das Buch kostenlos unter dem WebcodeNuL4262 .
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

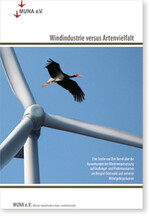

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.