Hotspots der Artendiversität in Großstädten – Fiktion oder Wirklichkeit?
Abstracts
Kleine, urbane Gewässer und ihre Niederungen sind wegen der gemeinhin postulierten geringen Biodiversität wenig untersucht. Sie werden häufig nur unter Gesichtspunkten der Gebietsentwässerung und Zwischenspeicherung von Wasser betrachtet. In der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000) fallen sie unter die Kategorie „Oberflächengewässer“ und unterliegen aufgrund ihrer geringen Einzugsgebiets- oder Flächengröße derzeit keiner Berichtspflicht. Da sie zumeist nicht Bestandteil von europäischen Schutzgebietssystemen sind, werden sie auch im Rahmen der FFH-Richtlinie nicht untersucht und gemanagt.
Innerhalb des ReWaM-Verbundprojektes „KOGGE“ konnte am Beispiel der Hansestadt Rostock gezeigt werden, dass einige der kleinen urbanen Gewässer, trotz ihrer strukturellen Einschränkungen und der multifunktionalen Nutzungsansprüche, eine artenreiche gewässerassoziierte Flora und Fauna besitzen und sehr wohl Hotspots der Artendiversität im städtischen Raum darstellen. Es wurde eine Methode entwickelt, um diese Lebensräume anhand der Anzahl standorttypischer heimischer Arten zu identifizieren. Dabei konnten zehn Hotspots im gesamten Stadtgebiet lokalisiert werden. Diese werden hinsichtlich ihrer Struktur charakterisiert und standorttypische Arten benannt. Die Erkenntnisse können perspektivisch dazu genutzt werden, um u.a. Biotopverbundachsen und Refugialräume für geschützte Arten festzulegen.
Hotspots of species diversity in large cities – fiction or reality? Localisation and description of water habitats with particularly high species diversity in the city of Rostock
Due to a presumably low biodiversity small water biotopes and adjacent lowlands in urban areas have so far been studied insufficiently. According to the Water Framework Directive (WFD 2000) they are categorised as surface waters with no reporting obligation due to their minor drainage function and small area size. Most of them are not parts of any European protection network and thus are not investigated and maintained according to the Habitat Directive.
In the context of the scientific ReWaM (regional management of water resources) project “KOGGE” small municipal water bodies in urban areas were investigated using the example of the Hanseatic City of Rostock. The results showed that some small urban water biotopes host a diverse flora and fauna and can be seen as hotspots of biodiversity despite structural limitations and multifunctional use. In the course of the project a method was developed to identify and define these habitats. In total, 10 hotspots could be identified in the municipal area. Subsequently, the structures of these sites were characterised and site-specific species were identified. The results and findings can be used to define habitat networks and refuge areas for protected species.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Trotz der Tatsache, dass Urbanisierung aufgrund indirekter und direkter Effekte als eine der Hauptursachen für die Gefährdung der globalen biologischen Vielfalt angesehen wird (McKinney2002,Oldenet al. 2006), kommt vielen städtischen Biotopen in dieser Hinsicht eine große Bedeutung zu. Das hat beispielsweiseGoulson(2017) für unterschiedliche urbane Bereiche Großbritanniens bezüglich der Wildbienen nachgewiesen. So können u.a. Feuchtareale auf stillgelegten Fabrikgeländen, Regenrückhaltebecken, Teiche und Kanäle wichtige Zufluchtsorte für viele Tier- und Pflanzenarten sein (Warwick2017). Aber auch Gärten, Parks, Friedhöfe und andere bedingt naturnah erhalten gebliebene Habitate spielen als Refugialräume und im Biotopverbund eine große Rolle. Da Städte immer weiter wachsen, wird der Mensch aufgrund der mangelnden Wahrnehmung von Natur im alltäglichen Umfeld zunehmend im Hinblick auf solche Habitate desensibilisiert (Savardet al. 2000). Es ist daher umso wichtiger, gerade bei Planungen im urbanen Raum die biologische Vielfalt zu kennen und langfristig zu erhalten (Miller & Hobbs2002).
Im Gegensatz zu aquatisch geprägten Lebensräumen der freien Landschaft ist im urbanen Raum die multifunktionale Nutzung der Gewässer meist deutlich höher. Sie fungieren nicht nur als Habitate für verschiedene Arten, sondern sind maßgeblich in das Entwässerungssystem der Stadt integriert, dienen als Speicher, haben eine klimaregulatorische Funktion und/oder stehen der Naherholung zur Verfügung. Ihre Ökosystemleistungen sind somit häufig beachtlich. Um diese Leistungen voll entfalten zu können, muss das jeweilige Gewässer gemeinschaftlich entwickelt werden.
Deshalb fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) derzeit mehrere Verbundprojekte im Forschungsschwerpunkt „Regionales Wasserressourcen-Management für den nachhaltigen Gewässerschutz in Deutschland“ (ReWaM). Das Projekt „KOGGE“ ist in der Hansestadt Rostock angesiedelt und steht unter dem Leitgedanken „Kommunale Gewässer im urbanen Raum gemeinschaftlich entwickeln“. In diesem Projekt arbeiten die Universität Rostock, das Institut biota in Bützow, Eurawasser und der Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow und Küste“ mit verschiedenen Einrichtungen der Stadt Rostock zusammen und verfolgen das Ziel der Erarbeitung eines multifunktionalen und strategisch ausgerichteten Gewässerentwicklungskonzeptes für kleine, urbane Gewässer. Auf einem zielgerichteten Geodatenmanagement, einer Systemanalyse und einem biologischen Bewertungsverfahren fußend, erfolgt eine Korrelation zwischen den Auswirkungen von hydraulischen und stofflichen Belastungen (BfG 2015). Die Auswirkungen auf den ökologischen Zustand werden ebenso beleuchtet wie Ökosystemleistungen, Erholungswirkungen und naturschutzfachliche Aspekte. Letztlich ist geplant, einen GIS-gestützten Gewässerentwicklungsplan zu erzeugen, der als Entscheidungsgrundlage und hilfe für Vorhaben der Hansestadt Rostock (insbesondere die ökologische Entwicklung von urbanen Gewässersystemen) dienen kann.
Im Rahmen dieses Projektes wurde bereits eine Methode zur ökologischen Bewertung von Gewässern erarbeitet (Gewässerurbanitätsindex, GUI) und angewandt (Thieleet al. 2016, 2017). Basierend darauf soll eine naturschutzfachliche Analyse zu möglichen Hotspots der Artendiversität erfolgen und in das Entscheidungssystem von „KOGGE“ einfließen. Bei der Betrachtung darf der Fokus nicht nur auf Konzentrationsbereichen von geschützten und gefährdeten Arten liegen, sondern muss auch besonders artenreiche Gewässerlebensräume mit standorttypischen Strukturen und gewässertypischer Artenausstattung kennzeichnen.
Die Zusammenhänge zwischen biologischer Vielfalt und multifunktional genutzten kleinen Gewässern im städtischen Raum sind trotz zahlreicher Studien nicht vollends geklärt (Chace & Walsh2006,Wengeret al. 2009) und gerade der Kenntnisstand zur Biodiversität niederer Organismen im urbanen Raum ist sehr gering (Savardet al. 2000). Systematische Ergänzungen sind dringend notwendig, um ein Verständnis für diese Gefüge zu entwickeln (Kinziget al. 2005,Shochatet al. 2006). Nachfolgend sollen sowohl die Methoden als auch die Ergebnisse der Ermittlung von Hotspots an kleinen urbanen Gewässern dargestellt werden. Einige dieser Hotspots werden zudem bezüglich ihrer Strukturen und der standorttypischen Artenvielfalt näher charakterisiert.
2 Untersuchungsraum und Methoden
2.1 Untersuchungsraum
Die Hansestadt Rostock ist mit mehr als 200 000 Einwohnern die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Sie liegt beidseitig der Unteren Warnow, welche bei Warnemünde in die Ostsee mündet. Im Stadtbereich existieren ca. 200 kleinere Fließgewässer (Bäche und Gräben) mit einer Gesamtlänge von 217 km. Hinzu kommen 138 kleinere Standgewässer unterschiedlicher Ausprägung und zahlreiche Feuchtgebiete. Die Stand- und Fließgewässer sind auf verschiedene Art und Weise sowie mit wechselnder Intensität in das Entwässerungssystem der Stadt eingebunden. Vielerorts befinden sich Begradigungen, technische Uferbefestigungen, künstliche Querprofile, Verrohrungen und Durchgängigkeitshindernisse. Stark veränderte oder künstliche Fließgewässer sowie Verrohrungen sind in fast allen Bereichen des Fließgewässersystems anzutreffen. Standorttypisch ausgeprägte Niederungen stellen daher die Ausnahme dar. Niederschlags- und Mischwassereinleitungen führen an vielen Stellen zu hydraulischem Stress und stofflichen Emissionen. Die Bewirtschaftung orientiert sich derzeit vorwiegend an der Sicherstellung der hydraulischen Kapazität und kaum an ökologischen und naturschutzfachlichen Gesichtspunkten.
2.2 Definition von Hotspots und Zielstellung für den urbanen Raum
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat im Wissen um den Rückgang der biologischen Vielfalt (Nationale Strategie gemäß BMU 2007) deutschlandweit 30 „Hotspots der biologischen Vielfalt“ definiert. Der Hotspot 29 „Vorpommersche Boddenlandschaft und Rostocker Heide“ reicht bis in das Stadtgebiet von Rostock hinein. In diesem wurden bereits Biodiversitätsschwerpunkte lokalisiert (biota 2016). Das BfN (2012) definiert Hotspots als „größere räumliche Bereiche…, in denen sich eine für Deutschland bzw. für die jeweilige Großlandschaft typische und in besonderem Maße erhaltenswerte biologische Vielfalt und/oder entsprechende Aufwertungspotenziale finden“. Diese Definition muss auf den urbanen Raum angepasst werden, da in diesem die Lebensräume in ihrer Ausdehnung oftmals stärker eingegrenzt und nicht als Großlandschaft zu bezeichnen sind.
Um Hotspots der Biodiversität abzugrenzen, gibt es auf Bundesebene verschiedene Möglichkeiten. Oft werden geostatistische Methoden zur räumlichen Ermittlung genutzt. Dabei bewertet man zunächst die einzelnen Raster auf Basis eines definierten Algorithmus und dann werden sie unter Verwendung weiterer flächenscharfer Daten räumlich abgegrenzt (BfN 2012). Partiell kommt auch die Fernerkundung zum Einsatz (Förster & Frick2008). Vielfach liegt die besondere Aufmerksamkeit auf geschützten und gefährdeten Arten (Pröbstl2010). Das vorgestellte Verfahren soll neben diesen Taxa alle Arten der standorttypischen Biozönosen bei den betrachteten Artengruppen berücksichtigen.
2.3 Lokalisierung und Kategorisierung der indikativ genutzten standorttypischen Arten
Für die Eruierung der Hotspots wurden synergistisch die Erfassungsergebnisse zum ökologischen Bewertungsverfahren des Gewässerurbanitätsindexes (GUI) genutzt. Repräsentative und standorttypische Artengruppen des Gewässer-/Umlandlebensraumes sollten die Artenvielfalt kompartimentweise widerspiegeln (vgl. Abb. 1). Dazu wurden die Lepidoptera, Makrophyten und das Makrozoobenthos ausgewählt, da bei diesen Gruppen gute Vorkenntnisse zu den autökologischen Anspruchskomplexen vorliegen und die Artenvielfalt hinreichend groß ist. Die Erfassungsmethoden zu den einzelnen Taxa sind inThieleet al. (2016, 2017) erläutert.
Ein für die Identifizierung von standorttypischen, biodiversen Gewässerlebensräumen essenzieller Schritt ist die ökologische Kategorisierung. Es gilt zu klären, wie hoch der Anteil gewässer- bzw. niederungstypischer Taxa an der Biozönose des jeweiligen Untersuchungsabschnittes ist. Dazu wurden die nachgewiesenen Arten hinsichtlich ihrer
- ökologischen Amplitude gegenüber wesentlichen Parametern ihres Lebensraumes (Strömung, physikalisch-chemische Werte, Feuchteangepasstheit) und ihrer
- Seltenheit (Gefährdung und Schutz) in eine ökologische Kategorie von 1 bis 4 eingeteilt (vgl. Tab. 1).
Für die Objektivierung der Einstufungen wurden zudem die Verbreitungsatlanten „Lepidoptera“ (Thieleet al. in Bearbeitung) sowie Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (Berlin&Thiele2012) herangezogen. Weitere Daten sind von der Unteren Naturschutzbehörde der Hansestadt Rostock bereitgestellt worden.
2.4 Methode zur Abgrenzung von Hotspots an urbanen Gewässern
Standorttypisch artenreiche Gewässerlebensräume im urbanen Raum stehen zumeist mit Feuchtlebensräumen in Verbindung, die einen hohen Anteil an naturnahen Milieuverhältnissen (u.a. hydraulisch, physiko-chemisch und strukturell) aufweisen. In diesen findet man gemeinhin auch die höchste Anzahl an gefährdeten und geschützten Arten. Da aber Fließgewässer in der Stadt multifunktionalen Nutzungen unterliegen, können sie immer nur einer begrenzten Anzahl standorttypischer Arten einen Lebensraum bieten.
Um zu entscheiden, wann unter den Bedingungen der Hansestadt Rostock ein Hotspot der Artendiversität gegeben ist, wurden zuerst die erfassten Arten in die ökologischen Kategorien (vgl. Tab. 1) eingeordnet. Dann ist das Verhältnis von ubiquitären zu stenotopen Arten (Kategorien 1 & 2 zu 3 & 4) prozentual für jede Probestelle und Zeigergruppe ausgewiesen worden. Um eine Repräsentanz der Artendiversität für die drei Fließgewässerkompartimente zu ermöglichen, wurde ein Durchschnittswert errechnet. Danach sind diese Werte auf Basis der Einschätzung zum Grad an Gewässerfunktionalität (Gewässerurbanitätsindex) geordnet worden. Der Umschlagpunkt zwischen guter und mäßiger Funktionalität lag in den Gewässern der Hansestadt Rostock bei einem Anteil von ca. 25 % an Taxa der Kategorien 3 und 4. Das entspricht auch den Erfahrungen bei leicht bis mäßig degradierten Fließgewässern in der freien Landschaft (vgl.Thieleet al. 1995) und erscheint für „gut ausgestattete“ städtische Gewässer plausibel. Bezogen auf diese urbanen Gewässer heißt das, wenn mehr als 25 % strenger angepasste Arten in der Biozönose einer Probestelle nachweisbar sind, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem standorttypisch biodiversen Gewässer sprechen.
Dieses Verhältnis kann sich überregional ändern, lässt sich aber ortskonkret leicht bestimmen.
3 Charakterisierung naturnaher Feuchtgebiete als Hotspots der Artendiversität in der Stadt Rostock
3.1 Identifizierung der Hotspots
Die im Abschnitt 2 beschriebene Methode zur Lokalisierung der Hotspots wurde in den Jahren 2016 und 2017 angewandt. In den untersuchten Gewässer- und Niederungsbereichen der Stadt sind insgesamt 724 Arten aus den drei indikativ genutzten Gruppen nachgewiesen worden, 257 gehören den Kategorien 3 bzw. 4 an. An 24 Stationen liegen Ergebnisse von allen drei Artengruppen vor. Davon konnten zehn Bereiche bisher als Hotspots der Artendiversität an den kleinen Gewässern der Hansestadt Rostock identifiziert werden (Abb. 3). Der Anteil an Arten der Kategorien 3 und 4 liegt bei ihnen zumeist deutlich über dem angegebenen Mittelwert (Abb. 2). Die Stationen befinden sich nahezu ausschließlich im hochurbanen Bereich und außerhalb der stadtinternen Schutzgebiete. Lediglich ein Hotspot (HS 2) überlagert sich teilweise mit dem Geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) „Wiesenrest am Kringelgraben“.
Bei den zehn identifizierten Hotspots gibt es sowohl hinsichtlich ihrer räumlichen Lage in der Hansestadt als auch in Bezug auf ihre strukturellen Eigenschaften und Ausprägungen Unterschiede. Sie sollen nachfolgend nach ihren landschaftlichen Charakteristika exemplarisch beschrieben werden.
3.2 Gewässer im Verbund mit alten, dauerhaften Gehölzstrukturen
Im städtischen Bereich finden sich in Form von Stadtparks und Friedhöfen oftmals alte Baumbestände, die dauerhafte Habitate mit zahlreichen Ökotonen und standorttypischen Biozönosen generieren. Gewässer, die durch oder entlang dieser Bereiche fließen, sind in den Stoffkreislauf der parkartigen Anlagen eingebunden und zeichnen sich durch einen hohen Anteil ufernaher, schattenspendender und einheimischer Gehölzstrukturen aus. Diese dienen häufig dem guten ökologischen „Funktionieren“ der Feuchtlebensräume. Sowohl hygrophile Lepidopteren der Wälder und Uferlebensräume als auch detritusfressende Makrozoobenther kommen hier in großen Zahlen vor. Im südlichen Teil der Hansestadt Rostock trifft das besonders auf einen Gewässerabschnitt des Kringelgrabens zu, der sich direkt neben einem Friedhof befindet (HS 5). Zudem durchfließt ein Abschnitt des Rönngrabens den „Schweizer Wald“ (HS 1, Abb. 4), im Barnstorfer Wald weist die Niederung des Hechtgrabens Röhrichte und Bruchgehölze auf (HS 3) und die Jägerbäk hat zahlreiche Gehölzstrukturen an ihren Ufern (HS 7).
All diese Gewässerabschnitte bilden Hotspots der Artendiversität. Wichtige standorttypische Vertreter dieses Lebensraums sind u.a. der Schönbär ( Callimorpha dominula , RL-MV 3), zahlreiche Schwärmerarten ( Sphingidae ), der Adlerfarn-Wurzelbohrer ( Hepialus fusconebulosus , RL-D V, RL-MV 3), die Scharfe Tellerschnecke ( Anisus vortex , RL-D V) sowie die Bachbunge ( Veronica beccabunga ), die Kleinblättrige Brunnenkresse ( Nasturtium microphyllum ) und der Sumpf-Schachtelhalm ( Equisetum palustre ).
3.3 Gewässer im Verbund mit Feuchtwiesen und Senken
Wenn im urbanen Raum um ein Kleingewässer Versumpfungen oder Vermoorungen auftreten, entsteht ein Bereich, der kaum zu bewirtschaften ist. Hohe Grundwasserstände und/oder eine eingeschränkte Vorflut sind zumeist Voraussetzung dafür. Auf diesen Flächen bilden sich vielfach kleinflächig Feuchtwiesen aus, die partiell von Bruchgehölzen gesäumt oder durchsetzt sind. Dieser Raum fungiert oft als Refugium für viele feuchtgebietstypische Arten, die in anderen Bereichen durch hydraulischen Stress oder Austrocknung verloren gegangen sind.
Solche Hotspots der Artendiversität befinden sich beispielsweise im Zulaufsystem des Kringelgrabens (HS 6 und HS 2, Abb. 5). Der Bullengraben (HS 2) ist außerdem Bestandteil des GLB „Wiesenrest am Kringelgraben“, der als letzter Rest einer natürlichen Feuchtwiesenvegetation einen unverzichtbaren Bestandteil eines Grünzuges für die Südstadt darstellt (UNB Rostock, Nr. GLB-R 12).
An diesen Hotspots wurden u.a. die Wiesen-Segge ( Carex nigra , RL-MV 3), das Schmalblättrige Wollgras ( Eriophorum angustifolium , RL-MV 3), die Gelbe Teichrose ( Nuphar lutea , b.g. = besonders geschützt), die Teichnapfschnecke ( Acroloxus lacustris , RL-D V), die Köcherfliege Holocentropus stagnalis (RL-D 3, RL-MV 3) sowie Heidelibellen ( Sympetrum sp.), Mosaikjungfern ( Aeshna sp.) und Azurjungfern ( Coenagrion spec.) nachgewiesen. Außerdem zählen die Graseulen der Gattung Mythimna , die Janthe-Bandeule ( Triphaena janthina ) und Schilfeulen der Gattungen Phragmitiphila und Arenostola zu den typischen Arten.
3.4 Gewässer im Verbund mit durchflossenen und/oder angeschlossenen Standgewässern
In der jungglazialen Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns haben nacheiszeitlich abgetaute Toteisblöcke Hohlformen hinterlassen, die sich holozän vielfach mit Wasser füllten und heute im urbanen Bereich häufig in das Entwässerungssystem der Städte eingebunden sind. Zudem hat der Mensch Regenrückhalte- und Speicherbecken geschaffen, die an Fließgewässer angeschlossen sind oder von diesen durchflossen werden. Je nach Größe, Grad an Natürlichkeit und Wasserstandsschwankungen haben sich artenreiche Refugien für zahlreiche stenotope Feuchtarten entwickeln können, die naturnahe Strukturen aufweisen. Sie wirken vielfach als Donor für die Wiederbesiedlung der zumeist weniger naturnahen Gewässer. Solche Bereiche finden sich am Klostergraben (HS 9 und HS 10, Abb. 6).
Standorttypische Arten sind die Schilfrohr-Wurzeleule ( Rhizedra lutosa ), Pappel- und Weinschwärmer ( Amorpha populi, Pergesa elpenor und P. porcellus ), Ufer-Segge ( Carex riparia ), Sumpf-Labkraut ( Galium palustre ), Echtes Mädesüß ( Filipendula ulmaria ), der Schlamm-Schlundegel ( Erpobdella testacea ) und die Weitmündige Schlammschnecke ( Radix ampla , RL-D 1).
3.5 Gewässer im Verbund mit Grünflächen für die Naherholung und/oder Bildung
Viele Naherholungsgebiete und öffentliche Grünflächen nutzen Gewässer als maßgebliche Struktur- und Gestaltungselemente. Da ein natürlich anmutendes Gewässer gemeinhin als ästhetisch ansprechender empfunden wird, kann auch die Flora und Fauna von diesen Gegebenheiten profitieren. In der Hansestadt Rostock stellt der Botanische Garten ein solches Beispiel dar. Der Kayenmühlengraben (HS 4) ist hier in einer weitestgehend naturnahen Form erhalten geblieben (Abb. 7). Er entspringt aus einem Quelltopf in einer Orchideenwiese und durchfließt ein kleines Wäldchen sowie mehrere Standgewässer (HS 8). Somit stehen den Arten verschiedene Habitate auf relativ kleinem Raum zur Verfügung. Dies begünstigt die Biodiversität in besonders hohem Maße.
Zu den standorttypischen Arten zählen hier der Hauhechel-Bläuling ( Lycaena icarus , b.g.), der Mittlere Weinschwärmer ( Pergesa elpenor ), Breitblättriges Knabenkraut ( Dactylorhiza majalis , RL-D 3, RL-MV 2), Sumpf-Pippau ( Crepis paludosa , RL-MV V), Sumpf-Wolfsmilch ( Euphorbia palustris , b.g., RL-D 3, RL-MV 3), die Köcherfliege Beraea maura (RL-MV 1), die Bauchige Schnauzenschnecke ( Bithynia leachii leachii , RL-D 2) und die Gebänderte Prachtlibelle ( Calopteryx splendens , b.g., RL-D V).
4 Ausblick
Die Ergebnisse für den ersten Analysezeitraum zeigen, dass in der Hansestadt Rostock bereits zehn Hot-Spots der Artendiversität mittels der vorgestellten Methode identifiziert werden konnten. Die multifunktional genutzten kleinen Gewässer können, sofern ihnen Raum oder Struktur gegeben wird, wertvolle Lebensräume für eine standorttypische Flora und Fauna auch in Großstädten darstellen. Zukünftig wären Fragen zu klären, wie und ob deren langfristiger Erhalt gesichert werden kann und ob Verbindungen zwischen den einzelnen Gewässerstrukturen bestehen bzw. hergestellt werden könnten. Die aufgeführten Ergebnisse fließen in ein strategisch ausgerichtetes Entscheidungskonzept für die Gewässerentwicklung in der Hansestadt Rostock ein und bilden eine wesentliche, naturschutzfachlich ausgerichtete Ebene. Damit können u.a. städtebauliche Entscheidungen gezielter getroffen werden.
Dank
Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Kennzeichen 033W032B gefördert. Im Zusammenhang mit der Datenrecherche sei dem Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege der Hansestadt Rostock, insbesondere Herrn Uwe Göllnitz, herzlich für die Bereitstellung von Funddaten geschützter Tier-und Pflanzenarten gedankt.
Literatur
BfG (2015): ReWaM – Regionales Wasserressourcen-Management für den nachhaltigen Gewässerschutz in Deutschland. DOI: 10.5675/ReWaM_2015.
BfN (2012): Identifizierung der Hotspots der Biologischen Vielfalt in Deutschland. BfN-Skripte 315.
Berlin, A., Thiele, V.(2012): Ephemeroptera, Plecoptera und Trichoptera (EPT) Mecklenburg-Vorpommerns. Verbreitung, Gefährdung, Bioindikation. LUNG M-V, Deutsche Bibliothek, Friedland, 1. Auflage.
biota (2016): Schatz an der Küste – nachhaltige Entwicklung zum Schutze der biologischen Vielfalt in der Region Vorpommersche Boddenlandschaft und Rostocker Heide – Erstellung relevanter Inhalte eines naturschutzfachlichen Konzeptes im Hotspot 29. Bützow, unveröff. Mskr.
Chace, J.F., Walsh, J.J.(2006): Urban effects on native avifauna: a review. Landscape and Urban Planning 74, 46-69.
Förster, M., Frick, A.(2008): Methoden der Fernerkundung für ein flächendeckendes Biodiversitätsmonitoring. Vortrag zum Themenschwerpunkt „Naturschutz-Monitoring in Deutschland“, Statusseminar auf Vilm 14.4.-18.4.2008.
Goulson, D.(2017): Die seltensten Bienen der Welt. Carl Hanser, München, 302 S.
Kinzig, A.P., Warren, P., Martin, C., Hope, D., Katti, M.(2006): The effects of Human Socioeconomic Status and Cultural Characteristics on Urban Patterns of Biodiversity. Ecology and Society 10, art. 23.
McKinney, M.L. (2002): Urbanization, biodiversity, and conservation. Bio Science 52, 883-890.
Miller, J.R., Hobbs, R.J.(2002): Conservation where people live and work. Conservation Biology 16, 330-337.
Olden, J.D., Poff, N.L., McKinney, M.L.(2006): Forecasting faunal and floral homogenization associated with human population geography in North America. Biol. Conserv. 127, 261-271.
Pröbstl, U.(2010): Definition und Abgrenzung des Biodiversitätsschadens. Universität für Bodenkunde Wien, Fachtagung Biodiversitätsschäden in der Umwelthaftungsrichtlinie (www.skiaudit.info/media/files/landschaftsbildtagung/Biodiversitaetsschaeden.pdf).
Savard, J.-P., Clergeau, P., Mennechez, G. (2000): Biodiversity concepts and urban ecosystems. Landscape and Urban planning 48, 131-142.
Shochat, E., Warren, P.S., Faeth, S H., McIntyre, N.E., Hope, D.(2006): From patterns to emerging processes in mechanistic urban ecology. Trends in Ecology and Evolution 21, 186-191.
Thiele, V., Blumrich, B., Eisenbarth, S., Lipinski, A., Berlin, A., Schuhmacher, S., Deutschmann, U., Tabbert, H.(2018): Verbreitungsatlas der Makrolepidopteren Mecklenburg-Vorpommerns. Teil: Bombyces et Sphingides. Steffen, Berlin (in Bearb.).
–, Eisenbarth, S., Kasper, D., Lipinski, A. (2016): Erarbeitung eines bioindikativen Verfahrens zur ökologischen Bewertung urbaner Fließgewässer am Beispiel der Hansestadt Rostock – der Gewässerurbanitätsindex (GUI) wird entwickelt. 10. Rostocker Abwassertagung 2016, Tagungsband, 23-42.
–, Eisenbarth, S., Kasper, D., Renner, M., Tralau, C.(2017): Ökologische und naturschutzfachliche Bewertung von kleinen, urbanen Gewässern in der Hansestadt Rostock innerhalb des REWAM-Verbundprojektes „KOGGE“. WasserWirtschaft 7/8, 39-44.
–, Mehl, D., Berlin, A(1995): Ansätze für ein Bewertungsverfahren für die Fließgewässer und Niederungen im Einzugsgebiet der Warnow unter besonderer Berücksichtigung der Entomofauna. Arch. Hydrobiol. (Suppl.) 101 (Large Rivers 9), 599-614.
Warwick, H. (2017): Water vole heaven. How the UK’s industrial canals became secret wildlife corridors. BBC-Wildlife-Magazine 35 (7), 20-25.
Wenger, S.J., Roy, A.H., Jackson, C.R., Bernhardt, E.S., Carter, T.L., Filoso, S., Gibson, C.A., Hession, W.C., Kaushal, S.S., Martì, E., Meyer, J.L., Palmer, M.A., Paul, M., Purcell, A.H., Ramírez, A., Rosemond, A.D., Schofield, K.A., Sudduth, E.B., Walsh, C.J.(2009): Twenty-six research questions in urban stream ecology: an assessment of the state of science. Journal of North American Benthological Society 28, 1080-1098.
Fazit für die Praxis
- Dem Zustand und der Entwicklung von kleinen Gewässern im urbanen Raum wird derzeit zu wenig naturschutzfachliches Interesse entgegengebracht, weil sie vornehmlich in ihrer entwässernden oder speichernden Funktion gesehen werden.
- Neben einem Bewertungsverfahren wurde im Rahmen eines BMBF-Vorhabens auch eine Methode zur Abgrenzung von Hotspots der Artendiversität erarbeitet.
- Dieses Verfahren nutzt im Sinne von „Schirmarten“ indikativ drei Artengruppen und lässt die Bestimmung von Hotspots nach einem für naturnahe Gewässer definierten Anteil standorttypischer und heimischer Arten zu.
- Diese Hotspots werden in ein Geographisches Informationssystem eingespeist und bilden eine Bewertungsebene.
- Bei Bauvorhaben in der Stadt lassen sich damit Biodiversitätsschwerpunkte berücksichtigen.
- Außerdem bilden diese Informationen die Basis für eine multifunktionale Entwicklung von Gewässer, insbesondere für den Erhalt von Rückzugsräumen und einem Biotopverbund.
Kontakt
Dr. Volker Thiele ist Geschäftsführer des Institutes biota in Bützow und arbeitet vornehmlich im Bereich des Gewässer- und Moorschutzes. Hauptsächliche Forschungsgebiete sind Bioindikation, Entwicklung ökologischer Bewertungsverfahren, Biotop- und Artenschutz und Untersuchungen zu Klimafolgen. Er ist Spezialist für die Gruppe der Lepidopteren und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Bücher. Von der IHK Rostock wurde er öffentlich als Sachverständiger für Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gewässerschutz bestellt und vereidigt.
> volker.thiele@institut-biota.de
> simone.eisenbarth@institut-biota.de
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


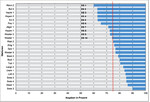





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.