Ein Plädoyer für aktives Habitatmanagement
Das Buch „Artenschutz durch Habitatmanagement" ist ein leidenschaftliches Plädoyer für den Artenschutz und für ein Offenhalten unserer mitteleuropäischen Landschaft durch gezielte Maßnahmen. Anhand zahlreicher gut belegter Beispiele zeigt der Biologe Prof. Werner Kunz auf, dass sich in unseren Breiten vor allem dort eine hohe Artenvielfalt einstellt, wo der Mensch gestaltend eingreift. Dies gilt zumindest für die Tiergruppen Vögel und Tagfalter, auf die sich der Autor hauptsächlich bezieht.
- Veröffentlicht am
Eine Bewaldung bzw. Aufforstung führt bei diesen Gruppen fast immer zu einem Rückgang der Artenzahlen bzw. einem Rückgang der stark gefährdeten Arten. Das kann man in vielen Sandgruben, im Tagebau, aber auch auf den großen Truppenübungsplätzen nach Aufgabe der Nutzung beobachten.
Naturschutz ist keine exakte Wissenschaft und vielfach durch Ideologien und Moden geprägt. So sind die Ziele des Naturschutzes oft unklar und auch nicht durch Fakten belegt. Vielen ist der Unterschied zwischen Natur-, Umwelt- und Tierschutz unklar. Vielerorts gibt es Zielkonflikte zwischen Prozessschutz und dem gestaltenden Naturschutz bzw. zwischen Lebensraum- und Artenschutz.
In acht sehr lesenswerten und informativen Kapiteln, die jeweils mit einem Literaturverzeichnis versehen sind, befasst sich der Autor u.a. mit den Themen „seltene Arten", Abgrenzung von Umwelt-, Natur- und Tierschutz, Landschaftsgeschichte Mitteleuropas, Rote Listen, Bestandsveränderungen und deren Ursachen, dem Mythos Wald und dem weltweiten Artensterben.
Kunz macht deutlich, dass sich die meisten seltenen Arten inzwischen auf Truppenübungsplätzen, im Braunkohletagebau, auf Flughäfen, in Sand- und Kiesgruben undnicht im Wald bzw. in stark verbuschten Flächen finden. Trotz Klimaerwärmung gehen die wärmeliebenden Tagfalter weiter zurück, weil es aufgrund des Stickstoffeintrags und der Sukzession vieler Flächen am Boden kälter und feuchter wird. Wiesenbrüter- und Randstreifenprogramme konnten den Rückgang vieler Offenlandarten nicht verhindern, da die Nutzung in den meisten Grünlandflächen zu intensiv und die Vegetationsbedeckung zu dicht ist.
Der Autor plädiert dafür, die verbliebenen „Restflächen" zwischen Wald und landwirtschaftlichen Nutzflächen intensiv zu pflegen und zu gestalten, um so den Rückgang vieler Arten aufzuhalten. Er kann überzeugend aufzeigen, dass eine natürliche Entwicklung in Richtung Wald nicht gleichzeitig zu einer Förderung seltener Arten führt. Das Offenhalten nährstoffarmer Standorte führt hingegen immer zur Ansiedlung bzw. Bestandserhöhung vieler gefährdeter Arten. Er macht deutlich, dass im Vergleich zu den Regenwäldern unsere Waldgebiete aufgrund ihrer Lage, aber vor allem auch aufgrund ihres jungen Alters vergleichsweise artenarm sind.
Auch wenn man nicht immer die Meinung des Autors teilen möchte – so sind Wälder für Pilze, Schnecken und Käfer sicher auch sehr artenreiche Lebensräume –, so ist dieses Buch unbedingt lesenswert und bietet allen an Naturschutz interessierten Verbandsvertretern, Naturschutzbehörden, Planungsbüros und vor allem Studenten viele hilfreichen Informationen und Denkanstöße. Es regt dazu an, viele Naturschutzaktivitäten kritisch zu hinterfragen.
Von Werner Kunz.
292 Seiten mit acht Farbtafeln. Hardcover.
Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2017. 59,90 €.
Print ISBN 978-3-527-34240-2
(auch in anderen Formaten erhältlich).
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

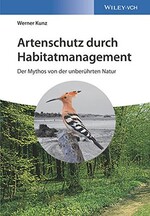
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.