Teilzeiturwald oder Ewigkeitsprojekte?
Abstracts
Der Beitrag schildert anhand einer Literaturanalyse die Vorteile großer, zusammenhängender, natürlicher Wälder gegenüber vielen kleinen für Zielsetzungen des Naturschutzes, insbesondere des Erhalts der Biodiversität.
Aufgrund einer größeren Anzahl sehr alter Bäume, vielfältigerer Strukturen und einer Habitatkontinuität sind natürliche Wälder reicher an bedrohten Arten als Wirtschaftswälder. Natürliche Wälder müssen dafür auch ertragreiche Standorte einschließen.
Part-time primeval forests or projects for eternity? Development of natural forests in Hesse (II) – importance of large area for species diversity
The study illustrates the advantages of large, coherent natural forests compared to a high number of small areas. Due to a large number of very old trees, a higher structural variety and a continuity of habitats they show a significantly increased diversity of endangered species compared to cultivated forests. They have to be large enough and have also to include productive sites.
- Veröffentlicht am
1 Einleitung
In einer dreiteiligen Serie wird am Beispiel des Bundeslands Hessen beleuchtet, wie der aktuelle Stand natürlicher Waldentwicklung ist und welche fachlichen Kriterien zur Flächenauswahl anzulegen sind (Harthun2017).In dieser Folge wird dargestellt, welche Vorteile große Gebiete gegenüber vielen kleinen haben. Eine dritte Folge greift Argumente der Kritiker auf (Harthunim Druck).
Entscheidend für die Entwicklung natürlicher Wälder ist, dass die wichtigsten natürlichen Prozesse weitgehend ohne anthropogene Überprägung ablaufen (Meyeret al.2011).Nach verschiedenen Studien in mitteleuropäischen Naturwäldern können Waldschutzgebiete erst ab einer Größe von mehr als 10 bis 40 ha die raumzeitliche Dynamik der Waldentwicklungsphasen vollständig abbilden (Engelet al. 2016). Dies setzt aber eine permanente Ausgewogenheit der Anteile der Waldentwicklungsphasen voraus. Im Bergmischwald im Inneren Bayerischen Wald waren nachMüller (2015)zwei 10 ha und 40 ha große Reservate zu klein, um die notwendigen Strukturen in Raum und Zeit für alle Arten dieses Lebensraumtyps vorzuhalten.
2 Mehr Artenvielfalt durch natürliche Wälder
Naturwälder werden oft mit dem Argument in Frage gestellt, dass die bewirtschafteten Wälder für die Arten ausreichen (vgl. Kielwassertheorie,Rupf1960). NachSchulzeet al. (2016) wachsen seltene und gefährdete Pflanzen „im Laubwald überall". Bei ihrer vergleichenden Untersuchung von unbewirtschafteten Wäldern mit Wirtschaftswäldern wurden aber nicht nur alle Sonderstandorte (z.B. Hanglagen, Gewässerränder, Quellen, Felsen) ausgeschlossen, sondern die Inventurpunkte lagen auch ganz überwiegend (89 %) im Wirtschaftswald und nur zu 11 % im Naturwald.
Im Wirtschaftswald werden Buchen ( Fagus sylvatica ) bereits zur Hälfte ihres Lebensalters gefällt, das etwa 250 Jahre beträgt (im Wildnisgebiet Dürrenstein (Österreich) sogar 500 Jahre). Die zweite Lebenshälfte mit den dann hinzukommenden Tier- und Pflanzenarten fehlt (Abb. 1, 3). Der Anteil der Bäume mittleren Alters (> 160-jährig) in Deutschland macht lautBWI³ nur 3,2 % des Waldes aus (Hennenberget al. 2015). In Hessen gibt es im Staatswald nur 44 264 ha Wälder über 140 Jahre (= 13 % der Staatswaldfläche, darin sind die nutzungsfreien Wälder der Schutzgebiete bereits enthalten).
Erst in höherem Alter der Bäume treten häufiger erkrankte Stellen auf, an denen vom Grauspecht ( Picus canus ) oder Mittelspecht ( Leiopicus medius ) Höhlen angelegt werden (vgl. Nationalpark Kellerwald-Edersee 2015). Das heutige Vorkommen des Mittelspechts vor allem in Eichenwäldern ist ein „durch forstwirtschaftliche Nutzung erzeugter Artefakt" (Fladeet al. 2007). Eigentlich ist er ein klassischer Buchenwaldbewohner, kann diesen aber erst ab einem Alter von 180 bis 200 Jahren besiedeln, weil Buchen erst dann eine grobrissige Borke bekommen, die er zur Nahrungssuche benötigt.Fladeet al. (2004) berichten von sehr viel höheren Siedlungsdichten von Höhlenbewohnern wie Spechten, Baumläufern und Kleiber ( Sitta europaea ) in langjährig ungenutzten Beständen. Auch nachKlaus (2010)gehören Zwergschnäpper ( Ficedula parva ), Trauerschnäpper ( Ficedula hypoleuca ), Hohltaube ( Columba oenas ) und viele andere Waldvögel zu den Gewinnern.
Der Benefit älterer Wälder lässt sich im Nationalpark Kellerwald-Edersee bereits erkennen: Allein 346 verschiedene Moos- und 320 Flechtenarten konnten hier nachgewiesen werden. Je älter der Waldbestand, desto höher die Besiedlungswahrscheinlichkeit mit epiphytischen Moosen, die ihren Wasserbedarf aus Luftfeuchtigkeit und Regen decken, wie dem Grünen Besenmoos ( Dicranum viride ). Vom häufiger werdenden morschen Holz profitiert hier das Grüne Koboldmoos ( Buxbaumia viridis ) (G. Waesch, mdl. 29.09.2016). Bei Käferuntersuchungen wurden 13 Urwaldreliktarten nachgewiesen, wie Panzers Wespenbock ( Necydalis ulmi ), Fontainebleau-Schnellkäfer ( Ampedus brunnicornis ) und Feuerschmied ( Elater ferrugineus ) (Nationalpark Kellerwald-Edersee 2015). Der überwiegende Anteil sind Mulm-Bewohner, eine Struktur, die sich nur in sehr alten Bäumen bildet (U.Schaffrath, mdl. 28.09.2016). Bis zu 250 Käferarten können in einem Mulmkörper vorkommen (S. Winter,mdl. 28.09.2016).
Natürliche Wälder lassen vor allem dann mehr Arten erwarten, wenn sie groß genug sind. So nehmen die Häufigkeit und Artenzahl von Fledermäusen mit Baumhöhlendichte, Strukturvielfalt, hoher Arthropodendichte und stabilem Mikroklima zu (Dietz2010). Während es im Wirtschaftswald nur etwa 50 Habitatstrukturen pro Hektar gibt, finden sich in unbewirtschafteten Wäldern 250 bis 300 (S. Winter,mdl. 28.09.2016; Abb. 2). NachPailletet al. (2009) wurde in einer europäischen Studie von 120 Vergleichen genutzter und ungenutzter Wälder nachgewiesen, dass bei den Artengruppen Pilze, Moose, Flechten, Vögel, Laufkäfer und holzbewohnende Käfer die Artenzahl in ungenutzten Wäldern höher war (vgl. auchBalcar2013; S. Winter,mdl. 28.09.2016).
Im Naturwaldreservat Kinzigaue konnten zwölf Fledermausarten nachgewiesen werden, im Nationalpark Kellerwald-Edersee sogar 18. Fledermäuse haben aufgrund ihrer Langlebigkeit (20 Jahre und mehr) Traditions-Bindungen an Lebensräume. Deren rasche Veränderung durch Holzernte im Wirtschaftswald kann zum Auflösen von Fledermauskolonien führen. Hingegen vollzieht sich in natürlichen Wäldern die Veränderung so langsam, dass sich die Raumnutzung der Fledermäuse verschieben kann (Dietz2010).Die Auswertung von Fossilienfunden zeigt, dass die Bechsteinfledermaus ( Myotis bechsteinii ) früher die häufigste in Höhlen überwinternde Fledermausart war. Heute gibt es in Hessen nur noch eine Kolonie pro 5 000 bis 8 000 ha Waldfläche (vgl.Dietzmdl. 2016).Auch die außerordentlich seltene Nymphenfledermaus ( Myotis alcathoe ) benötigt feuchte, strukturreiche und über 160 Jahre alte Laubwälder. Entscheidender Unterschied für viele Arten ist die Habitatkontinuität (= nachhaltiges, kontinuierliches Angebot der Lebensgrundlagen einer Art; Winter & Möller2008), die nur in natürlichen Wäldern gesichert ist.
Auch wenig spezifische Tierarten können in natürlichen Wäldern höhere Dichten erreichen als im Wirtschaftswald mit einzelnen Habitatbäumen. NachFladeet al. (2004) liegt die Brutvogel-Siedlungsdichte bereits in alten Naturwaldreservaten um das Zwei- bis Dreifache höher als in einem 120-jährigen Wirtschaftswald. Im hessischen Nationalpark haben Grau- und Mittelspecht deutlich höhere Siedlungsdichten als in den umgebenden Waldflächen. Auf 5 049 ha Fläche finden sich dort über 3 220 Baumhöhlen (Nationalpark Kellerwald-Edersee 2015).Die Bautätigkeit der Spechte trägt zu einem hohen Höhlenreichtum für Nachmieter bei. Insgesamt 60 Arten nutzen in Europa die Baumhöhlen des Schwarzspechts ( Dryocopus martius ) im Wald als Schlaf- oder Überwinterungsplatz, zur Jungenaufzucht oder als Nahrungsdepot (Marques2011). In natürlichen Wäldern gibt es markante, das Kronendach überragende Baumriesen, deren exponierte Höhen als Singwarte von Kolkrabe ( Corvus corax ) und Uhu ( Bubo bubo ), als Jagdgebiet von Fliegenschnäppern, Gartenrotschwanz ( Phoenicurus phoenicurus ), Baumläufern und kleinen Spechtarten oder als Horstbaum vom Fischadler ( Pandion haliaetus ) genutzt werden (Kronendachrauhigkeit,Scherzinger2011).
Gern wird in Hessen der Schwarzstorch ( Ciconia nigra ) als Kronzeuge für die Naturverträglichkeit der Forstwirtschaft angeführt. LautScheler & Stoll (2013)sei die Schwarzstorchdichte im hessischen Laubwald höher als im Buchenurwald in den ukrainischen Karpaten. Nach Einschätzung der Staatlichen Vogelschutzwarte von Hessen ist aber letzterer kein Gebiet, wo der Schwarzstorch natürlicherweise hohe Siedlungsdichten erreicht. Hingegen gibt es hohe Siedlungsdichten in den Naturwaldgebieten von Nordost-Polen (z.B. Bialowieza). In Wahrheit stagniert die Zahl seiner Brutpaare in Hessen seit 1996 auf einem Niveau und ist in den letzten Jahren sogar von 67 (2013) auf 45 (2015) zurückgegangen. Auch die Zahl von Revierpaaren (ohne bekanntes Nest) ist von 85 (2005) auf 50 (2015) gesunken. Damit verschlechtert sich sein Erhaltungszustand in ganz Hessen (Werneret al. 2014). 42 % der hessischen Schwarzstorchpaare sind auf künstliche Brut-Plattformen angewiesen.
Bundesweit nahm der Totholzvorrat zwar zu, jedoch täuschen die Statistiken darüber hinweg, dass es sich dabei ganz überwiegend (Deutschland: 65 %, Hessen: 54 %) um nicht standortheimisches Nadelholz handelt, das für die seltenen stenöken, laubwaldtypischen Arten gar nicht verwertbar ist. Auch handelt es sich meist um schwaches Totholz. Das Volumen stehender, ganzer Totholzbäume nahm in den letzten Jahren ab (Hennenberget al. 2015,HMUKLV2014). In natürlichen Wäldern gibt die Akkumulation von Totholz auf über 200 m³/ha (Meyeret al. 2009b) zahlreichen neuen Arten eine Überlebenschance.
Manchen Käferarten ist aber mit Totholz gar nicht geholfen. Sie benötigen alte, noch lebende Bäume , die manchmal über Jahrhunderte Bestand haben, während tote Stämme schon nach etwa 35 Jahren zersetzt sein können. Hat ein Eremit ( Osmoderma eremita ) einmal eine geeignete Höhle gefunden, so leben oft viele Generationen nacheinander im selben Baum, wahrscheinlich über hundert und mehr Jahre (HessenForst 2009).
Manche Kritiker stellen die Seltenheit von Arten in Frage: Es fehle nur an Kartierungen. Die Ergebnisse der Naturwaldreservate-Forschung werden vom Landesbetrieb HessenForst in der Regel darauf reduziert, die Bewirtschaftung der Wälder zu rechtfertigen: „Bemerkenswert: In der bewirtschafteten Vergleichsfläche ist die Artenvielfalt insgesamt größer als im Totalreservat" (HessenForst 2015, Scheler2014). Dabei belegen die Untersuchungsergebnisse „bewirtschaftungsbedingte Defizite in der Artenausstattung insbesondere im Hinblick auf die an Totholz gebundenen Arten" (Hmuelv2011).Beim Vergleich von Naturwaldreservaten und Vergleichsflächen fehlt es oft noch an Zeit zur Ausbildung von Unterschieden. Erst bei seit über 100 Jahren unbewirtschafteten Tieflandbuchenwäldern steigt die Artenzahl der „Urwaldreliktarten" gegenüber Wirtschaftswäldern um das Dreifache an (Fladeet al. 2007). Laut dem Bundesamt für Naturschutz ist die forstwirtschaftliche Nutzung die direkte Gefährdungsursache für allein 274 Farn- und Blütenpflanzen (BfN 2016). 21 Waldvogelarten nehmen im Bestand signifikant ab (Flade2012).Auf der „Hessen-Arten-Liste", die Zielarten der Biodiversitätsstrategie aufführt, finden sich deshalb zahlreiche Waldarten (HMUKLV2015).Die ordnungsgemäße Forstwirtschaft führte dazu, dass auch manche potenziell natürliche Waldgesellschaften auf der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen stehen (Heinrich1993, Rieckenet al. 1994). Natürliche Waldentwicklung gibt diesen Lebensräumen eine Chance zur Regeneration.
3 Einbeziehung produktiver Standorte
Manche Kritiker sehen keinen Sinn in der Herausnahme von produktiven Standorten aus der Nutzung, da dies keinen naturschutzfachlichen Mehrwert gebe (Abb. 4). Dabei bestehen große Unterschiede: So finden sich in nährstoffreichen und bodenfeuchten Wäldern des Naturschutzgroßprojekts „Hohe Schrecke" Holzvorräte von bis zu 800 fm/ha, obwohl sich die Altersklassenverteilung kaum vom bundesweiten Durchschnitt unterscheidet. Im hessischen Wirtschaftswald liegt der Durchschnitt bei 341 m³ (BWI³,HMUKLV2014). Der Anteil dicker Bäume (Brusthöhendurchmesser > 80 cm) beträgt in der Hohen Schrecke fast 6 % des Gesamtvorrats, bundesweit sind es nur 1,2 % (Johstet al. 2016). Im natürlichen Wald können Bäume doppelt bis dreimal so stark werden wie im Forst: In mitteleuropäischen Urwäldern erreichen Buchen einen Brusthöhendurchmesser von bis zu 170 cm (Scherzinger2011)und eine Höhe von bis zu 50 m.Im Urwald Uholka in den ukrainischen Karpaten kommen im Durchschnitt 21 lebende Bäume mit einem Durchmesser von > 80 cm auf 1 ha Fläche vor (Commarmotet al. 2007). Im Wirtschaftswald beträgt die Zielstärke zur Fällung laut Waldbaufibel für den hessischen Staatswald hingegen nur 60 cm.
Höhe und Stammdicke der Bäume spielen für die Arten durchaus eine Rolle. So benötigt der Schwarzspecht Bäume mit mindestens einem Brusthöhendurchmesser von 40-45 cm (Buchen). NachSikora (2005)liegen die genutzten Stammdurchmesser in vielen deutschen Untersuchungsgebieten mit 60 cm sogar weit höher. Eine Untersuchung von 270 Bechsteinfledermaus-Quartieren zeigt, dass der Anteil dünnerer Bäume (BHD 25-30 cm) dabei kaum 5 % ausmacht. Die meisten Quartiere fanden sich in den dicksten vorhandenen Bäumen (BHD um 60 cm,Dietz2013).Eine Untersuchung in Luxemburg zeigte, dass die Verbreitung der Bechsteinfledermaus signifikant positiv mit milderem Klima und mit dem Anteil nährstoffreicher Buchenwaldstandorte korrelierte (Dietz2010).Diese günstigen Faktoren führen nicht nur zu höherem Dickenwachstum der Bäume, sondern auch zu längerer Vegetationszeit, mehr Baumartenreichtum und damit zu einer höheren Nahrungsdichte. Die Naturwaldforschung in Niedersachsen zeigte zudem auf nährstoffreichen Standorten eine raschere Verjüngung vor allem aus Eschen und anderen Edellaubbäumen, was eine größere Baumartenvielfalt fördert (NW-FVA2015). Auch finden Fledermäuse in dicken Bäumen leichter frostfreie Winterquartiere (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2015).
Je kälter der Standort, desto mehr benötigen Holzinsekten starke Stammdimensionen. In dicken Baumstämmen gibt es eine größere Differenzierung der mikroklimatischen Gradienten und damit mehr Mikrohabitate . Damit steigt die Eignung des Einzelbaumes in Hinblick auf die dauerhafte Ansiedlung artenreicher Lebensgemeinschaften. In Stämmen mit schwachen Durchmessern können sich aus Platzgründen keine umfangreicheren Detritusansammlungen bilden. Der Heldbock ( Cerambyx cerdo ) ist ein Starkholzspezialist, der seine Eier erst an Eichen ab einem Umfang von 100 cm, meist über 200 cm ablegt. Auch der Eremit benötigt mächtige Bäume mit einem Stammdurchmesser von über 80 cm BHD (Pankratius2006), weil er großvolumige Baumhöhlen mit einem viele hundert Liter umfassenden, ausreichend feuchtem Mulm braucht (HessenForst 2009).Nur große Bäume sind auch imstande, die Horste von Greifvögeln, wie dem Rotmilan ( Milvus milvus ), oder von Schwarzstörchen über so viele Jahre zu tragen, dass sich Traditionshorste ausbilden können(Sommerhage2015).Diese zeigen einen höheren Bruterfolg als neu gebaute Horste. Bei hessischen Schwarzstörchen ist die Jungenzahl im Schnitt höher, wenn der Horst vier bis fünf Jahre besetzt ist (3,3; n = 10), als wenn er nur zwei bis drei Jahre besetzt ist (2,4; n = 26, Staatliche Vogelschutzwarte 2012).
Hohe Holzvolumina bewirken auch lange Abbauzeiten und damit eine längere Verfügbarkeit des Totholzes. Liegende Eichenstämme können wegen des starken biochemischen Schutzes durch eingelagerte Gerbstoffe für die vollständige Remineralisation Zeiträume von mehr als 200 Jahren benötigen (Möller2009).
4 Der Vorteil großer Gebiete gegenüber vielen kleinen
Ein Vorteil großer zusammenhängender Waldschutzgebiete ist, dass in einem größeren Landschaftsausschnitt auch die standörtliche Vielfalt durch Topographie und Exposition abgebildet ist (Kuppen-, Tal-, Schatthang-, Sonnenhanglage, Hangfuß). Mit unterschiedlicher Bodenfeuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit und Temperatur werden alle Ausprägungen der verschiedenen Waldgesellschaften sowie Sonderstandorte mit den zugehörigen Arten erfasst. So zeigt sich im Nationalpark Kellerwald-Edersee, dass in diesem Gebiet allein 22 verschiedene Waldbiotoptypen differenziert werden können (Nationalpark Kellerwald-Edersee 2015; Frede,mdl. 28.09. 2016).
Entscheidend für eine nachhaltige Sicherung der Arten ist nicht der Schutz einzelner Individuen, sondern die Bedingung, dass das Gebiet ausreichend groß zur Ausbildung einer dauerhaft lebensfähigen Population mit ausreichender genetischer Diversität ist (minimum viable population,Gilg2005). Denn die meisten Arten nutzen gar nicht das ganze Schutzgebiet, sondern nur kleine Teilflächen. Selbst in einem großen Waldschutzgebiet können nicht immer überall gleich gute Bedingungen für eine Art bestehen. Manche Arten sind an natürlicherweise sehr seltene, spezielle Strukturen , wie Wurzelteller, Ast- oder Kronenabbruch, Zwiesel, Stammrissspalten, Baumkrebs, Blitzrinnen, Großhöhlen, Stammfußhöhlen, Mulmkörper, Rindentaschen, ganz bestimmte Holz-Abbaustadien einer bestimmten Baumart oder Konsolenpilze gebunden (Fladeet al. 2004,Winter2005). Sie entstehen durch Zufallsereignisse und können auch bei Verlust des Baumes rasch wieder verloren gehen.Möller (2005)beschreibt die Abhängigkeit holzbewohnender Insektenarten von Pilzen (Fruchtkörper und Mycel).
Viele Arten sind darauf angewiesen, dass diese Strukturen beim Wechsel von Waldentwicklungsphasen stets in ausreichender Nähe und ausreichender Dichte für einen Quartierwechsel zur Verfügung stehen. So gibt es hochspezialisierte Käferarten wie den Knochenglanzkäfer ( Trox perresii ) oder den Eichenbewohnenden Breitfuß-Pilzfresser ( Cryptophagus quercinus ), die in Baumhöhlen des Schwarzspechtes wohnen, aber nur, wenn dort zuvor noch Arten wie Waldkauz ( Strix aluco ), Hohltaube, Siebenschläfer ( Glis glis ) oder Haselmaus ( Muscardinus avellanarius ) als Nachmieter gewohnt haben. Erst dann findet er im Mulm zwischen Federn, Haaren und alten Knochen seinen Lebensraum (Naturstiftung David 2012).Eine Urwaldreliktart, der Zehnfleckige Buntfleck-Baumschwammkäfer ( Mycetophagus decempunctatus ), benötigt den Schiefen Schillerporling zum Überleben (Nationalpark Kellerwald-Edersee 2015). Für den Eremiten bildet der Eichen-Feuerschwamm ( Phellinus robustus ) Habitate.
Während die Bechsteinfledermaus überwiegend wärmebegünstigte Buntspechthöhlen benötigt, nutzt das Braune Langohr ( Plecotus auritus ) Spalten oder Astabbrüche. Verkompliziert wird dies noch, wenn für eine Art auch kurzfristig nicht ein einzelnes Vorkommen einer Struktur ausreicht, sondern zeitgleich Wechselquartiere benötigt werden. So braucht die Bechsteinfledermaus für eine Wochenstube 35 bis 40 Baumhöhlen, um Prädation oder Parasitenbefall zu vermeiden, sowie zur Thermoregulation (Kerthet al. 2002 inDietz2010). Solche Quartierkomplexe sind im Durchschnitt 55 ha groß, können aber auch eine Größe von bis zu 154 ha umfassen.Die Baumhöhlendichte ist hier viermal so hoch wie die mittleren Werte in hessischen Wirtschaftswäldern (Dietz2012).
Eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit des kontinuierlichen Vorhandenseins aller wichtigen Strukturen besteht nur in sehr großen Naturwäldern.Arten mit geringem Ausbreitungspotenzial sind deshalb auf großflächige Gebiete angewiesen. Nur hier erreichen sie eine ausreichende Dichte und finden sich vollständige Lebensgemeinschaften. Nur bei stabilen Populationen mit hohen Individuendichten gibt es auch einen Ausstrahlungseffekt auf die umgebenden Wälder, also abwandernde Tiere aus sogenannten Quellpopulationen.
Große, zusammenhängende Gebiete haben eine kürzere Grenzlinie mit störenden Randeffekten. Daher profitieren auch einige Arten mit großem Raumanspruch von der Nutzungsfreiheit, auch wenn sie nicht zwingend an nutzungsfreie Wälder gebunden sind. Denn die damit einhergehende Beruhigung nützt z.B. Schwarzstorch, Uhu, Rotmilan, Wespenbussard ( Pernis apivorus ), Luchs ( Lynx lynx ), Wolf ( Canis lupus ) und Wildkatze ( Felis silvestris ). Große Waldschutzgebiete ermöglichen es, auf bestimmte Wege zu verzichten und beruhigte, unter Umständen auch jagdfreie Bereiche zu schaffen, in denen der Rothirsch ( Cervus elaphus ) als größtes heimisches Säugetier wieder seine natürliche Verhaltensweise (tagaktiv) entwickeln kann (Harthun2011).Der Biber ( Castor fiber ), der wegen seiner Landschaftsgestaltung in genutzten Kulturlandschaften unweigerlich zu Konflikten führt, kann in großen Waldschutzgebieten Bäume fällen, ringeln oder überstauen, großflächige Biberseen anlegen und Röhren graben, ohne dabei einen Konflikt mit Landnutzern zu erzeugen. So könnte der Biber, der sich in Hessen in Ausbreitung befindet (aktuell ca. 488 Tiere, Regierungspräsidium Darmstadt 2015), in hohem Maße zur Gewässerdynamik und zur Steigerung der Artenvielfalt in Waldschutzgebieten beitragen (Harthun1998).
Große Gebiete mit über 1 000 ha Fläche mit natürlicher Waldentwicklung erfüllen auch die fachlich empfohlene Mindestgröße für Wildnisgebiete (European Wilderness Quality Standard,Fincket al. 2015). Sie tragen so gleichzeitig zur Erfüllung des 2-%-Wildnisziel der Nationalen Biodiversitätsstrategie bei (Spellmannet al. 2015). Hier findet Dynamik auf Landschaftsebene statt, bei der auch bei großflächigen natürlichen Ereignissen – wie Auflichtungen durch Sturm, Biberseen, Kalamitäten oder natürlichen Absterbeprozessen – immer noch genug Wälder in allen Entwicklungsphasen in sehr enger räumlicher Verzahnung vorhanden sind, um eine Habitatkontinuität zu gewährleisten. Eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit für alle Arten im Gesamtgebiet bleibt damit bestehen. In der bisherigen hessischen Naturwaldkulisse erreichen nur zwei Flächen das Potenzial für ein Wildnisgebiet, der Nationalpark Kellerwald-Edersee und die nutzungsfreie „Kernfläche" Wispertaunus (s. Titelbild des vorliegenden Heftes).
Nicht zuletzt spielt auch die Erlebbarkeit der künftigen Naturwälder für die Bevölkerung eine wichtige Rolle. Große „Urwälder" sind leicht zu finden, aus der Distanz zu erkennen und tragen damit zur Identität einer Landschaft bei, wie heute schon markante Berge. Sie stellen einen besonderen Kontrast zu urbanen und Kulturlandschaften dar. Ein Naturwald-Erlebnis, das nicht, wie in vielen kleinen Kernflächen, die in Hessen als Prozessschutzgebiete ausgewählt wurden (vgl.Harthun2017), nach einem zehnminütigen Spaziergang beendet ist, sondern erwandert werden muss, spricht Menschen auch emotional an. Mit einer hohen Zahl von uralten, dicken, großen Bäumen macht es den Unterschied zum Wirtschaftswald erst deutlich erkennbar. Es fasziniert und weckt Ehrfurcht und Respekt vor der Natur, was in unserer Gesellschaft selten geworden ist (Voigt2014, Zucchi2002). NachSinner (2013)sind diese Naturschutzgebiete damit auch „Seelenschutzgebiete" für Menschen. Wildnisgebiete können aufgrund ihrer Größe einen wichtigen Beitrag zu Bildung(Langenhorstet al. 2014) und Forschung leisten (vgl. www.wildnis-in-deutschland.de ). Große Naturwälder haben auch ein touristisches Potenzial, das positive regionalökonomische Effekte mit sich bringt. Rund 50 Mio. Besucher kommen in die deutschen Nationalparke und sorgen für eine bundesweite Wertschöpfung von 2,1 Mrd. € (Anonymus 2010). Mehr als 870 000 Gäste besuchen jährlich den Wald-Nationalpark Eifel (Anonymus 2016). Nur große Gebiete verkraften auch Störungen durch Besucher, wenn sie gelenkt werden.
Ein System aus wenigen großen Gebieten vermindert den Verwaltungsaufwand erheblich und erleichtert das Management: So wurde in Hessen aufgrund der großen Zahl von kleinen Kernflächen schnell Abstand von dem Ziel einer Beschilderung genommen. Überregionale Karten-Darstellungen sind nicht möglich. Die Folge ist, dass die Bevölkerung die Flächen nur schwer finden und identifizieren kann. Das führt neben einem Erlebnisverlust auch zu konkreter Bedrohung durch irrtümliche Eingriffe bei der Holzernte.
Die Befürworter vieler kleiner Naturwaldflächen argumentieren damit, dass damit eine spezifischere Auswahl hochwertiger Flächen möglich sei. Alte Waldbestände seien dann überproportional vertreten und Nadelwaldanteile geringer. Außerdem seien manche seltenen Waldtypen aus natürlichen Gründen nur kleinräumig vorhanden und führten damit zwangsläufig zu kleinen Schutzgebieten. Tatsächlich ist der Anteil alter Wälder (> 140 Jahre) bei der ersten Auswahl nutzungsfreier Kernflächen, die sehr klein waren, mit 45 % deutlich höher als der Schnitt im hessischen Staatswald (13 %). Hingegen war der „Beifang" von Nadelwäldern in dieser ersten Tranche mit 12 % kaum geringer als in der zweiten Tranche, in der auch größere Gebiete enthalten waren (13 %, HessenForst, schriftl. Mitt. 07.07.2016).
Altholzbestände sind sicher wichtige Refugien und können bei Nutzungsverzicht für die nächsten 100 Jahre eine hohe Bedeutung für den Artenschutz im Wald spielen – jedoch nur auf Zeit. In kleinen Kernflächen kann schon ein zu geringer Bestockungsgrad des alten Bestands zum Verschwinden von Arten führen. Die wenigen verbliebenen älteren Bäume können keine Kontinuität der Lebensbedingungen garantieren, weder für viele Waldarten noch für andere Arten, die auf konstante Bedingungen angewiesen sind, wie Bach- oder Quellorganismen. Sie werden rasch durch Sonnenbrand oder Windwurf zusammenbrechen. Spätestens beim Wechsel der Zerfallsphase in einen Jungwald ist in gleichaltrigen Altersklassenwäldern mit dem Verlust der wenig mobilen Altholzbewohner zu rechnen, wenn die alternativ besiedelbaren Habitatstrukturen fehlen. Dies betrifft vor allem flugunfähige Arten, aber auch standorttreue Vogelarten, wie den Mittelspecht (Fladeet al. 2004).
In kleinen Gebieten können selbst normale dynamische Prozesse zum Aussterben von Arten führen: So berichtetH. Bussler (mdl. 28.09.2016) von „leeren Strukturen", wie einem sehr alten Eichenwald in der Oberpfalz mit hohem Totholzanteil (100 fm/ha), in dem trotzdem keine einzige eichentypische Käferart vorkommt. Entscheidende Ursache war ein Bruch der Habitatkontinuität durch einen Orkan vor 180 Jahren und mangelnde Zuwanderungsmöglichkeiten durch umgebende Fichten- und Kiefernwälder. In vom Landesbetrieb HessenForst ausgewählten, weitgehend abgeernteten Kernflächen wie im Reinhardswald (vgl.Harthun2017) wird es fünf Menschengenerationen dauern, bis sich ein naturschutzfachlich herausragender Wald entwickelt hat. Die Auswahl solcher Flächen ist daher kein geeigneter Beitrag zur Rettung von Arten, welche auf die Strukturen alter Wälder angewiesen sind. Und sie ist eine vertane Chance für Umweltbildung und die Akzeptanz dieser Naturschutzstrategie in der Bevölkerung.
Wenn aber jede Waldinsel für sich nicht auf Dauer das Überleben der Arten sichern kann, müsste ihre Verteilung so dicht sein, dass alle Habitat-Strukturen zu jeder Zeit in unmittelbarer Nachbarschaft (z.B. Eremit: 30 bis 190 m,Ranius & Hedin2001; Knochenglanzkäfer: 500 m, Naturstiftung David 2012) vorhanden sind. Dies kann das bisherige Waldnaturschutzkonzept nicht leisten: Häufig sind die Kernflächen viele Kilometer voneinander entfernt. Die Flächen können ihren Wert und ihre Funktion langfristig nur durch Integration in große Naturwaldgebiete erhalten, in denen auch jüngere Laubwaldbestände einbezogen sind, die in Zukunft die Habitatkontinuität und eine Besiedlungskontinuität sicherstellen können.
Anspruch und Wirklichkeit klaffen aber auch auseinander: Der Landesbetrieb HessenForst legt in der Naturschutzleitlinie die Hotspot-Strategie (Meyeret al. 2009a) als Grundlage zur Flächenauswahl zugrunde. Sie empfiehlt, bei Schutzkonzepten dort anzusetzen, wo aktuell Biodiversitätszentren ausgebildet sind. Weil es jedoch nur wenige Daten über die Verbreitung von seltenen Arten im Wald gab, ging man in Hessen von der theoretischen Annahme aus, dass in den ältesten Beständen auch die wertvollsten Arten zu finden sind. Jedoch konnten nach dem Kriterium „Laubholzbestände der Alters- und Zerfallsphase" (Buchen > 180, Eichen > 240 Jahre) überhaupt nur wenige Gebiete ausgewählt werden, weil es diese alten Bestände nur sehr selten gibt. So konnten für die erste Tranche im gesamten hessischen Staatswald nur 65 ha alte Eichenwälder und 1 929 ha alte Buchenwälder gefunden werden. Verbreitungsdaten seltener Arten, die „Hotspots" hätten begründen können, wurden offenbar auch nicht vollständig einbezogen: So wurden dem Land vorliegende Daten über geschützte Arten wie das Grüne Besenmoos, die bei der heutigen Form der Forstwirtschaft als obligatorisch auf nutzungsfreie Wälder angewiesen gelten müssen, nicht für die Flächenauswahl herangezogen. Inzwischen wurde in einem FFH-Gebiet (Laubacher Wald) rund 80 % der Vorkommen des Grünen Besenmooses an vier von acht Stellen im Zuge der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft zerstört, was Anlass für den NABU war, Klage gegen das Land Hessen einzureichen (NABU Hessen 2016, 2017).
Seitens des Landesbetriebs HessenForst wird betont, dass die Naturschutzleitlinie „durch strikte Fachlichkeit" geprägt sei. Allerdings sei es bei der ersten Kernflächentranche auch gar nicht um die Planung möglichst großer Naturschutzgebiete mit Prozessschutz gegangen. Vielmehr sollten Maßnahmen konzipiert werden, die in die naturnahe Bewirtschaftung des Staatswaldes integriert werden können (Scheler & Stoll2013).Jedoch warnenMeyeret al. (2009b): „Für die Lebensgemeinschaften der Alters- und Zerfallsphase könnte ein Biotopverbund aus integrierten Naturschutzmaßnahmen im Wirtschaftswald wegen der geringen Mobilität der betreffenden Arten unwirksam sein".
Auch gibt es bei Holzkäfern neben dem Totholz-Schwellenwert für eine höhere Artenzahl noch einen zweiten für die Individuenzahlen (H.Bussler,mdl.28.09.2016): Erst ab einem Totholzanteil von 100 fm/ha, der realistisch nur in Naturwäldern erreicht werden kann, gehen die Individuenzahlen so hoch, dass von einem Ausbreitungspotenzial durch Spenderpopulationen gesprochen werden kann. Kleine Gebiete können also zwar interessante Arten beherbergen, jedoch ohne zur zukünftigen weiteren Verbreitung der Art beizutragen.
Die Hotspot-Strategie versteht die Hotspots daher auch gar nicht als Gebietsvorschläge, sondern nur als Ansatzpunkte für eine systematische Schutzgebietsplanung: „Zu kleine und/oder isoliert gelegene Flächen sollen ggf. vergrößert … werden" (Meyeret al. 2009b).
Ein weiteres vorgebrachtes Argument für ein System kleiner Gebiete lautet, dass die Häufigkeit bei manchen Arten, wie dem Schwarzspecht, aufgrund der Revierbildung durch größere Naturwälder gar nicht mehr steigerungsfähig sei (HessenForst 2012, Mergner2014).Dies wird jedoch durch andere Untersuchungen widerlegt: Die Reviergröße des Schwarzspechtes variiert zwischen 160 ha/BP (BP = Brutpaar) und 900 ha/BP, je nach Ausstattung mit Altholzbeständen und Totholz (Scherzinger1981 inLWF2006).Ihre Dichte variiert von 0,1 bis zu 0,6 BP/km² (Sikora2005).Es ist daher zu erwarten, dass in Naturwäldern mit besserer Habitateignung die Reviergrößen sinken und damit die Dichte dieser wichtigen Schlüsselart zunimmt (vgl.Hondong2016). Auch die Dichte von Mittelspechten kann zwischen 0,02 BP/ 10 ha bis zu 2,9 BP/10 ha in uralten Buchenreinbeständen liegen (Wichmann & Frank2005).
LautScheler & Stoll (2013)zeigen Untersuchungen im hessischen Burgwald, dass für hohe Populationsdichten des Schwarzspechtes der Fichtenanteil im Buchenwald wichtiger sei als das Vorhandensein ausgedehnter Altbestände in Naturwäldern. Die Ergebnisse zahlreicher jüngerer Studien zeigen jedoch, dass der Schwarzspecht als Habitat-Generalist einzustufen ist. Die wesentliche Bedeutung des Nadelholzes liegt für ihn in der Bereitstellung vermoderter Stubben. Die dort lebenden Ameisen und anderen Arthropoden verbessern das Nahrungsangebot in bewirtschafteten, totholzarmen Laubwaldgebieten. Gibt es jedoch in Laubwäldern ausreichend Totholz, ist Nadelholz für das Vorkommen und die Siedlungsdichte des Schwarzspechts nicht von Bedeutung (vgl.Schmidtet al. 2016).Hondong(2016) konnte bei großräumigen Gebietsvergleichen feststellen, dass im nadelbaumarmen slowakischen Buchennationalpark Poloniny doppelt so hohe Abundanzen anzutreffen sind wie im nadelbaumreichen Naturpark Solling in Nordwestdeutschland. Auch dies spricht für höhere Dichten in Naturwäldern.
Auch kleine Naturwaldgebiete können einen wichtigen Beitrag leisten: Als in die Wirtschaftswälder integrierte, kleine Trittsteine tragen sie zur Ausbreitung mancher Arten bei (HessenForst 2010, Jedicke2006). Aber sie können große Naturwälder nicht ersetzen. Daher gibt es keinen Gegensatz zwischen den Strategien Integration und Segregation. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung und keiner funktioniert ohne den anderen (vgl. auchFörschleret al. 2013,Jedicke2008, Scherzinger2015). Die Befürchtung des Deutschen Forstwirtschaftsrates einer „Zwei-Klassen-Waldwirtschaft" („Erfurter Erklärung" vom 21.06. 2011) sind daher unbegründet. Seit der SLOSS-Debatte der 1970er- und 1980er-Jahre (Single-Large-Or-Several-Small,Diamond1975) ist aber wissenschaftlich kaum zu widerlegen, dass Schutzgebiete so groß wie möglich sein sollten. Die meisten Gegenargumente sind daher auch eher grundsätzliche Vorbehalte gegen natürliche Waldentwicklung. Sie werden inHarthun (in Druck) ausführlich diskutiert.
Literatur
Anonymus (2010): Mut zur Wildnis auch in Deutschland. Natur in NRW 3/10, 9.
– (2016): Zahl des Monats: 870 000. Natur und Landschaft 91 (8), 384.
Balcar, P. (2013):Dient Stilllegung von Wald auch wirklich dem Naturschutz? Naturwaldforschung zur Artenvielfalt im Natur- und Wirtschaftswald. AFZ/Der Wald (12), 23-25.
Bayerisches Landesamt für Umwelt(2015): UmweltWissen – Natur. Fledermäuse und ihre Quartiere schützen. Freising, 12 S.
BfN(2016):Floraweb – Rote Listen. www.floraweb.de/pflanzenarten/hintergrundtexte_rotelisten_anwendung_bsp6.html (zuletzt abgerufen am 08.12.2016).
BMUNR(2007):Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt. Berlin/Bonn,180 S.
BDF (2016):Offener Brief des BDF Hessen an die hessische Staatsministerin Hinz. BDFaktuell (5), 26.
Commarmot, B., Chumak, V., Duelli, P., Küffer, N., Lovas, P., Shparyk, Y. (2007): Buchenurwälder als Referenz für Naturschutz: Forschungsergebnisse aus den ukrainischen Karpaten. Natur und Landschaft 82 (9/10), 398-400.
Diamond, J.M. (1975): The Island Dilemma: Lessons of Modern Biogeographic Studies for the Design of Natural Reserves. Biological Conservation 7 (2), 129-146.
Dietz, M. (2010):Fledermäuse als Leit- und Zielarten für Naturwaldorientierte Waldbaukonzepte. Forstarchiv 81 (2), 69-75.
– (2012):Waldfledermäuse im Jahr des Waldes – Anforderungen an die Forstwirtschaft aus Sicht der Fledermäuse. Naturschutz Biolog. Vielfalt 128, 127-146.
– (2013):Populationsökologie und Habitatansprüche der BechsteinfledermausMyotis bechsteinii. Selbstverlag, Laubach-Gonterskirchen, 344 S.
Drössler, L, Meyer, P. (2006): Waldentwicklungsphasen in zwei Buchen-Urwaldreservaten in der Slowakei. Forstarchiv 77, 155-161.
Engel, F., Bauhus, J., Gärtner, S., Kühn, A., Meyer, P., Reif, A., Schmidt, M., Schultze, J., Späth, V., Stübner, S., Wildmann, S., Spellmann, H.(2016): Wälder mit natürlicher Entwicklung in Deutschland: Bilanzierung und Bewertung. Naturschutz Biol. Vielfalt 145, 267 S.
Finck, P., Klein, M., Riecken, U., Paulsch, C. (2015):Wildnis im Dialog. Wege zu mehr Wildnis in Deutschland. BfN-Skripten 404.
Flade, M. (2012):Von der Energiewende zum Biodiversitäts-Desaster – zur Lage des Vogelschutzes in Deutschland. Vogelwelt 133, 149-158.
–, Möller, G., Schumacher, H., Winter, S. (2004):Naturschutzstandards für die Bewirtschaftung von Buchenwäldern im nordostdeutschen Tiefland. Der Dauerwald 29, 15-28.
–, Winter, S., Schumacher, H., Möller, G. (2007):Biologische Vielfalt und Alter von Tiefland-Buchenwäldern. Natur und Landschaft 82 (9/10), 410-415.
Förschler, M., Ebel, C., Schlund, W. (2013):SLASS statt SLOSS. Warum ein Nationalpark im Nordschwarzwald doch die bessere Lösung darstellt. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (4), 119-128.
Gilg, O. (2005):Old-Growth Forests. Characteristics, Conservation and Monitoring. Réserves Naturelles de France. Habitat and Species Management. Technical Report 74.
Hanspach, J., Kühn, I., Klotz, S. (2013):Risikoabschätzung für Pflanzenarten, Lebensraumtypen und ein funktionelles Merkmal. In: Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Schutzgebiete Deutschlands im Klimawandel – Risiken und Handlungsoptionen, 71-85.
Harthun, M. (1998):Biber als Landschaftsgestalter. Einfluß des Bibers auf die Lebensgemeinschaft von Mittelgebirgsbächen. Maecenata, München, 199 S.
– (2011): Gilt der Prozessschutz für alle Lebewesen? Forderungen an ein Schalenwildmanagement in Nationalparks. In: Europarc, Hrsg., Wildbestandsregulierung in deutschen Nationalparks, Abschlussdokumentation der Tagung Bad Wildungen 29./30. März 2011, 50 S.
– (2017):Wilde Wälder in Hessen – Fortschritte und Handlungsbedarf. Entwicklung natürlicher Wälder in Hessen (I)–Auswahlkriterien für Naturwälder. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (5), 149-155.
– (im Druck): Natürliche Wälder: Unnötig, zu teuer, gefährlich, unmoralisch? Entwicklung natürlicher Wälder in Hessen (III) – die Argumente der Kritiker. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (6).
Heinrich, C. (1993):Leitlinie Naturschutz im Wald. Ein Naturschutzkonzept für den Wald in Hessen. Naturschutzbund Deutschland, LV Hessen, Hrsg., Wetzlar, 166 S.
Hennenberg, K., Winter, S., Reise, J., Winger, C. (2015):Analyse und Diskussion naturschutzfachlich bedeutsamer Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. BfN-Skripten 427, 120 S.
HessenForst(2009):Landesweites Artenhilfskonzept Eremit (Osmoderma Eremita ). Nachuntersuchung 2008 von Dr. U. Schaffrath. 98 S.
– (2010):Naturschutzleitlinie für den Hessischen Staatswald. Kassel.
– (2012): Nachhaltigkeitsbericht für 2011 und 2012. Kassel, 104 S.
– (2015):Nachhaltigkeitsbericht für 2015. Kassel, 79 S.
HMUELV (2011):Bericht Wald und Naturschutz in Hessen 2007/2010. Wiesbaden, 144 S.
HMUKLV (2014):Hessen – Bäume, Wälder, Lebensräume. Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur (BWI³) für Hessen. Wiesbaden, 49 S.
– (2015):Tiere, Pflanzen, Lebensräume. Leitfaden zur Umsetzung der Hessischen Biodiversitätsstrategie (Ziel I und II) in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Wiesbaden. 59 S.
Hondong, H. (2016):Verbessert Nadelholz die Habitatqualität für den Schwarzspecht? Forstarchiv 87, 152-161.
Isbell, F., Calcagno, V., Hector, A., Connolly, J., StanleyHarpole, W., Reich, P.B., Scherer-Lorenzen, M., Schmid, B., Tilman, D., Ruijven, J.v., Weigelt, A., Wilsey, B.J., Zavaleta, E.S., Loreau, M. (2011):High plant diversity is needed to maintain ecosystem services. Nature (477), 199-202.
Jedicke, E. (2006): Altholzinseln in Hessen. HGON AK Main-Kinzig, Hrsg., Rodenbach, 80 S.
– (2008):Biotopverbund für Alt- und Totholz-Lebensräume. Leitlinien eines Schutzkonzepts inner- und außerhalb von Natura 2000. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (11), 379-385.
Klaus, S. (2010):Was bringt die Biodiversitätsstrategie unseren Vögeln im Laubwald? Nationalpark (1), 8-10.
Johst, A., Conrady D., Peinelt, N. (2016): Das Naturschutzgroßprojekt „Hohe Schrecke". Natur und Landschaft 91, (4), 153-160.
Langenhorst, B., Lude, A., Bittner, A. (2014):Wildnisbildung. Neue Perspektiven für Großschutzgebiete. Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Hrsg., Osnabrück, 298 S.
LWF (2006):Artenhandbuch der für den Wald relevanten Tier- und Pflanzenarten. Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, Hrsg., Freising, 200 S.
Marques, D. (2011): Holzbaumeister mit Schlüsselfunktion. Ornis (1), 12-15.
Mergner, U. (2014):Small is beautiful. Ein Plädoyer für die kleinflächige Stilllegung in Wäldern. AFZ/Der Wald (3), 7-9.
Meyer, P., Schmidt, M., Spellmann, H. (2009a):Die „Hotspots-Strategie" – Wald-Naturschutzkonzept auf landschaftsökologischer Grundlage. AFZ/Der Wald (15), 822-824.
–, Menke, N., Nagel, J., Hansen, J., Kawaletz, H., Paar, U., Evers, J. (2009b): Entwicklung eines Managementmoduls für Totholz im Forstbetrieb. Abschlussbericht, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 110 S.
–, Schmidt, M., Spellmann, H., Bedarff, U., Bauhus, J., Reif, A., Späth, V. (2011):Aufbau eines Systems nutzungsfreier Wälder in Deutschland. Natur und Landschaft 86 (6), 243-249.
Möller, G. (2005):Habitatstrukturen holzbewohnender Insekten und Pilze. LÖBF-Mitt. (3), 30-35.
–(2009): Struktur- und Substratbindung holzbewohnender Insekten, Schwerpunkt Coleoptera – Käfer. Diss. Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie, Freie Universität Berlin, 293 S.
Müller, J. (2015):Prozessschutz und Biodiversität. Überraschungen und Lehren aus dem Bayerischen Wald. Natur und Landschaft 90 (9/10), 421-425.
NABU Hessen(2016): EU-Beschwerde: Unzureichende Umsetzung FFH-Richtlinie, Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2014/2262 (unveröff.). 10 S.
– (2017):Klageantrag und -begründung zur Anzeige wegen Umweltschaden im FFH-Gebiet Laubacher Wald vom 16.1.2017 an das Verwaltungsgericht Gießen (unveröff.).
–,BUND Hessen (1994): Waldschutzgebiete – Urwald von morgen. Konzeption zum Schutz und zur Entwicklung naturbelassener Laubwaldökosysteme in großflächigen Waldschutzgebieten im Bundesland Hessen. Wetzlar/Frankfurt, 236 S.
Nationalpark Kellerwald-Edersee(2015):Biotopausstattung und Naturnähe im Nationalpark Kellerwald-Edersee. Forschungsberichte 2, Bad Wildungen.
Naturstiftung David(2012):Das große Krabbeln. Hohe Schrecke-Journal (10), Sonderausg., 6-7.
NW-FVA (2015):Naturwälder in Niedersachsen – Schutz und Forschung, Bd. 2. Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt und Niedersächsische Landesforsten, Hrsg., 396 S.
Paillet, Y., Bergès, L., Hjältén, J., Ódor, P., Avon, C., Bernhardt-Römermann, M., Bijlsma, R.-J., De Bruyn, L., Fuhr, M., Grandin, U., Kanka, R., Lundin, L., Luque, S., Magura, T., Matesanz, S., Mészáros, I., Sebastìa, M.-T., Schmidt, W., Standovár, T., TÓthméréz, B., Uotila, A., Valladares, F., Vellak, K., Virtanen, R. (2009):Biodiversity Differences between Managed and Unmanaged Forests: Meta-Analysis of Species Richness in Europe. Conservation Biology 24 (1), 101-112.
Pankratius, U. (2006): Erkenntnisse zur Verbreitung und Habitatnutzung des Eremiten (Osmoderma eremita SCOPOLI, 1763) am Stadtrand von Nürnberg, Beibeobachtungen zum Großen Goldkäfer. Galathea 22 (3), 131-139.
Ranius, T., Hedin, J. (2001):The dispersal rate of a beetle,Osmoderma eremita , living in tree hollows.Oecologia (126), 363-370.
Regierungspräsidium Darmstadt(2015):Biber in Hessen. Kartierung der Biber in Hessen im Jahr 2015. Darmstadt, 29 S.
Riecken, U., Ries, U., Ssymank, A. (1994):Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland. Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Bonn-Bad Godesberg, 184 S.
Rupf, H. (1960): Wald und Mensch im Geschehen der Gegenwart. Allg. Forstzeitschrift 15 (38), 545-552.
Scheler, F. (2014):Mithaftung. HessenForst, Mitarbeiterzeitung Im Dialog (3), 13.
–, Stoll, S. (2013): Naturschutz-Leitlinie für den hessischen Staatswald. Weder Nutzung noch Naturschutz im Extrem betreiben. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (4), 119-128.
Scherzinger, W. (2011):Der Wald als Lebensraum der Vogelwelt. Wald – Biotop und Mythos. Grüne Reihe 23. Böhlau-Verlag, Wien/Köln, 27-154.
– (2015):Wald-Naturschutz im Spiegel der Wald-Natur. AFZ/Der Wald (6), 10-12.
Schmidt, M., Meyer, P., Mölder, A., Hondong; h: (2016):Neu- oder Wiederausbreitung? Die Arealausweitung des Schwarzspechts in Nordwestdeutschland am Ende des 19. Jahrhunderts und ihre Ursachen. Forstarchiv 87, 135-151.
Schulze, E.D., Boch, S., Müller, J., Levick, S.R., Schumacher, J. (2016):Seltene und gefährdete Pflanzen wachsen im Laubwald überall. AFZ/Der Wald (13), 35-38.
Sinner, K.-F. (2013):Seelen-Schutzgebiete. Warum wir Nationalparks brauchen. ZGF Gorilla (3), 11-14.
Sommerhage, M. (2015):Rotmilan-Schutz in Waldeck-Frankenberg (Nordhessen): Wesentliche Gefährdungsursachen und erforderliche Schutzmaßnahmen. Vogelkundliche Hefte Edertal 41, 6-19.
Spellmann, H., Engel, F., Meyer, P.(2015): Natürliche Waldentwicklung auf 5 % der Waldfläche. Aktuelle Bilanzen und Beitrag zum 2%-Wildnisziel. Natur und Landschaft 90 (9-10), 413-416.
Staatliche Vogelschutzwarte(2012):Artenhilfskonzept für den Schwarzstorch (Ciconia nigra ) in Hessen. Frankfurt, 120 S.
Voigt, A. (2014):Prozessschutz und die Sehnsucht nach Wildnis. Natur in NRW (1), 20-23.
Werner, M., Bauschmann, G., Hormann, M., Stiefel, D. (2014):Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens. Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Vogel und Umwelt 21, 37-69.
Wichmann, G., Frank, G. (2005):Die Situation des Mittelspechts (Dendrocopos medius ) in Wien. Egretta 48, 19-34.
Winter, S. (2005):Ermittlung von Struktur-Indikatoren zur Abschätzung des Einflusses forstlicher Bewirtschaftung auf die Biozönosen von Tiefland-Buchenwäldern. Diss. TU Dresden, 397 S.
–,Möller, G.C. (2008):Microhabitats in lowland beech forests as monitoring tool for nature conservation. Forest Ecology and Management 255, 1251-1261.
ZGF, NABU Hessen, BUND Hessen, Greenpeace, WWF(2015):Ergänzung des Kernflächenkonzepts von HessenForst um großflächige Waldschutzgebiete. Unveröff. Mskr., Frankfurt u.a., 42 S.
Zucchi, H. (2002):Wildnis als Kulturaufgabe – ein Diskussionsbeitrag. Natur und Landschaft 77 (9/10), 373-378.
Kontakt
Dipl.-Biol. Mark Harthun arbeitet seit 1997 beim Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen, als Naturschutzreferent und stellvertretender Geschäftsführer. Studium der Biologie an der Philipps-Universität Marburg. Themenschwerpunkte: natürliche und naturnahe Waldentwicklung, europäisches Naturschutzrecht, Artenschutz, natürliche Gewässerentwicklung.
Fazit für die Praxis
- Die in Hessen ausgewählten nutzungsfreien Waldflächen sind fast alle zu klein, um dem Ziel natürlicher Wälder, den dauerhaften Erhalt waldtypischer Arten, allein gerecht zu werden.
- Eine große Artenvielfalt und insbesondere der Schutz seltener, stenöker Arten erfordert eine Habitatkontinuität, die nur große Gebiete sicherstellen können. Nur hier werden dauerhaft überlebensfähige Populationen mit Individuenzahlen gesichert, die auch in Wirtschaftswälder ausstrahlen können.
- Solche Ewigkeitsprojekte setzen eine Mindestgrößte und rechtliche Sicherung als Naturschutzgebiete voraus.
- Für eine repräsentative Auswahl und den Schutz besonders großer und dicker Bäume müssen auch produktive Waldstandorte einbezogen werden, die bisher vermieden wurden.
- Für die Sicherung dynamischer Prozesse auf Landschaftsebene sollten in Hessen zum Erreichen des Anteils von 5 % Naturwaldfläche bis 2020 weitere Wälder ausgewählt werden, die 500 bis 1 000 ha groß sein sollten. Sie vermindern nicht nur den Verwaltungsaufwand, sondern können gleichzeitig positive regionalökonomische Effekte bieten.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen



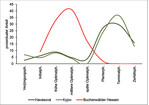


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.