Projektion zukünftiger Ökosystemzustände unter dem Einfluss von Klimawandel und atmosphärischen Stickstoffeinträgen
Abstracts
Unter Berücksichtigung des Klimawandels und anthropogener Stoffeinträge ermöglicht die dynamische Modellierung Projektionen chemischer Bodenverhältnisse. Durch Abgleich der Modellierungsergebnisse mit vorliegenden Informationen zu Bodenparametern aus Monitoring-Programmen und mit einem Vergleich des bei der Ökosystemtypisierung ermittelten Referenzzustands (Teil I dieser Artikelserie, Jenssen et al. 2015) werden zukünftig mögliche Ökosystementwicklungen standortspezifisch abgeschätzt. Dies dient zum besseren Verständnis zukünftiger Reaktionsmuster von Waldökosystemtypen auf externe Einflüsse wie Klimawandel und Stoffeinträge. Nach einer vorausschauenden Betrachtung (Projektion) der unter diesen Randbedingungen zu erwartenden Entwicklung der Integrität von Wald- und Forstökosystemtypen können beispielsweise Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel für den Waldbau abgeleitet werden.
Projecting future conditions of forest ecosystems exposed to climate change and atmospheric nitrogen deposition – Integrity of forest ecosystems exposed to climate change and atmospheric nitrogen deposition – Part II
Dynamic modelling allows calculating future chemical soil conditions by considering several climate and deposition scenarios. The future ecosystem development can be estimated by comparing the modelling results with soil data from monitoring programmes and with the reference status of the selected indicators which are constitutive for the classification of forest ecosystem types (Part I of this series). Modelling serves the better understanding of response pattern of forest ecosystem types caused by external influences like climate change and deposition. After a forward-looking consideration (projection) of ecosystem integrity and future development of ecosystem types adaptation strategies, e.g. for silviculture, could be derived.
- Veröffentlicht am
1 Modellierungsdesign und Untersuchungsobjekte
1.1 Wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlagen für Maßnahmen
Dieser Beitrag stellt dar, wie auf Grundlage von Messdaten zu Vegetation und Böden von Wald- und Forstökosystemtypen (Teil I der Artikelserie), Annahmen (Szenarien) über atmosphärische Stickstoffeinträge und ebenfalls auf Szenarien gestützte Klimaprojektionen Ökosystementwicklungen mit dynamischer Modellierung abgebildet werden können. Dabei geht es darum zu ermitteln, ob und – wenn ja – wie zu einer bestimmten Zeit beobachtete Zustände (Ausprägung von Eigenschaften) ausgewählter Wald- und Forstökosystemtypen sich im Zeitverlauf unter dem Einfluss von Klimawandel und atmosphärischen Einträgen von Stickstoff (N) verändern und wie diese Veränderung durch Vergleich mit entsprechenden Referenzzuständen einzustufen sind. Was diese Veränderungen z.B. für Umwelt- und Naturschutz bedeuten, hängt zum einen von den Schutzzielen, zum anderen aber auch von der Kenntnis der methodischen Grundlagen ab. Diese werden im Folgenden knapp dargestellt und am Beispiel der Klimamodellierung konkretisiert.
Ziel empirischer Wissenschaften ist die reproduzierbare Beschreibung, Erklärung und Prognose von Phänomenen (Orbrecht 2007, Schröder & Pesch 2013). Dabei wird eine allgemeine Gesetzmäßigkeit für Erklärung und deterministische Vorhersage (Prognose, engl. forecast) bzw. nicht-deterministische Erwartung oder Vorausschau (engl. foresight) verwendet: In einer Erklärung wird eine Wirkung auf eine Ursache zurückgeführt und in Prognosen oder Erwartungen wird eine Wirkung ausgehend von einer Ursache vorhergesagt. Eine typische Anwendung wissenschaftlicher Erklärungen erfolgt bei der Suche nach einer daraus abgeleiteten Maßnahme (Technologie), mit denen beispielsweise im Umwelt- und Naturschutz ein gegenwärtig beobachteter oder zukünftig erwarteter Ökosystemzustand erhalten oder verändert werden soll (Cuhls 2012, Martin 2010, Prim & Tilmann 2000, Schröder & Pesch 2013).
In dieser Arbeit verwendete Informationen über Klimawandel werden in der Meteorologie nicht als Prognosen, sondern als Projektionen bezeichnet. Es handelt sich also nicht um deterministische Aussagen. Dasselbe gilt auch für die Aussagen der in dieser Arbeit dargestellten Modellierung bodenchemischer Prozesse; denn hierfür wurden Ergebnisse von Klimaprojektionen verwendet. Folglich sind die Ergebnisse dieser Arbeit keine Prognosen, sondern Projektionen (synonym nach Cuhls 2012: Erwartung, Vorausschau). Dieser Unterschied wird am Beispiel der Klimamodellierung dargestellt, gilt aber umso mehr noch für die Stoffhaushaltsmodellierung und Abschätzungen künftiger Zustände der Pflanzendecke, da hier allenfalls subjektive bzw. qualitative Angaben über Eintrittswahrscheinlichkeiten möglich sind.
Der Zustand der Atmosphäre lässt für die nächsten Stunden und Tage vorhersagen (Wettervorhersage, -prognose; weather forecast). Hingegen sind Klimaprojektionen keine Zustandsberechnungen, sondern sie ermitteln die Statistik des Zustands der Atmosphäre. Während bei der Wettervorhersage z.B. das Eintreffen eines Extremereignisses so genau wie möglich vorhergesagt werden soll, geht es bei Klimaprojektionen um die Eintrittswahrscheinlichkeit von Extremereignissen über längere Zeit, z.B. die Häufigkeit von Starkwinden in einer Dekade. Der Grund hierfür und damit für den Unterschied zwischen Projektion und Vorhersage liegt in der Kenntnis des Klimaantriebs wie z.B. der Sonneneinstrahlung oder die Menge der Treibhausgasemissionen. Oft jedoch ist der Klimaantrieb nicht genau bekannt oder kann nur grob abgeschätzt werden, insbesondere wenn es um zukünftige Zeiträume geht. So ändern sich die Treibhausgasemissionen kurzfristig kaum, so dass bei der Wettervorhersage aktuelle Treibhausgaskonzentrationen ausreichend sind. Zukünftige Klimaentwicklungen vorauszuberechnen erfordert Annahmen über die künftige Emission von Treibhausgasen. Hierfür werden Informationen über die Entwicklung des Wirtschafts- und des Bevölkerungswachstums benötigt und zu plausiblen Annahmen (Szenarien) für die Klimasimulationen verdichtet. Die Klimaprojektionen dienen nicht zur Vorhersage von Atmosphärenzuständen im Sinne einer Wettervorhersage, sondern zur Darstellung von unter bestimmten Randbedingungen (Szenarien) zu erwartenden Klimaentwicklungen.
Hierfür werden globale und regionale, auf einen bestimmten geographischen Ausschnitt der Erde zugeschnittene Klimamodelle entwickelt. Die Unsicherheit der Berechnungen steigt mit ihrer zeitlichen und räumlichen Aussagereichweite. Beispiele regionaler Modelle sind u.a. REMO (Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg), STAR (statistisches Modell des PIK) und WETTREG (Wetterlagen-basierte Regionalisierungsmethode, CEC Potsdam GmbH).
1.2 Durchführung
Um einschätzen zu können, ob die in Teil I der Artikelserie (Jenssen et al. 2015) dargestellten Wald- und Forstökosystemtypen bei Klimawandel und atmosphärischen Stickstoffeinträgen strukturell und funktional stabil bleiben oder sich ihre bisherige ökosystemtypische Integrität so sehr verändert und sie sich zu einem neuen Ökosystemtyp weiterentwickeln, wird für sieben Standorte aus drei Regionen Deutschlands (Abb. 1) mit dem numerischen Modell VSD (Posch & Reinds 2009) die Entwicklung folgender Indikatoren geschätzt, die für Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Wald- und Forstökosysteme bedeutsam sind und für die Daten aus Umweltbeobachtungsprogrammen verfügbar sind:
der Gehalt an organischem Kohlenstoff im Bodenblock 0–30 cm Tiefe (einschl. organischer Auflage) als Indikator für die Kohlenstoffspeicherung;
das C/N-Verhältnis, pH-Wert und Basensättigung als Indikatoren für den Nährstofffluss;
die Feuchtekennzahl als Indikator für den Wasserfluss.
Die für die in Teil I der Artikelserie dargestellte Ökosystemtypisierung berücksichtigten Ökosystemfunktionen Nettoprimärproduktion, Lebensraum und Anpassungsfähigkeit an veränderliche Umweltbedingungen konnten im Gegensatz zu den dafür auch verwendeten ökologischen Funktionen Kohlenstoffspeicherung, Nährstoffhaushalt und Wasserfluss mit VSD nicht direkt berechnet werden. Doch verknüpft man die Projektionen der mit VSD modellierbaren Indikatoren dieser drei zuletzt genannten ökologischen Funktionen mit den der Ökosystemtypologie hinterlegten Kenntnissen, sind Schätzungen zukünftig möglicher Ausprägungen für diese Ökosystemfunktionen möglich (Jenssen et al. 2013).
Für die Modellierung wurden sieben Standorte als Repräsentanten von Regionen Deutschlands ausgewählt, für die nach dem Stand der Kenntnis zu erwarten ist, dass sie sensibel auf klimatische Veränderungen und erhöhte Stickstoffdepositionen reagieren und einen großklimatischen Gradienten abbilden. Es handelt sich um vier Standorte aus dem ICP Forests Level II-Programm und drei Standorte aus der Vegetationsdatenbank des Waldkunde Instituts Eberswalde (W.I.E.). Für diese wurde die Ausprägung der in Teil I der Artikelserie näher erläuterten Indikatoren für das Jahr, für das Messwerte zu relevanten Eingabegrößen zur Verfügung stehen, und die Zeitfenster 2011-2040 sowie 2041-2070 berechnet (Jenssen et al. 2013). Folgende Modellregionen wurden durch Standorte bei den Modellierungen berücksichtigt (Abb. 1): nordöstliches Brandenburg (Modellregion 1), südliches Brandenburg und nördliches Sachsen (Modellregion 2) sowie Thüringer Wald (Modellregion 3).
2 Verwendete Daten und Modellierungstechnik
Von den für die Ökosystemtypisierung indizierten ökologischen Funktionen Nettoprimärproduktion, Lebensraum und Anpassungsfähigkeit an veränderliche Umweltbedingungen, Kohlenstoffspeicherung, Nährstoffhaushalt und Wasserfluss (Teil I der Artikelserie) konnten die drei zuletzt genannten mit VSD+ berechnet werden. Die Quantifizierung des Gehalts an organischem Kohlenstoff als Indikator für die Kohlenstoffspeicherung, das C/N- Verhältnis, der pH-Wert und die Basensättigung als Indikatoren für den Nährstofffluss sowie die Feuchtekennzahl als Indikator für den Wasserfluss dienen der Erfassung der Ökosystemfunktionen Nettoprimärproduktion, Kohlenstoffbindung sowie Nährstoff- und Wasserfluss. Sie basiert auf Klimaprojektionen mit dem statistischen Klimamodell STAR II für die Szenarien RCP (= Representative Concentration Pathways) 2.6 und 8.5 (Moss et al. 2008), Daten zur atmosphärischen Deposition der Jahre 1880-2010 aus dem European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) und auf zwei Szenarien atmosphärischer Deposition (5 kg/ha a, 15 kg/ha a N-Deposition für Jahre nach 2010).
Dabei wurden die Klimadaten derjenigen Station aus dem DWD-Messnetz verwendet, die die geringste Distanz zum jeweiligen Modellstandort aufweist.
Für den Zeitraum zwischen dem ersten Beobachtungsjahr und 2010 wurden Messdaten des DWD eingesetzt, für die Zeiträume 2011-2040 sowie 2041-2070 die STAR II-Ergebnisse für die RCP-Szenarien. Aus den für jede DWD-Messstation 100 berechneten Szenarioläufen wurden in dieser Untersuchung die Daten desjenigen Laufes verwendet, der das 95-%-Quantil beschreibt. Das RCP 8.5-Szenario unterstellt, dass keine Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden und dass Wirtschaftswachstum wie bisher auf der Verbrennung fossiler Energieträger beruht. Das Szenario RCP 2.6 nimmt den sofortigen Stopp aller Treibhausgasemissionen an. Die Szenarien berücksichtigen alle Treiber zukünftiger anthropogener Treibhausgasemissionen und das Ausmaß des daraus resultierenden atmosphärischen Strahlungsantriebs. Ein anthropogener Strahlungsantrieb von 8.5 W/m2 (RCP 8.5) ist sehr hoch, hingegen sind 2.6 W /m2 (RCP 2.6) sehr niedrig. Auf Grundlage der RCPs werden mit Klimamodellen wie STARs neue Projektionen möglicher Klimaveränderungen im 21. Jahrhundert und darüber hinaus berechnet (Moss et al. 2010).
Die für die Modellierung eingesetzten historischen Depositionsdaten für SOx, NOx und NH3 stammen aus der Datenbank des EMEP (Tørseth et al. 2012). Die atmosphärischen Einträge von Ca, Mg, K, Na und Cl wurden für den Zeitraum 1981-1994 für zwei in Niedersachsen gelegene Untersuchungsflächen von Meesenburg et al. (1995) übernommen. Der zeitliche Verlauf der Deposition von Ca, Mg, K, Na und Cl wurde nach Wochele et al. (2010) modifiziert. Abb. 2 veranschaulicht die für die Berechnungen berücksichtigte Entwicklung der atmosphärischen Deposition am Modellstandort LII-1605 für den gesamten Simulationszeitraum 1905-2070.
Das Depositionsszenario von 5 kg N/ha geht von einer fortlaufenden Abnahme des atmosphärischen Stickstoffeintrags nach 1985 aus, während im Szenario mit einer Deposition von 15 kg N/ha die eingetragene Stickstoffmenge nach 2010 wieder ansteigt (Abb. 2). Die Deposition von SOx nimmt nach 1987 stark ab.
Die VSD-Modellierungsergebnisse werden dazu verwendet, den Zustand des jeweiligen Ökosystemtyps in den Zeitintervallen 2011-2040 sowie 2041-2070 zu projizieren. Für die Modellierung wurde die Version 3.6.1.2 VSD+ (VSDplus) (Fa. Alterra; Posch & Reinds 2009) des Very Simple Dynamic (VSD) Soil Acidification Model verwendet. Den Simulationen mit dem VSD+ Model vorangestellt ist die Anwendung der Applikationen GrowUp und MetHyd (Fa. Alterra, Posch & Reinds 2009), mit denen die erforderlichen Eingabegrößen für die Parametrisierung des VSD-Models berechnet werden.
Das GrowUp-Model liefert die Parametrisierung für das Pflanzenwachstum (Biomassezuwachs), den Streufall, die Nährstoffaufnahme der Vegetation (N, Ca, Mg und K) und die Nährstoffrückführung (N und C) über Streufall und Abbau in den Boden. Der Modellanwender muss hierfür u.a. folgende Inputgrößen bereitstellen: zeitlich differenzierte Angaben zur N-Deposition, zum jährlichen Stammwachstum und zur Nutzung (Pflanztermin, Durchforstung, Abholzung).
Biomassezuwachs und Streufallmengen werden über Angaben zum Stammzuwachs berechnet, der wiederum durch Funktionen aus dem Datenspeicher Wald 2-Programm ( http://www.dsw2.de/index.html ) ermittelt wurde. Das Programm bildet allerdings diesbezüglich keine Wechselwirkungen mit der Höhe der Stickstoffdeposition und dem Klima ab. Das bedeutet, dass für den Biomassezuwachs und die Streufallmengen in alle Klimaszenarien dieselben Werte eingehen und der Indikator Durchschnittliche Nettoprimärproduktion an Baumholz (Teil I dieser Artikelserie) nicht durch die Modellierung mit VSD abgebildet werden kann. Die Mengen an aufgenommenem und zurückgeführtem Stickstoff werden an den Verlauf der Stickstoffdeposition angepasst und nehmen unterschiedliche Werte in den verschiedenen Depositionsszenarien ein.
Als Durchforstungsmaßnahme wurde der Anteil des ausscheidenden Bestandes am Gesamtbestand spezifiziert, der ebenfalls mit Funktionen aus dem Datenspeicher Wald 2-Programm berechnet wurde. Die Entnahme von Baumkompartimenten (Durchforstung) wird in Intervallen von fünf Jahren angegeben. Dabei werden die Stämme des ausscheidenden Bestandes dem System entnommen, Blätter, Äste und Wurzeln bleiben enthalten. Während des gesamten Simulationszeitraums kommt es zu keiner Endnutzung durch Kahlschlag, damit der zukünftige Zustand des Ökosystems unter möglichst geringem anthropogenen Einfluss abgeschätzt werden kann.
MetHyd ist ein hydrologisches Modell zur Berechnung der täglichen Evapotranspirationsrate, der Bodenfeuchte und -temperatur sowie der Niederschlagsüberflussmenge (= Niederschlagsmenge abzüglich der Evaporation). Die Variablen wurden aus meteorologischen Daten (Monatswerte von Lufttemperatur, Niederschlagsmenge, Sonnenstunden) sowie Daten zur Bodentextur (Sand-, Tonanteil, Rohdichte) und zum Corg-Gehalt ermittelt. Zusätzlich werden Faktoren kalkuliert, die beschreiben, wie Bodenfeuchte und -temperatur die Mineralisierung, Nitrifikation und Denitrifikation modifizieren. Neben der Bodenfeuchte und -temperatur und der Durchflussmenge sind auch diese Kenngrößen bei der Parametrisierung von VSD als Eingabegrößen erforderlich. MetHyd berechnet den Bodenwassergehalt und die aktuelle Evapotranspiration. In MetHyd werden keine Wechselwirkungen des Bodenwasserhaushalts mit der Vegetation (z.B. Wasseraufnahme durch Pflanzen, Interzeption) abgebildet. Dies ist als Einschränkung bei der Ergebnisbewertung zu berücksichtigen.
Die Modellierung in VSD wurde für die obersten 30cm des Bodens einschließlich der organischen Auflage durchgeführt. Denn dieses Bodenkompartiment ist der Hauptort für Durchwurzelung, Nährstoffaufnahme sowie N- und C-Kreislauf (Teil I dieser Artikelserie). Die Eingabewerte für die Bodenparameter Bodendichte, C/N-Verhältnis, Kationenaustauschkapazität, Basensättigung, Austauschkonstanten, Konzentration an organischen Säuren und CO2-Druck in der Bodenlösung wurden als ein nach der Trockenrohdichte und der Mächtigkeit der in diesem Bodenausschnitt liegenden Horizonte gewichteter Mittelwert berechnet. Für flächenbezogene Eingabewerte der C- und N-Pools wurden die Werte aller im Bodenausschnitt liegenden Horizonte aufsummiert. Zur Berechnung der hydrologischen Eigenschaften wurde in MetHyd die organische Auflage nicht berücksichtigt, da diese nicht getrennt vom Mineralboden behandelt werden kann, sondern eine Mittelung der Werte der Auflage und des Mineralbodens vorgenommen werden müsste. Deshalb wurden in MetHyd nur für die mineralischen Horizonte gewichtete Mittelwerte für die benötigten Eingabegrößen berechnet.
Die Modellierungsergebnisse wurden in VSD anhand vorliegender Messwerte (observation data) kalibriert. Beispielsweise ermöglichen Messwerte für Basensättigung und pH-Wert die Kalibrierung der Austauschkonstanten, Initialwerte für das C/N-Verhältnis und den C-Pool können über Messwerte zum C/N-Verhältnis und zum C- und N-Pool kalibriert werden.
Weitere Eingangsgrößen (z.B. CO2-Partialdruck in der Bodenlösung, Austauschkonstanten) wurden nach Gleichungen gemäß UNECE Convention on Long-range transboundary air pollution (2004) quantifiziert. Die Verwitterungsraten wurden nach van der Salm et al. (1998) berechnet. Für einige weitere Eingabegrößen (z.B. Angaben zu C/N-Verhältnissen unterschiedlicher Corg-Kompartimente) wurden die in VSD empfohlenen Standardwerte übernommen, da in den zugänglichen Datenbanken keine entsprechenden Messwerte vorliegen. Werte für die Bodendichte, Sand- und Tongehalt, Corg-Gehalt, C-Pool, C/N-Verhältnis, Kationenaustauschkapazität und Basensättigung entstammen den Datenbanken des International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Level II) und des Waldkunde-Instituts Eberswalde (W.I.E.).
3 Ergebnisse und Interpretation
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Modellierung exemplarisch für den Standort LII-1605 dargestellt. Dieser befindet sich in der Modellregion 3 auf dem Großen Eisenberg (Kammlage des Thüringer Waldes) (Höhe: 900 m ü. NN) (Abb. 1). Dominante Baumart ist die Rot-Fichte (Picea abies) mit einer Deckung von 100 %. Gegenwärtiger Ökosystemtyp ist ein Rohhumus-Fichten-Hochbergwald (C4-6d-B1), der dem potenziell natürlichen Ökosystemtyp (Jenssen et al. 2013) entspricht, d.h. dem unter heutigen Standort- und Umweltbedingungen in Selbstorganisation sich ausbildenden Ökosystemtyp. Der Bestand ist im Jahr 1995 der Altersklasse 81-100 Jahre zuzuordnen und wurde etwa 1905 gepflanzt. Dauerfrische Rohhumusstandorte der montanen, laubwaldfreien Höhenstufe kennzeichnen diesen Ökosystemtyp. Als Bodentyp hat sich eine Braunerde ausgebildet. Tab. 1 gibt einen Überblick der Datengrundlagen, Ergebnisse und Interpretation der Modellierung.
Klima und Bodenwassergehalt
Die mit STAR II berechnete mittlere Jahrestemperatur erhöht sich in den Szenarien RCP 2.6 und 8.5 um 0,5 bzw. 0,8 K im Zeitraum 2011-2040 und um 0,7 K bzw. um 2,3 K im Zeitraum 2041-2070 gegenüber dem Zeitraum 1995-2010 (Tab. 1). Ein Anstieg der Jahresmitteltemperatur um 0,6K entspricht in der Modellregion unter bisherigen Klimabedingungen einer Verringerung der Höhenlage der Isotherme von 100 m (Hofmann 1974). Das Szenario RCP 2.6 bewirkt in der Periode 2011-2040 eine Abnahme des Niederschlags um 23mm/Jahr, in der Periode 2041-2070 eine Zunahme um 38 mm/Jahr. Der modellierte Verlauf der aktuellen Evapotranspiration lässt eine Zunahme von 376 mm/Jahr im Zeitraum 1995-2010 auf 409 mm/Jahr erwarten (Zeitraum 2041-2070). Der Bodenwassergehalt bleibt während des gesamten Zeitraums unverändert bei 38 %. Der sehr humide Klimacharakter und die Zuordnung des Ökosystemtyps zum Wasserhaushaltstyp „dauerfrisch“ (6d) bleibt somit erhalten.
Die STAR II-Berechnungen für das Szenario RCP 8.5 ergeben, dass der mittlere Jahresniederschlag um 19 bzw. 16mm sinkt und die Evapotranspiration um 19 bzw. 54mm ansteigt. Folge ist eine geringfügige Abnahme des Bodenwassergehalts. Die Abnahme der Niederschläge in der Vegetationsperiode bewirkt eine Veränderung des Wasserhaushaltstyps zu „mittelfrisch“ (5 n). Durch den drastischen Anstieg der Jahresmitteltemperatur ist der Hochbergwald in ökoklimatischer Hinsicht zukünftig der montanen Klimaregion (Dg) zuzuordnen.
Nährstoffhaushalt
Es ist zu vermuten, dass der Standort LII-1605 in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts langjährig anhaltend hohen Einträgen von Säuren und Stickstoffverbindungen ausgesetzt war, die zu Disharmonien in der Ernährung des Fichtenbestands geführt hatten. Die Basensättigung nimmt nach 2010 zu und unter dem Einfluss des unterstellten Depositionsgeschehens (Abb. 2) steigen die Basensättigung von 14,9–15,0 % in den Jahren 1995-2010 und auf 17,0–18,4 % bis zum Jahr 2070 sowie der pH-Wert von pH 4–4,2 1995-2010 auf ca. pH 4,8 im Zeitintervall 2041-2070 an (Tab. 1).
Kohlenstoff-Speicherung
Aufgrund ansteigender C-Mengen im Boden kommt es in allen Szenarien zu einer kontinuierlichen Erweiterung des C/N-Verhältnisses (30,3-35,0 im Jahr 2070) (Tab. 1). Damit würde sich das Ökosystem im Hinblick auf Oberbodenzustand und Ernährungszustand wieder dem Referenzzustand annähern, also eine reversible Entwicklung zeigen.
Lebensraumfunktion
Die untersuchten Klimaszenarien zeigen, dass sich aus dem derzeitigen Rohhumus-Fichten-Hochbergwald (C4-6d-B1) ein Rohhumus-Fichten-Bergforst (Dg-5n / 6d-b1) entwickeln könnte (Jenssen et al. 2013). Die Erwärmung in der Vegetationsperiode führt zu einer deutlich erhöhten Wuchsleistung der Baumart Fichte. Allerdings würde sich unter diesen klimatischen Bedingungen in Selbstorganisation die Buche auf diesem Standort durchsetzen und den Fichtenanteil in der oberen Baumschicht deutlich reduzieren. Die Fichte wäre damit nicht mehr die potenzielle natürliche Hauptbaumart auf diesem Standort (Jenssen et al. 2013).
Mit dem erwarteten Klimawandel geht an diesem Standort auch der Lebensraumtyp 9410 des Anhangs I der FFH-Richtlinie unwiederbringlich verloren.
Einstufung der Ökosystemveränderungen und Maßnahmen zur Erhöhung der Anpassungsfähigkeit
Unter den angenommenen Kima- und Depositionsszenarien würde sich der Fichtenbestand an diesem Standort nicht akut verändern. Allerdings berücksichtigen die Klimaszenarien nicht das gehäufte Auftreten von Extremereignissen (z.B. Windwurf, Schneebruch, Schaderregerkalamitäten). Da sich der potenzielle natürliche Ökosystemtyp unter den angenommenen Szenarien in Richtung eines Rohhumus-Buchen-Bergwalds (D1-6d-B2) entwickeln würde, könnte die Anpassungsfähigkeit des Ökosystems durch Einbringung bzw. Förderung der Baumart Buche verstärkt werden.
Die Modellierungsergebnisse für die hier nicht im Einzelnen dargestellten sechs Modellstandorte zeigen z.T. Veränderungen auf Indikator-, Funktions- und Ökosystemebene und legen Bewirtschaftungsempfehlungen nahe: Die W.I.E.-Standorte Kahlenberg 75 (aktueller Ökosystemtyp: Rohhumusmoder-Kiefernforst), Biesenthal 1534a (aktueller Ökosystemtyp: Moder-Sand-Traubeneichen-Buchenwald) und Peitz 150 (aktueller Ökosystemtyp: Subkontinentaler Rohhumus-Kiefernforst) unterliegen keiner gravierenden Veränderung. Auf allen Standorten sollte der Laubbaumanteil gefördert werden bzw. sollten weitere Laubbaumarten angepflanzt werden, um die Anpassungsfähigkeit an den weiteren Klimawandel (z.B. steigende Brandwahrscheinlichkeit) zu erhöhen.
Auch der LII-Standort 1405 (aktueller Ökosystemtyp: Rohhumus-Kiefernforst) ist einer geringen Veränderung ausgesetzt, jedoch kann unter höheren Stickstoffeinträgen zukünftig mit einem disharmonischen Ernährungszustand für die dort auftretende Kiefer gerechnet werden. Dem wirkt eine Förderung des Laubbaumanteils entgegen. Auf dem LII-Standort 1609 (aktueller Ökosystemtyp: Moder-Fichten-Bergforst) ist durch das humide Klima und der standortfremden Fichtenbestockung mit einer zunehmenden Versauerung des Oberbodens zu rechnen. Die Förderung des Laubbaumanteils würde der Versauerung entgegenwirken. Auf dem LII-Standort 1602 (aktueller Ökosystemtyp: Moder-Fichten-Tannen-Buchen-Hochbergwald) ist bei erhöhten Stickstoffeinträgen ein Rückgang und sogar ein Totalverlust stickstoffempfindlicher Pflanzenarten möglich.
4 Diskussion
Grundsätzlich ist zu bedenken, dass die Ergebnisse der Modellierung mit VSD wie auch die Ergebnisse der Klimamodellierungen, die als Eingangsdaten in die VSD-Berechnungen eingehen, keine Vorhersagen im strengen Sinne sind. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind vielmehr Projektionen (Cuhls 2012: Erwartung, Vorausschau). Die dynamische Modellierung ermöglicht die Projektion zukünftiger bodenchemischer Zustände als Teil zukünftiger Zustandsveränderungen von Wald- und Forstökosystemen unter Berücksichtigung von Klima- und Depositionsszenarien. Solche Projektionen zusammen mit der prädiktiven Kartierung und Einschätzung der Ökosystemintegrität (Teile I und III dieser Artikelserie) sind für vorsorgeorientierten Natur- und Umweltschutz bedeutsam (Jenssen et al. 2013, Schröder et al. 2002). Anhand der Modellierungsergebnisse kann abgeschätzt werden, ob sich ein Ökosystemtyp durch Klimawandel und atmosphärische Stickstoffeinträge gegenwärtig oder zukünftig wesentlich verändern wird. Ist dies aktuell zu beobachten oder zukünftig zu erwarten, können frühzeitig gegensteuernde Maßnahmen – jeweils angepasst an die besonders stark veränderten Indikatoren – abgeleitet werden.
Die Referenzwerte für die Indikatoren C/N-Verhältnis, pH und Basensättigung beziehen sich in der Vegetationsdatenbank des W.I.E. auf die obersten 5cm des Bodens (Auflagehorizont) und für die Kohlenstoffspeicherung auf den Bodenausschnitt 0–80cm Tiefe zuzüglich der organischen Auflage, während die Modellierung für die obersten 30cm des Bodens einschließlich der organischen Auflage durchgeführt wurde. Ein direkter Vergleich der Modellierungsergebnisse mit den Werten des Referenzzustands ist also nicht möglich. Die Interpretation der Ergebnisse wird daher zusätzlich durch Expertenwissen gestützt (Jenssen et al. 2013). In weiterführenden Forschungsvorhaben sollen die Modellläufe derart konzipiert werden, dass die Modellergebnisse mit den Ansprüchen der Referenzdaten übereinstimmen.
Die Szenarien der N-Deposition sind nicht genau auf den Standort zugeschnitten. Dies sind Aussagen über potenzielle zukünftige Entwicklungen von Systemen unter sich wandelnden Randbedingungen. Im Gegensatz zu Vorhersagen sind Projektionen geradezu dadurch gekennzeichnet, dass signifikante Änderungen der das betrachtete System steuernden Randbedingungen im Zeitverlauf auftreten können oder sehr unterschiedliche Ausprägungen der Steuergrößen möglich sind. Für jedes solcher Szenarien erfolgen Berechnungen, deren Ergebnisse durch die Szenarien konditionierte Erwartungen zukünftiger Systemzustände darstellen. So bildet das Szenario mit einer Deposition von 5kg N/ha a in etwa ein anzustrebendes, sehr niedriges Depositionsniveau ab, das Szenario mit einer Deposition von 15 kg N/ha a in etwa die derzeitig für Gesamt-Deutschland vorherrschende durchschnittliche Depositionsmenge, die bei Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zur Luftreinhaltung erreicht wird.
Dank
Die Autoren danken dem Umweltbundesamt für die finanzielle Förderung des Projekts sowie Gudrun Schütze und Dr. Jakob Frommer für eine konstruktive fachliche Begleitung. Ebenfalls bedanken sich die Verfasser bei Max Posch (Ministry of Health, Welfare and Sport, Niederlande), Gert Jan Reinds und Luc Bonten (Alterra Wageningen UR) für die Unterstützung bei der Modellierung.
Literatur
Cuhls, K. (2012): Zukunftsforschung und Vorausschau. In: Koschnick, W.J., Hrsg., FOCUS-Jahrbuch 2012, Prognosen, Trend- und Zukunftsforschung, Focus Magazin, München, 319-339.
Hofmann, G. (1974): Die natürliche Waldvegetation Westthüringens, ihre Gliederung und ihr Weiserwert für Boden, Klima und Ertrag. Institut für Forstwissenschaften Eberswalde. Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Eberswalde, 1-526.
Jenssen, M., Hofmann, G., Nickel, S., Pesch, R., Riediger, J., Schröder, W. (2013): Bewertungskonzept für die Gefährdung der Ökosystemintegrität durch die Wirkungen des Klimawandels in Kombination mit Stoffeinträgen unter Beachtung von Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen. Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Forschungsvorhaben 3710 83 214, UBA-FB 001834. UBA-Texte 87/2013. Dessau, Textband + 9 Anhänge, 1-381.
–, Schröder, W., Nickel, S. (2015): Typisierung von Wald- und Forstökosystemen als Grundlage zur Einstufung ihrer Integrität. Integrität von Wald- und Forstökosystemen unter dem Einfluss von Klimawandel und atmosphärischen Stickstoffeinträgen – Teil I. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (12), 391-399.
Meesenburg, H., Meiwes, K.J., Rademacher, P. (1995): Long term trends in atmospheric deposition and seepage output in Northwest German forest ecosystems. Water, Air Soil Pollut. 85, 611-616.
Moss, R., Babiker, M., Brinkman, S., Calvo, E., Carter, T., Edmonds, J., Elgizouli, I, Emori, S., Erda, L., Hibbard, K., Jones, R., Kainuma, M., Kelleher, J., Lamarque, J. F., Manning, M., Matthews, B., Meehl, J., Meyer, L., Mitchell, J., Nakicenovic, N., O’Neill, B., Pichs, R., Riahi, K., Rose, S., Runci, P., Stouffer, R., Vuuren, D.v., Weyant, J., Wilbanks, T., Ypersele, J.P.v., Zurek, M. (2008): Towards new Scenarios for analysis of emissions, climate change, impacts, and response strategies. Technical Summary. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, 1-25.
–, Edmonds, J.A., Hibbard, K.A., Manning, M.R., Rose, S.K., van Vuuren, D.P., Carter, T.R., Emori, S., Kainuma, M., Kram, T., Meehl, G.A., Mitchell, J.F.B., Nakicenovic, N., Riahi, K., Smith, S.J., Stouffer, R.J., Thomson, A.M., Weyant, J.P., Wilbanks, T.J. (2010): The next generation of scenarios for climate change research and assessment. Nature 463, 747-756.
Obrecht, W. (2007): Was ist Wissenschaft? Der Wissenschaftliche Realismus als postpositivistischer Wissenschaftsbegriff der Natur-, Sozial- und Handlungswissenschaft. Vortrag im Arbeitskreis Sozialarbeitsforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit, Basispapier für die Sitzung vom 2. März 2007 in Frankfurt/Main, 1-34.
Posch, M., Reinds, G.J. (2009): A very simple dynamic soil acidification model for scenario analyses and target load calculations. Environ. Model. & Softw. 24, 329-340.
Prim, R., Tilmann, H. (2000): Grundlagen einer kritisch-rationalen Sozialwissenschaft. 8. Aufl., Wiesbaden.
Schröder, M., Grunwald, A., Clausen, M., Hense, A., Lingner, S., Klepper, G., Ott, K., Schmitt, D., Sprinz, D. (2002): Klimavorhersage und Klimavorsorge. Ethics of Science and Technology Assessment 16, 1-493.
Schröder, W. (2015): Integrität von Wald- und Forstökosystemen unter dem Einfluss von Klimawandel und atmosphärischen Stickstoffeinträgen – Teile I – III. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (12), 389-390.
–, Pesch, R. (2013): Hypothesenprüfung in der Landschaftsökologie. In: Schröder, W., Fränzle, O., Müller, F., Hrsg., Handbuch der Umweltwissenschaften, Grundlagen und Anwendungen der Ökosystemforschung, Kap. V-1.1, 22. Erg.-Lfg., Wiley-VCH, Weinheim, 1-10.
Tørseth, K., Aas, W., Breivik, K., Faeraa, A.M., Fiebig, M., Hjellbrekke, A.G., Myhre, C.L., Solberg, S., Yttri, K.E. (2012): Introduction to the European Monitoruing and Evaluation Programme (EMEP) and observed atmospheric composition change during 1972-2009. Atmos. Chem. Phys. 12, 5447-5481.
UNECE Convention on long-range transboundary air pollution (2004): Manual on methodologies and criteria for modelling and mapping critical loads & levels and air pollution effects, risks and trends. UBA-Texte 52/04, Berlin, 1-266.
van der Salm, C., Köhlenberg, L., de Vries, W. (1998): Assessment of weathering rates in Dutch loess and river-clay soils at pH 3.5, using laboratory experiments. Geoderma, 41-62.
Wochele, S.M. (2010): Modellierung räumlich differenzierter Wirkungen von atmosphärischen Stoffeinträgen auf Stoffumsetzungen und Stoffausträge aus Waldökosystemen in Deutschland. Diss., Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften, Univ. Freiburg im Breisgau, 1-165.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen




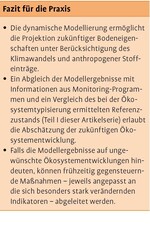
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.