Praxiserprobung eines neuen Bewertungsverfahrens für Biodiversitätsleistungen landwirtschaftlicher Betriebe
Abstracts
Im Naturpark Aukrug in Schleswig-Holstein wurde in einem einjährigen Pilotprojekt in Kooperation mit einem regionalen Landschaftspflegeverband analysiert, ob und wie ein neues Schnellverfahren zur Bewertung der Biodiversitätsleistungen landwirtschaftlicher Betriebe in Kombination mit einem regionsspezifischen Angebotskatalog für förderfähige Naturschutzmaßnahmen erfolgreich in die Naturschutzberatung integriert werden kann. Das Interesse der Landwirtschaftsbetriebe an der Biodiversitätsbewertung und -beratung war groß. 80 (67,2 %) von 119 kontaktierten Betrieben nahmen an dem Pilotprojekt teil. Das Schnellverfahren zeichnete sich im Rahmen der Erprobung durch ein einfaches Datenmanagement und einen sehr geringen Zeitbedarf für die Datenaufnahme und auswertung aus (durchschnittlich 25 min je Betrieb). Die gemeinsame Datenaufnahme durch Berater und Landwirt(in) ermöglichte einen guten Einstieg in die Naturschutzberatung und lieferte zudem erste Hinweise auf Maßnahmenumsetzungen. Durch die Kombination mit dem Angebotskatalog war es möglich, bereits während der Projektlaufzeit mit rund einem Drittel der Betriebe Maßnahmen zu vereinbaren. Für mögliche zukünftige Anwendungen des Schnellverfahrens empfehlen sich aufgrund der Projekterfahrungen insbesondere die Bearbeitungsgebiete von Organisationen, die aufgrund ihrer Arbeit bereits als lokale Naturschutzpartner der Landwirtschaft etabliert sind.
Trial Run of a New Evaluation Method for Biodiversity Services of Farms – Proposal of advisory services for nature conservation
A one-year pilot project has been conducted in the nature park Aukrug in Schleswig-Holstein in cooperation with a regional landcare group. The study analyses if and how a new fast procedure to evaluate biodiversity services of farms in combination with a regional catalogue offering eligible nature conservation measures can be successfully integrated into advisory services for nature conservation.
The regional farmers showed great interest in the evaluation and consultation of biodiversity. Eightly out of 119 farms addressed (67.2 %) participated in the pilot project. The fast procedure stood out due to its simple management and the very short time require for the collection and analysis of data (in average 25 min per farm). The joint data collection of both adviser and farmer made a good start for advisory services for nature conservation and additionally provided first hints on possible measures to be implemented. The combination with the catalogue of possible measures lead to agreements on detailed conservation measures with about one third of the farms already during the course of the project. The experiences allow the conclusion that in future the fast procedure should preferably be applied in those regions that have established organizations dealing as local nature conservation partners of agriculture.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
In den Jahren 2011/12 wurde in Schleswig-Holstein ein Bewertungsverfahren entwickelt, durch das anhand ausgewählter Indikatoren zur Flächenbewirtschaftung und Ausstattung mit Landschaftselementen die Bedeutung einzelner landwirtschaftlicher Betriebe für wild lebende Pflanzen und Tiere eingeschätzt wird („Biodiversitätswert“). Details zu dem Verfahren finden sich in Abschnitt 2.2 sowie bei Neumann & Dierking (2014).
Um zu überprüfen, ob die Anwendung des Schnellverfahrens in Kombination mit einem regionsspezifischen Angebotskatalog für Naturschutzmaßnahmen (Naturschutzring Aukrug 2011, siehe Abschnitt 2.2) erfolgreich in eine gesamtbetriebliche Naturschutzberatung integriert werden kann, hat der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) im Jahr 2013 ein Pilotprojekt durchgeführt. In dem Modellvorhaben sollte ermittelt werden, welche grundsätzliche Bereitschaft der Landwirte besteht, ein solches Verfahren anzuwenden. Neben der Praxistauglichkeit des Schnellverfahrens sollte in dem Pilotprojekt zudem getestet werden, ob das Verfahren zielführend im Rahmen der einzelbetrieblichen Naturschutzberatung und Maßnahmenakquise eingesetzt werden kann.
Die Ergebnisse des Pilotprojekts werden in dem vorliegenden Beitrag dargestellt.
2 Material und Methoden
2.1 Teilnehmerakquise
Das Modellvorhaben wurde in Kooperation mit dem Naturschutzring Aukrug e.V. durchgeführt, da dieser bereits über umfangreiche Erfahrungen in der Naturschutzberatung und Maßnahmenumsetzung auf landwirtschaftlichen Betrieben verfügt. In dem Verein, der 2001 gegründet wurde, arbeiten Landwirtschaft, Kommunen und Naturschutz gleichberechtigt zusammen (siehe „Drittelparität“ der Landschaftspflegeverbände, Metzner 2013). Die Geschäftsführung des Naturschutzrings wird durch das Land Schleswig-Holstein finanziell gefördert. Ziel der Zuwendung (Personal-, Nebenkosten), die durch die EU kofinanziert wird, ist die Organisation, Koordinierung, Maßnahmeninitiierung und Umsetzungsbegleitung im Rahmen des Natura-2000-Managements (Boller et al. 2013).
Um u.a. die Schutzbemühungen für Arten zu unterstützen, die gemäß der FFH- und Vogelschutzrichtlinie zu schützen sind („europäische Arten“), hat der Naturschutzring im Jahr 2007 einen Maßnahmenkatalog entwickelt, der die bestehenden Fördermöglichkeiten bzw. angebote des Landes für Land- und Forstwirte übersichtlich zusammenfasst und zudem einige zusätzliche Maßnahmen beinhaltet, die speziell für die Region angeboten werden („Aukruger Weg“, siehe Abschnitt 2.2).
Seit dem Jahr 2011 erstreckt sich die Kulisse für den Angebotskatalog auf den gesamten Naturpark Aukrug (Naturschutzring Aukrug 2011), der somit auch als Gebiet für die Erprobung des Schnellverfahrens und die darauf aufbauende einzelbetriebliche Naturschutzberatung ausgewählt wurde. Der Naturpark Aukrug liegt im Zentrum der schleswig-holsteinischen Geest und umfasst 38400 ha (MUNF 1998; Landschaftseindruck s. Abb. 1).
Für die Durchführung des Modellprojekts im Jahr 2013 wurde ein Projektbearbeiter angestellt (½ Projektstelle), der die Akquise, Bewertung und Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe übernahm. Um Landwirtinnen und Landwirte für die Projektteilnahme zu gewinnen, wurde das Modellvorhaben zu Beginn in der Lokalpresse vorgestellt. Dieser Versuch der Teilnehmerakquise brachte nicht den erhofften Erfolg, so dass der Projektbearbeiter im Folgenden gezielt Kontakt mit landwirtschaftlichen Betrieben in der Region aufnahm. Die Akquise erfolgte über direkte Kontakte zu persönlich bekannten Betrieben, deren Befragung nach weiteren vermutlich aufgeschlossenen Betrieben vor Ort sowie auch unangemeldete Besuche auf Hofstellen.
Während des ersten Betriebsbesuchs wurden stets ein Infoblatt über das Projekt sowie der Maßnahmenkatalog „Aukruger Weg“ ausgehändigt. Nach dem ersten persönlichen Kontakt wurden die Betriebe nach einer 10- bis 14-tägigen Bedenkzeit noch einmal kontaktiert und bei Interesse ein Termin für ein Beratungsgespräch vereinbart, im Rahmen dessen die Eingangsdaten für das Schnellverfahren (Neumann & Dierking 2014) aufgenommen und ein Fragebogen (siehe Abschnitt 2.2) ausgefüllt wurden. Die Projektlaufzeit für die Teilnehmerakquise, Datenaufnahme und Naturschutzberatung betrug sieben Monate (März bis September).
2.2 Anwendung des Bewertungsverfahrens und Naturschutzberatung
Das Bewertungsverfahren, das im Naturpark Aukrug in Kombination mit dem Angebotskatalog erprobt wurde, ist für die Verhältnisse Schleswig-Holsteins konzipiert und wurde auf der Basis von Literaturangaben und einer Evaluierung durch Freilandindikatoren hergeleitet. Die Eingangsparameter des Schnellverfahrens werden dem Sammelantrag entnommen, den Landwirtschaftsbetriebe für die Beantragung der EU-Direktzahlungen erstellen. Zusätzlich werden Parameter aufgenommen, die sich aus Bewirtschaftungsvorgaben von Agrarumweltprogrammen ableiten. Das Indikatorsystem beinhaltet vier Kategorien (Nutzungstypen, Landschaftselemente, Acker, Grünland) mit insgesamt 17 Parametern. Die quantitative Ausprägung der einzelnen Eingangsgrößen wird durch Punktzahlen bewertet, auf deren Basis ein einzelbetrieblicher „Biodiversitätswert“ errechnet wird.
Um die Bewertungsergebnisse im Hinblick auf die jeweilige Betriebssituation besser einordnen zu können, wird zusätzlich das einzelbetriebliche „Biodiversitätspotenzial“ ermittelt. Dieser Wert ist definiert als der prozentuale Anteil der erreichten Gesamtpunktzahl an der Maximalpunktzahl, die unter praktischen Bedingungen erreichbar erscheint (theoretischer Maximalwert: 55 Punkte).
Referenz der Bewertungen sind die Effekte, welche die jeweiligen Maßnahmen unter den heutigen Bedingungen auf die Vielfalt und Häufigkeit wild lebender Arten in Schleswig-Holstein erwarten lassen. Ausführliche Erläuterungen zu dem Bewertungsverfahren finden sich in Neumann & Dierking (2014; Download unter http://www.nul-online.de Service Downloads).
Die Eingangsparameter für das Schnellverfahren wurden durch den Berater während des Betriebsbesuches erfragt bzw. gemeinsam mit dem/der Betriebsleiter(in) aus dem Sammelantrag ermittelt. Datengrundlage waren je nach Verfügbarkeit die Angaben aus dem Sammelantrag des Jahres 2012 oder 2013, in Einzelfällen musste auch auf Daten aus dem Jahr 2011 zurückgegriffen werden. Sofern auf dem Betrieb verfügbar, wurde die Sammelantrags-Software Profil inet für die Datenrecherche verwendet.
Im Rahmen der Naturschutzberatung wurde der o.g. Maßnahmenkatalog „Aukruger Weg“ vorgestellt und erläutert. Der Katalog beinhaltet ein breites Spektrum an förderfähigen Naturschutzmaßnahmen, das von Kleinmaßnahmen, wie z.B. der Anlage von Lesesteinhaufen oder der einjährigen Bereitstellung von Stoppeläckern, bis zu langfristigen Flächensicherungen (Pacht, Grunderwerb) reicht (Tab. 1). Der Finanzierung des Maßnahmenkatalogs liegen verschiedene Förderrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein zu Grunde.
Während des Beratungsgesprächs wurden dem/der Betriebsleiter(in) zudem standardisierte Fragen zur Motivation für die Projektteilnahme und allgemeinen Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen sowie zur Beurteilung des Schnellverfahrens gestellt (Fragebogen mit vorgegebenen Antwortkategorien, siehe Ergebnisse). Als Parameter für die Praxistauglichkeit des Bewertungsverfahrens vermerkte der Berater zudem den Zeitbedarf für die Datenaufnahme. Wenn der/die Landwirt(in) ein konkretes Interesse an der Umsetzung von Maßnahmen hatte, wurden die Vorschläge gemeinsam mit dem Berater vor Ort begutachtet und diskutiert. Vereinbarte Maßnahmen wurden an den Naturschutzring weitergeleitet, der unter Beteiligung des Beraters die erforderlichen weiteren Schritte einleitete und auch begleitete (Vorbereitung Förder-/Genehmigungsanträge, Abstimmungen mit Behörden, Vor-Ort-Termine, Baubegleitung).
3 Ergebnisse
3.1 Teilnehmerakquise und Stichprobe
Insgesamt wurden durch den Berater in der Projektregion im Bearbeitungszeitraum 119 Betriebe angesprochen. Die Terminfindung für das Erstgespräch erwies sich vor allem in den Zeiten von Arbeitsspitzen (Bestellung, Ernte) als schwierig. Die subjektive Ersteinschätzung des Beraters über die Haltung der angesprochenen Betriebsleiter zum Naturschutz und dem Pilotprojekt ergab folgende Gruppierung:
75 Betriebe (63,0 %) waren überwiegend interessiert und äußerten Zuspruch,
31 Betriebe (26,1 %) zeigten generelles Interesse, hatten jedoch auch Vorbehalte,
13 Betriebe (10,9 %) hatten kein Interesse und zeigten eine eher ablehnende Haltung.
Diese Einschätzung spiegelt in etwa die Zahl der tatsächlichen Teilnehmer an dem Pilotprojekt wider:
80 Betriebe (67,2 %) wurden bewertet und beraten,
36 Betriebe (30,3 %) wollten oder konnten nicht teilnehmen,
mit 3 Betrieben (2,5 %) konnten im Bearbeitungszeitraum keine weiteren Termine vereinbart werden.
Ein Großteil der Betriebe, die nicht an der Betriebsbewertung teilnehmen wollten/konnten, äußerte eine allgemeine Skepsis bzw. ablehnende Haltung gegenüber dem Naturschutz oder hatte generell kein Interesse an der Thematik (Abb. 2). Weitere maßgebliche Gründe für die Ablehnung der Projektteilnahme waren Zeit- sowie auch Flächenmangel für mögliche Maßnahmenumsetzungen. Die Betriebe, die an dem Projekt teilnahmen, wurden entsprechend dem gewählten Vorgehen (siehe oben) vorrangig durch eine direkte Ansprache akquiriert (Abb. 3). Ein Drittel der teilnehmenden Betriebe gab an, sich aus Interesse an Naturschutzmaßnahmen an dem Projekt zu beteiligen. Weitere Beweggründe waren zu etwa gleichen Anteilen die Erwartung, durch die Teilnahme „betriebsinterne Vorteile“ und/oder „mehr Wissen über den eigenen Betrieb“ zu erlangen (Abb. 4).
Unter den Projektbetrieben dominieren analog zum Vorkommen in der Region Milchviehbetriebe (Abb. 5). Sechs (4,8 %) der teilnehmenden Betriebe wirtschaften nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Die Projektbetriebe haben eine durchschnittliche Gesamtflächengröße (brutto) von rund 100 ha (Mittel 109, Median 98, Standardabweichung 89, Standardfehler 10, Minimum 4, Maximum 657 ha, n = 80 Betriebe). Insgesamt wurden in dem Pilotprojekt 8 851 ha landwirtschaftliche Nutzflächen mit dem Schnellverfahren bewertet.
3.2 Anwendung des Bewertungsverfahrens
Die Ergebnisse, die mit dem Schnellverfahren für die Projektbetriebe ermittelt wurden, sind in den Abb. 6 und 7 dargestellt.
Die Spannbreite der erzielten „Biodiversitätswerte“ (siehe oben, Abschnitt 2.2) bzw. Punkte reicht von 2 bis 34 (Abb. 6). Im Mittel erreichten die Projektbetriebe 17 Punkte. Aus der Aufteilung der Gesamtpunktzahlen auf die Bewertungskategorien (Nutzungstypen, Landschaftselemente, Acker, Grünland) ist ersichtlich, dass vergleichbare Punktsummen durch unterschiedliche Teilbewertungen erreicht werden können.
Bei den Betrieben, die im Vergleich der Gesamtstichprobe auffällig hohe Punktzahlen erreichen (Abb. 6 von links: Betriebe Nr. 30 bis 7), handelt es sich um Mutterkuh- und Schafhaltungsbetriebe, die auf einem hohen Anteil an Naturschutzflächen wirtschaften, um Pferdebetriebe mit Extensivgrünland sowie um Ökobetriebe mit Naturschutzgrünlandflächen und/oder einer vielfältigen Bewirtschaftung der Ackerflächen. Von den insgesamt sechs Ökobetrieben, die im Rahmen der Stichprobe untersucht wurden, fallen fünf in die letztgenannte Gruppe. Der sechste Ökobetrieb, der nahezu ausschließlich Ackerflächen bewirtschaftet, liegt mit seinem ermittelten „Biodiversitätswert“ im oberen Mittelfeld und weist innerhalb der Gesamtstichprobe die höchste Bewertung für den Teilbereich der Ackerflächen auf (Betrieb Nr. 5). Bei den Betrieben, die geringe Punktzahlen erreichen, handelt es sich um spezialisierte konventionelle Ackerbau- und Milchviehbetriebe. Die beiden Betriebe mit den geringsten Gesamtpunktwerten haben in ihren Sammelanträgen keine Landschaftselemente angegeben. Innerhalb der Gesamtstichprobe sind zwei weitere Betriebe vertreten, die > 50 % ihrer Landschaftselemente nicht angegeben haben (Betriebe Nr. 28 und 74).
Die Rangierung der Projektbetriebe weicht für das „erreichte Biodiversitätspotenzial“ (Abb. 7) leicht von der Reihenfolge für die Punktbewertungen ab (Abb. 6). Die Betriebe liegen jedoch für beide Parameter in insgesamt ähnlichen Wertenbereichen der Gesamtstichprobe. Die ermittelten Potenzialwerte betragen 4 % bis 64 %. Im Mittel realisieren die untersuchten Betriebe ein „Biodiversitätspotenzial“ von 33 %.
Das Schnellverfahren wurde im Rahmen des Pilotprojektes erstmalig durch einen Bearbeiter angewendet, der nicht an der Entwicklung des Verfahrens beteiligt war. Die Erfahrungen, die der Projektbearbeiter anhand der 80 Projektbetriebe sammeln konnte, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Das Bewertungsverfahren war ein guter „Türöffner“ für die Naturschutzberatung und erleichterte den Einstieg in das Beratungsgespräch. Durch die Erläuterung des Schnellverfahrens (Hintergründe, Parameter, Punktevergabe) war es möglich, ökologische Zusammenhänge und Naturschutzbelange sachlich und offen anzusprechen.
Insbesondere durch die gemeinsame Einsicht in die Orthofotos in den Sammelanträgen konnten bereits häufig (Teil-)Flächen identifiziert werden, die für potenzielle Maßnahmenumsetzungen geeignet waren. Die Betriebsleiter konnten hier mit ihren individuellen Bewirtschaftungserfahrungen und durch einen anderen Blickwinkel schnell Ideen und Anregungen einbringen.
Teilnehmer, die schon im Anschluss an den Erstkontakt oder bereits in den Vorjahren Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog ausgewählt hatten, waren weniger an dem Bewertungsverfahren interessiert, ließen eine Bewertung aber zu. Andersherum lehnten nur wenige Betriebe die Bewertung ab, wenn keine passenden Maßnahmen im Katalog gefunden werden konnten.
Die gemeinsame Datenaufnahme für die Betriebsbewertung mit dem Schnellverfahren dauerte durchschnittlich rund 25 min (Mittel 26, Median 23, Standardabweichung 11, Standardfehler 1, Min. 10, Max. 60 min, n = 80 Betriebe). Inklusive der Beratungen und Diskussionen über mögliche Maßnahmenumsetzungen betrug der Zeitbedarf für die Betriebsgespräche insgesamt etwa 1,0 bis 1,5 h.
3.3 Naturschutzberatung und Maßnahmenumsetzung
Unter den 80 Projektbetrieben hatten 55 Betriebe (68,8 %) bereits Erfahrungen mit der Umsetzung von Naturschutzmaßahmen (Fragebogenauswertung, ohne Ergebnisdarstellung). Bis zum Ende der Projektlaufzeit wurden als Resultat der Betriebsberatungen in Kooperation mit dem Naturschutzring Aukrug auf 16 Betrieben insgesamt 21 Maßnahmen tatsächlich umgesetzt (Tab. 2). Neun weitere Betriebe äußerten konkretes Interesse an Maßnahmen, die jedoch während der Projektlaufzeit noch nicht realisiert werden konnten. Der Anteil an Betriebsberatungen, die zu vereinbarten Maßnahmenumsetzungen führten, beläuft sich damit auf insgesamt 31,3 %. Zwei Landwirte zogen ihre Zusage zu Stoppelbracheverträgen aus Protest gegen parallel durch das Land erlassene Neuregelungen zum Knickschutz (MELUR 2013) zurück. Unter den Gründen, die dafür angeführt wurden, dass bisher keine Naturschutzmaßnahmen umgesetzt wurden, dominieren „störend im Produktionsablauf“, „Förderhöhe zu gering“, und „kein Nutzen für den Betrieb“ (Abb. 8).
Die Anwendung des Bewertungsverfahrens wurde durch die Landwirte fast ausschließlich gewinnbringend (Abb. 9) und insgesamt zu 100 % positiv bewertet (ohne Ergebnisdarstellung, Fragebogenauswertung: „Allgemeines Fazit eher positiv oder eher negativ?“, n = 80 Betriebe).
Aus Sicht des Beraters wurde die Naturschutzberatung generell dadurch erschwert, dass der große Flächendruck durch hohe Pachtpreise und die individuellen betriebswirtschaftlichen Situationen bei vielen Betrieben keine oder nur vereinzelt Maßnahmen in der Fläche zulassen. Viele Landwirte hätten durchaus gerne freiwillig Maßnahmen durchgeführt, sahen sich aus finanziellen Gründen hierzu jedoch nicht in der Lage. Diese generellen Rahmenbedingungen führten dazu, dass Maßnahmenumsetzungen (Tab. 2) i.d.R. nicht unmittelbar aus dem betriebsspezifische Bewertungsergebnis abgeleitet werden konnten („Schwachstellenanalyse“), sondern maßgeblich durch die individuellen Möglichkeiten sowie den persönlichen Dialog bestimmt waren.
4 Diskussion
Die Resultate für die Punktbewertungen und „Biodiversitätspotenziale“, die im Jahr 2013 im Naturpark Aukrug ermittelt wurden, liegen in einem leicht niedrigeren Bereich als die Werte, die in der landesweiten Vorstudie zur Entwicklung des Schnellverfahrens bestimmt wurden (Neumann & Dierking 2014, Tab. 3). Der Unterschied der ermittelten Wertebereiche resultiert daraus, dass durch die Stichprobe der Vorstudie ein möglichst breites Spektrum an Bewertungsergebnissen abgedeckt werden sollte, wodurch „gute“ Betriebe überproportional stark vertreten waren (Neumann & Dierking 2014). Die Werte aus dem Naturpark Aukrug bilden vermutlich zumindest für den Naturraum Geest die Durchschnittssituation in Schleswig-Holstein besser ab.
Die Ergebnisse aus dem Jahr 2013 sowie aus dem Vorprojekt (Neumann & Dierking 2014) zeigen übereinstimmend, dass die folgenden Betriebstypen bei der Bewertung mit dem Schnellverfahren besonders hohe Werte erreichen können:
Mutterkuh- und Schafhaltungsbetriebe, die auf einem hohen Anteil an Naturschutzflächen wirtschaften (inklusive halb offene Weidelandschaften),
Pferdebetriebe mit Extensivgrünland,
Ökobetriebe mit Naturschutzgrünlandflächen und/oder einer vielfältigen Bewirtschaftung der Ackerflächen.
Die genannten Betriebstypen haben damit eine besondere Bedeutung für den Erhalt und die Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft Schleswig-Holsteins (vgl. Oppermann 2011). Zudem bieten sich derartige Betriebe besonders für die Umsetzung weiterer Maßnahmen an, da sich insbesondere bei arrondierten Betriebsflächen so Schwerpunkträume mit einem hohen „Biodiversitätswert“ entwickeln lassen.
Die Ergebnisse und Erfahrungen des Jahres 2013 belegen, dass das Schnellverfahren gut dafür geeignet ist, als Instrument für die Erfassung der Ist- bzw. Ausgangssituation im Rahmen der Naturschutzberatung landwirtschaftlicher Betriebe eingesetzt zu werden. Das Verfahren zeichnete sich in Übereinstimmung mit der Vorstudie durch ein einfaches Datenmanagement und einen sehr geringen Zeitbedarf für die Datenaufnahme und auswertung aus (Neumann & Dierking 2014). Durch das Pilotprojekt im Aukrug konnte das Schnellverfahren erstmalig in einer ausgewählten Region unter Praxisbedingungen im Rahmen einer einzelbetrieblichen Naturschutzberatung getestet werden.
Aus Sicht der Projektbetriebe haben sich die Erwartungen an die Projektteilnahme (Abb. 4) erfüllt, die Anwendung des Schnellverfahrens wurde durchweg positiv und überwiegend auch gewinnbringend bewertet (siehe oben, Abb. 9). Durch die Kombination mit dem Maßnahmenkatalog „Aukruger Weg“ war es möglich, bereits während der Projektlaufzeit erste Maßnahmen umzusetzen (Tab. 2). Die insgesamt positive Resonanz der Projektbetriebe ist sicherlich mit darauf zurückzuführen, dass der Naturschutzring Aukrug e.V. bereits seit Jahren erfolgreich in der Region tätig ist. Das Projektergebnis wurde zudem auch dadurch positiv beeinflusst, dass der Projektbearbeiter von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus der Region stammt. Für die Betriebsentscheidung für Maßnahmenumsetzungen scheint darüber hinaus die bisherige Erfahrung mit Naturschutzmaßnahmen entscheidend gewesen zu sein. So hatten 11 (68,8 %) der 16 Betriebe, auf denen bereits im Projektzeitraum im Jahr 2013 Maßnahmen aus dem Katalog umgesetzt werden konnten, in der Vergangenheit schon einmal Naturschutzmaßnahmen durchgeführt (u.a. Vertragsnaturschutz, Angebotskatalog; Fragebogenauswertung, ohne Ergebnisdarstellung, n = 80 Betriebe).
Unabhängig von den günstigen Voraussetzungen, die für die Durchführung des Modellvorhabens in der Projektregion bestanden, war das Interesse der Betriebe an „ihrem Biodiversitätswert“ unerwartet groß. Das Modellvorhaben war ursprünglich für 40 Betriebe konzipiert worden, durch die positive Resonanz der Betriebsinhaber konnte die Stichprobengröße verdoppelt werden. Ein wesentlicher Faktor für den Projekterfolg war sicherlich auch, dass die Betriebe direkt durch den Projektbearbeiter angesprochen wurden.
Die Betriebsbewertung erfolgte im Rahmen des Pilotprojekts im Aukrug nicht allein durch die Betriebsleiter(innen), sondern mit Unterstützung durch den Berater. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, da die gemeinsame Datenaufnahme einen guten Einstieg in die Beratung ermöglichte und zudem erste Hinweise auf Maßnahmenumsetzungen lieferte (s.o.). Nach eigener Einschätzung könnten Betriebe das Verfahren mit Hilfe einer Kurzanleitung zwar prinzipiell auch eigenständig anwenden, das direkte Angebot der gemeinsamen Datenaufnahme und Beratung trägt jedoch vermutlich dazu bei, die Einstiegshürde für Betriebsleiter(innen) zu senken.
Der DVL strebt aufgrund der positiven Projekterfahrungen aus dem Naturpark Aukrug an, das Schnellverfahren zukünftig in weiteren Regionen der Landschaftspflegeverbände in Schleswig-Holstein (Boller et al. 2013, Metzner 2013) für die Naturschutzberatung landwirtschaftender Betriebe zu nutzen. Für den Einsatz in anderen Bundesländern sind bei der Auswahl und Bewertung der Eingangsparameter im Detail ggf. Anpassungen an die regionalen landschaftlichen Gegebenheiten vorzunehmen (Neumann & Dierking 2014).
Die Ergebnisse der Teilnehmerakquise im Naturpark Aukrug deuten drauf hin, dass zumindest in der Etablierungsphase einer zukünftigen einzelbetrieblichen Naturschutzberatung ein aktiver Zugang auf die Betriebe notwendig ist. Als Instrument für die maßnahmenorientierte Beratung scheint es ratsam, in Anlehnung an den Angebotskatalog „Aukruger Weg“ auch für andere Regionen eine entsprechende zusammenfassende Übersicht der relevanten bestehenden förderfähigen sowie zusätzlichen freiwilligen Maßnahmen zu erstellen.
Dank
Das Pilotprojekt wurde durch das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELUR) des Landes Schleswig-Holstein finanziert. Wir danken den beteiligten Landwirten für die Bereitstellung ihrer Daten und dem Naturschutzring Aukrug e.V. für die Unterstützung bei der Projektbearbeitung.
Literatur
Boller, F., Elscher, T., Erinc, M., Ulbrich, S. (2013): Strategien zur Umsetzung von Natura 2000 mit kooperativ strukturierten Verbänden. Das Beispiel der Bundesländer Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (10/11), 322-326.
Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten Schleswig-Holstein (MUNF, 1998): Erklärung über den Naturpark „Aukrug“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Amtsbl. Schl.-H. 1998 S. 684. Geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 09. Oktober 2014 (Amtsbl. Schl.-H. 2014 Nr. 44, S. 740). Erklärung des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten vom 16. März 1998.
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (MELUR, 2013): Neuregelungen zum Knickschutz – Langfassung. 11 S. http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/Startseite/LatenteThemen/PDF/Neuregelungen_Knickschutz__blob=publicationFile.pdf _Knickschutz__blob=publicationFile.pdf (Abruf am 08.01.2015).
Metzner, J. (2013): Landschaftspflegeverbände – Markenzeichen des kooperativen Naturschutzes in Deutschland. Strukturen, Arbeitsweise und Potenzial. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (10/11), 299-305.
Naturschutzring Aukrug (2011): Für Mensch, Natur und Landschaft. Die Fördermöglichkeiten in Natur- und Artenschutz im Rahmen des „Aukruger Wegs“ 2011-2013. 2. geänd. Auf., Sept.r 2011. Naturschutzring Aukrug e.V., Aukrug, S. 27. http://www.naturschutzring-aukrug.de/PDF/NSR_Artenschutzkatalog_2011_web.pdf (Abruf am 08.01.2015).
Neumann, H., Dierking, U. (2014): Ermittlung des „Biodiversitätswerts“ landwirtschaftlicher Betriebe in Schleswig-Holstein – ein Schnellverfahren für die Praxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (5), 145-152.
Oppermann, R. (2011): High Nature Value-Farming. Durch Landbewirtschaftung einen hohen Naturwert schaffen und erhalten. In: AgrarBündnis e.V., Hrsg., Der Kritische Agrarbericht 2011, 95-98. http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2011/Oppermann.pdf (Abruf am 08.01.2015).
Anschrift der Verfasser: Dr. Helge Neumann, Jan-Marcus Carstens und Uwe Dierking, Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V., Hamburger Chaussee 25, D-24220 Flintbek, E-Mail h.neumann@lpv.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

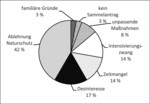
![Abb. 3: Art der Akquise (Anteil Kategorien, %) der Betriebe, die an dem Projekt teilgenommen haben (Fragebogenauswertung,#NB_SYMBOL[DOT]#= 80 Betriebe).](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-20150429-144_gq3tenztgu3a-150x104.jpg)
![Abb. 4: Beweggründe (Anteil Kategorien, %) der Betriebsleiter(innen) für die Projektteilnahme (Fragebogenauswertung, inkl. Mehrfachnennungen,#NB_SYMBOL[DOT]#= 80 Betriebe,#NB_SYMBOL[DOT]#= 141 Antworten).](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-20150429-142_gq3tenztgu2a-150x108.jpg)
![Abb. 5: Betriebstypen (Anteil, %) der Projektbetriebe (Auswertung Aufnahmebogen Betriebsbewertung, BgA: Betrieb gewerblicher Art, Biogasanlage,#NB_SYMBOL[DOT]#= 80 Betriebe).](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-20150429-143_gq3tenztgu2q-150x104.jpg)
![Abb. 6: Ergebnisse der Punktbewertungen der Projektbetriebe („Biodiversitätswert“,#NB_SYMBOL[DOT]#= 80 Betriebe, Nummerierung gemäß Reihenfolge der Datenaufnahme).](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-20150429-146_gq3tenztgu4a-150x62.jpg)
![Abb. 7: Ergebnisse der Potenzialbewertungen der Projektbetriebe („erreichtes Biodiversitätspotenzial“,#NB_SYMBOL[DOT]#= 80 Betriebe, Nummerierung siehe Abb. 6).](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-20150429-147_gq3tenztgu4q-150x62.jpg)
![Abb. 8: Gründe (Anteil Kategorien, %) für die Ablehnung von Naturschutzmaßnahmen (Fragebogen-Auswertung, inkl. Mehrfachnennungen,#NB_SYMBOL[DOT]#= 80 Betriebe,#NB_SYMBOL[DOT]#= 73 Antworten).](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-20150429-152_gq3tenztgy2q-150x117.jpg)
![Abb. 9: Bewertung (Anteil Kategorien, %) der Anwendung des Schnellverfahrens durch die Projektbetriebe (Fragebogenauswertung, inkl. Mehrfachnennungen,#NB_SYMBOL[DOT]#= 80 Betriebe,#NB_SYMBOL[DOT]#= 114 Antworten).](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-20150429-151_gq3tenztgy2a-150x104.jpg)


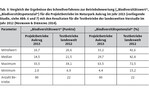
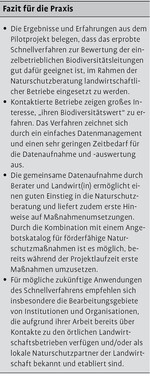
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.