Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Konzeptentwicklung in Großschutzgebieten
Abstracts
Der Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen von umweltrelevanten Entscheidungsprozessen immer größere Bedeutung beigemessen. Bei der Planung und Entwicklung von Großschutzgebieten stehen die Planungsträger dabei vor erheblichen Herausforderungen. In einer retrospektiven Betrachtung anhand der Erstellung eines Rahmenkonzepts für das Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz, das den gleichnamigen Nationalpark umschließt, erörtern die Autoren die Praxisbedingungen und ihren Einfluss auf den Beteiligungsprozess. Die Bewertung folgt einem von M.S. Reed entwickelten Kriterienset, das auf Schlüsselmerkmalen guter Praxis der Öffentlichkeitsbeteiligung beruht (frühzeitiger Beteiligungsbeginn, Einbeziehung aller relevanten Akteursgruppen, professionelle Moderation usw.). Das Fallbeispiel macht deutlich, dass das Beteiligungsverfahren an internationalen Standards orientiert war. Durch die umfassende Einbeziehung von Stakeholdern und Kommunen konnten im Spannungsfeld zwischen Nutzungs- und Naturschutzinteressen Fortschritte erzielt werden. Eine umfassende Beteiligung der breiten Öffentlichkeit in einer frühen Phase der Konzepterarbeitung gelang aber nicht, weil diese in der betreffenden Rechtsverordnung nicht vorgesehen war. Darüber hinaus wurde deutlich, dass die personellen Ressourcen der für das Verfahren zuständigen Naturschutzbehörde an ihre Grenzen stießen.
Public Participation in the Development of Concepts for Large Conservation Areas – Scope and Restrictions as exemplified by the Nature Reserve Saxon Switzerland
Ever increasing importance is being placed on public participation within the decision-making process for topics with an environmental impact. Public authorities currently face major challenges in the planning and development of large nature reserves. In a retrospective study, the authors discuss the participation process in the elaboration of a development concept for the landscape conservation area Sächsische Schweiz (Saxon Switzerland). The analysis is based on a set of criteria devised by M.S. Reed which highlights key elements of good practice in the field of public participation (e.g. participation as early as possible, involvement of all relevant actors, professional mediation of all interests and concerns).
The case study reveals the scope and restrictions of public participation. In particular, the communicative and cooperative approach of the responsible authority created a solid basis for intensive interaction. However, the anticipated wide-ranging social participation in the concept development was not realized. This failure can be attributed to a lack of legal provisions for such participation as well as little enthusiasm on the part of municipal actors to foster such a process voluntarily.
- Veröffentlicht am

1 Einführung
Im Rahmen von umweltrelevanten Entscheidungsprozessen wird der Öffentlichkeitsbeteiligung eine wachsende Bedeutung beigemessen. Das betrifft sowohl die wissenschaftliche Debatte (z.B. Reed 2008, Rauschmeyer et al. 2010) als auch die politische Programmatik (Europäische Landschaftskonvention, Biodiversitätsstrategie der EU 2020). Bürgerbeteiligung kann ganz allgemein als demokratisches Gut verstanden werden. Auch wird angenommen, dass von einer frühzeitigen und umfassenden Einbeziehung der Öffentlichkeit in Planungsprozesse ein positiver Einfluss auf die Akzeptanz von Umweltzielen ausgeht. Bürgerbeteiligung bzw. Partizipation könne die Qualität von Entscheidungen verbessern, positive soziale Veränderungen und Konfliktlösungen herbeiführen sowie Lerneffekte bei den Akteuren auslösen (Irwin & Stansbury 2004). Auf dem Gebiet des Umweltschutzes wird die Aarhus-Konvention diesbezüglich als Meilenstein angesehen (UNECE 1998), die sowohl den Zugang der Bürger zu Informationen als auch die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren fordert. Sie schließt explizit das Schutzgut Landschaft sowie entsprechende Pläne und Programme ein.
Es stellt sich allerdings auch die Frage, inwieweit normative Anforderungen an Beteiligung wie die Transparenz des Verfahrens, die Einbeziehung aller Betroffenen und die gerechte Abwägung von Einwendungen in der Praxis umgesetzt werden. Denn Planungsprozesse, die diesem Paradigma folgen, stellen eine große Herausforderung dar, da sie mehr Aufwand erfordern als rein hierarchische Steuerungsformen. Das betrifft auch die Planung und Entwicklung von Großschutzgebieten. In einer retrospektiven Betrachtung anhand der Erstellung eines Rahmenkonzepts für das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Sächsische Schweiz werden die Praxisbedingungen und ihr Einfluss auf Beteiligungsprozesse bei der Konzeptentwicklung von Großschutzgebieten erörtert. Das Ziel besteht darin, Chancen und Möglichkeiten von Beteiligungsprozessen aufzuzeigen sowie Lösungen für Probleme und Defizite vorzuschlagen.
Deshalb wird zunächst der Kenntnisstand in Bezug auf die Bürgerbeteiligung im Umweltmanagement dargestellt. Auf diese Weise wird ein normativer Rahmen für die Bewertung der Beteiligungsprozesse im untersuchten Fall geschaffen. Daran anschließend wird das LSG charakterisiert, die rechtliche Verankerung des Rahmenkonzepts erörtert und der Beteiligungsprozess beschrieben. Daran knüpft die Diskussion der Ergebnisse an, die einschätzt, inwieweit politisch postulierte und in der Wissenschaft anerkannte Prinzipien der Bürgerbeteiligung im Rahmen des geschilderten Fallbeispiels umgesetzt wurden. Ein Fazit, das auch auf den weiteren Forschungsbedarf eingeht, schließt den Beitrag ab.
2 Partizipation/Bürgerbeteiligung im Umweltmanagement (State of the art)
In der Politik und in den Sozialwissenschaften sind in den letzten Jahren Regeln und Normen für die Bürgerbeteiligung entwickelt worden. Der Anspruch an partizipatorische Verfahren ist dabei sehr hoch. Nach Nanz & Fritsche (2012: 11) geht es um „den Austausch von Argumenten mit dem Ziel einer gemeinschaftlichen Willensbildung und idealerweise einer anschließenden konsensualen Entscheidungsfindung“. Alternative Positionen sollen in Diskussionen abgewogen werden unter der Prämisse, andere Standpunkte zu berücksichtigen. Partizipative Konzepte wurden auch im Kontext von Umweltproblemen, dem Management natürlicher Ressourcen und insbesondere bei der Planung von Großschutzgebieten entwickelt. Für die deutschen Nationalparke gibt es schon seit langem Regeln zur frühzeitigen und kontinuierlichen Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Erstellung von Nationalparkplänen (Europarc Deutschland 2000). In der wissenschaftlichen Literatur wird überwiegend eine positive Bilanz hinsichtlich der Umsetzung in der Praxis gezogen. Im Rahmen von umweltbezogenen Entscheidungsprozessen werde Beteiligung inzwischen angestrebt (Stringer et al. 2007).
Ein Teil der wissenschaftlichen Literatur hat sich aber auch mit den Grenzen und Risiken partizipativer Ansätze befasst. So führen Irwin & Stansbury (2004: 58ff.) das Kostenproblem an. Partizipation führt automatisch zu höheren Kosten als hierarchische Entscheidungsprozesse, da die Kommunikation der Akteure zu organisieren ist (vgl. Schliep & Stoll-Kleemann 2010). Das macht Beteiligungsprozesse nicht nur teuer, sondern auch zeitaufwändig, so dass Umwelt- und Naturschutzverwaltungen an ihre Leistungsgrenzen geraten (Jedicke 2007). Weiterhin offenbart Partizipation meist eine Vielfalt an Meinungen, die konsensuale Lösungen erschwert und deshalb vielfache Rückkopplungen im Prozess erfordert (EPA 2001).
Neben den genannten Befunden zur Partizipation im Allgemeinen gibt es auch etliche deutschsprachige Publikationen speziell zu Partizipationsprozessen in Großschutzgebieten (z.B. Lange & Schroth 2005, Leibenath 2008, Kühne 2010). Partizipation wird dabei als notwendiges und wichtiges Element bei der Entwicklung von Schutzgebieten betrachtet. Anhand einer Untersuchung im Nationalpark Bayerischer Wald zeigen Liebecke et al. (2009), wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit der Naturschutzverwaltung ist, um zentrale Entwicklungsthemen selbst zu besetzen und dadurch Akzeptanz bei der Bevölkerung für ungewohnte Maßnahmen zu erzielen (z.B. Zulassen von Wildnis).
Die Bewertung von konkreten Beteiligungsansätzen erfordert Kriterien, die eine Operationalisierung ermöglichen. Reed (2008: 2422ff.) hat für seine Untersuchungen über die Partizipation im Umweltmanagement 158 Quellen ausgewertet und daraus acht „Schlüsselmerkmale“ guter Praxis identifiziert. Diese werden in der vorliegenden Arbeit als konzeptioneller Rahmen verwendet:
Erstens soll Beteiligung auf einer Philosophie beruhen, die Mitbestimmung, Gleichheit, Vertrauen und Lernen einschließt. Gibt es diesbezüglich Einschränkungen, etwa in Form nicht verhandelbarer Positionen, so sollen diese von Anfang an offengelegt werden, um Enttäuschungen zu vermeiden.
Zweitens sollen Beteiligungsprozesse frühzeitig beginnen und den gesamten Prozess begleiten.
Relevante Stakeholder sollen drittens systematisch repräsentiert sein. Das setzt voraus, dass das „soziale und natürliche System“ definiert ist, um das es im Rahmen des Beteiligungsprozesses gehen soll.
Die Ziele der Beteiligung sollen, als vierte Regel, zu Beginn vereinbart werden. Hier geht es Reed auch um Regeln des Dialogs wie Konsensfindung und den Umgang mit unvereinbaren Positionen.
Fünftens soll die Beteiligungsmethode passend zu den Zielen und zu den Teilnehmern gewählt werden. Hierbei kommt es darauf an, Intensität (Information, Konsultation, Integration) und Form der Beteiligung (Präsenz-Beteiligung oder Internet-Beteiligung) zu bestimmen.
Sechstens geht es um eine qualifizierte Moderation und Prozessbegleitung. Diese setzt kommunikative Fähigkeiten, Prozesswissen und Unvoreingenommenheit voraus.
Beteiligung solle siebtens auf der Integration von lokalem und wissenschaftlichem Wissen beruhen. Es kommt also auf die Verbindung von externem Expertenwissen (gutachterliche Analysen und Expertisen) und lokalem Praxiswissen (Erfahrungen, Ortskenntnis, Kenntnis sozialer Netzwerke) an.
Und achtens geht es um die Institutionalisierung des Prozesses. Das heißt, die Bürgerbeteiligung soll in den institutionellen Strukturen jener Organisationen verankert werden, die für die Umsetzung von Politiken verantwortlich sind.
Unabhängig von diesen Kriterien wird in einem Teil der Literatur (EPA 2001, Reed 2008) unterschieden, ob es sich um Bürgerbeteiligung im weitesten Sinne (Adressaten sind alle Bürger) oder um Stakeholder-Beteiligung handelt (Adressaten sind die Inhaber von Eigentums-, Nutzungs- und anderen Rechten).
3 Das Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz
Am Beispiel des Rahmenkonzepts für das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Sächsische Schweiz wird die Beteiligung der Öffentlichkeit vom Beginn des Prozesses bis zur Fertigstellung eines Experten-Entwurfs betrachtet. Die Autoren stützen sich dabei auf Ergebnisse einer teilnehmenden Beobachtung im Zeitraum 2009 bis 2012. Sie haben in diesem Zeitraum die Erstellung des Rahmenkonzepts durch die Moderation einer Projektgruppe, einer Arbeitsgruppe und verschiedene Koordinierungsaufgaben unterstützt und dabei einen tiefen Einblick in den Prozess erhalten.
3.1 Lage, Beschreibung und Schutzziele
Das Landschaftsschutzgebiet „Sächsische Schweiz“ bildet zusammen mit dem Nationalpark die gleichnamige Nationalparkregion. Diese 1990 eingerichteten Schutzgebiete gehen zurück auf das bereits 1956 festgesetzte Landschaftsschutzgebiet „Sächsische Schweiz“. Heute hat das LSG eine Fläche von knapp 290km². Es liegt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beiderseits der Elbe an der Staatsgrenze zu Tschechien (Abb.1). Der Nationalpark und Teile des LSG gehören zum europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000. Das Gebiet ist durch überwiegend bewaldete Sandsteinfelsgebiete und Tafelberge, landwirtschaftlich genutzte Ebenen sowie das canyonartig ausgebildete Elbtal geprägt (Abb. 2). Die Sächsische Schweiz weist eine durch Land- und Forstwirtschaft, Steinbrecherei und Fremdenverkehr geprägte Nutzungsgeschichte auf, deren Relikte bis heute die Landschaft prägen (Walz & Schumacher 2011).
Im Jahr 2003 löste eine neue, den heutigen rechtlichen Anforderungen genügende Nationalparkregion-Verordnung (NLPR-VO) den ursprünglichen Unterschutzstellungsbeschluss ab. Schutzzweck des LSG ist die Erhaltung und Entwicklung dieser vielfältigen Kulturlandschaft und des Erholungsgebietes. Außerdem übernimmt das LSG Puffer- und Ergänzungsfunktionen für den Nationalpark.
Aus rechtlichen Gründen wurden 2003 die Ortslagen ausgegliedert, während diese in der früheren Verordnung Bestandteile des Landschaftsschutzgebietes waren. Am LSG haben derzeit 15 Gemeinden Anteil. Die Anzahl der Einwohner, die unmittelbar in der Nationalparkregion leben, wird auf 30000 geschätzt (Auskunft der NLPV). Die Flächennutzung im LSG wird dominiert von ca. 53 % Waldanteil und ca. 41 % Landwirtschaftsflächen (eigene Berechnungen nach ATKIS 2012).
Naturräumlich bildet das Elbsandsteingebirge den Kern der Nationalparkregion. Dabei handelt es sich um eine Erosionslandschaft aus kreidezeitlichen Ablagerungen, die vor allem für ihre bizarren Felsformationen und für die von Steinbrecherei, Fremdenverkehr sowie Land- und Forstwirtschaft geprägte Nutzungsgeschichte bekannt ist. Neben Forst- und Landwirtschaft ist heute der Tourismus mit ca. 10000 Betten und 1,56 Mio. Übernachtungen (Statistisches Landesamt Sachsen 2012) eine wichtige Einnahmequelle. Industrie und Gewerbe spielen dagegen eine untergeordnete Rolle.
3.2 Rechtliche Verankerung des Rahmenkonzepts
Die Nationalparkregion-Verordnung (NLPR-VO 2003) regelt die Naturschutzbelange im LSG und im Nationalpark. Für beide Schutzkategorien schreibt sie die Erarbeitung konzeptioneller Rahmenvorgaben zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft unter Federführung der Nationalparkverwaltung (NLPV) vor. Diese hat in beiden Fällen den Landkreis, die Kommunen sowie Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Das Rahmenkonzept wird im Benehmen mit dem Landkreis und den Kommunen erstellt. Vereine und Verbände sollen gehört werden, wenn sie betroffen und im Gebiet aktiv sind. Eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung ist nicht vorgesehen.
Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Nationalparkrat, dem je ein Vertreter des Landkreises Sächsische Schweiz und der in der Nationalparkregion gelegenen Städte und Gemeinden angehören. Der Nationalparkrat soll einerseits die Nationalparkverwaltung bei der Lösung ihrer Aufgaben unterstützen. Gleichzeitig soll er der Wahrung der kommunalen Belange dienen. Der Nationalparkrat wirkt laut NLPR-VO insbesondere bei der Erarbeitung und Umsetzung von Planungen und Konzeptionen der Nationalparkverwaltung mit.
Die Nationalparkverwaltung (NLPV) selbst gehört organisatorisch zum Staatsbetrieb Sachsenforst. Sie ist Fachbehörde des Naturschutzes für die Nationalparkregion Sächsische Schweiz und untersteht in dieser Funktion zugleich der Fachaufsicht der obersten Naturschutzbehörde im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Sie erfüllt auch die Aufgaben einer Nationalparkwacht für Besucherinformation und Schutzgebietsüberwachung in der Nationalparkregion, allerdings mit dem Schwerpunkt Nationalpark. Die NLPV hat damit im LSG nur eingeschränkte Befugnisse, die eng an die in der Nationalparkregion-Verordnung genannten Aufgaben gebunden sind.
3.3 Vorgehen bei der Erstellung des Rahmenkonzepts einschließlich Beteiligungskonzept
Das Vorgehen bei der Erstellung des Rahmenkonzepts wurde maßgeblich durch Erfahrungen geprägt, die bei der Fortschreibung des „Nationalparkprogramms“ (NLPV 2007) gewonnen worden waren. Damals hatte die NLPV eine Einbeziehung der Bevölkerung nicht vorgesehen gehabt, zumal sie in der NLPR-VO auch nicht vorgegeben war. Erst nach Intervention des Nationalparkrates war diese zu einem späten Zeitpunkt parallel zur formellen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt worden (vgl. NLPV 2006). Vor diesem Hintergrund legte die NLPV bei der Aufstellung des Rahmenkonzepts für das LSG von Anfang an großen Wert auf eine transparente Vorgehensweise, die eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung einschloss, auch wenn diese in der Verordnung nicht vorgesehen ist. Außerdem sollte das Konzept einen Beitrag zur Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe aus der NLPR-VO leisten (z.B. vorbildliche Landschaftspflege, umweltgerechte Landwirtschaft, ortstypische Bausubstanz). Schließlich wollte man dem Prozess nun „die erforderliche Zeit“ einräumen (Scharfe et al. 2009: 8).
Die Erarbeitung des Rahmenkonzepts begann Ende 2009. Zur Koordinierung der Zusammenarbeit wurde eine Projektgruppe eingerichtet, zu der neben dem Leiter der NLPV und dem verantwortlichen Mitarbeiter für das Rahmenkonzept auch der Regionale Planungsverband, das Umweltressort im Landratsamt, ein Bürgermeister sowie die Leiter von fünf thematischen Arbeitsgruppen (AGs) gehörten. Aufgabe der Projektgruppe war es, den Planungsprozess zu initiieren und zu koordinieren sowie den Informationsfluss zwischen den Beteiligten sicherzustellen. Der Bürgermeister sollte darüber hinaus das Bindeglied zum Nationalparkrat sein und dafür sorgen, dass die kommunalen Interessen von Anfang an berücksichtigt werden.
Aufgabe der AGs war die Erarbeitung der fachlichen Grundsätze und Leitbilder zu den Themenkomplexen „Landschaftspflege“, „historische Kulturlandschaft“, „regionaltypisches Bauen“, „Verkehrslenkung“ und „Erholung/Naturerleben“. Etwa fünfzig lokale Experten, Wissenschaftler von Forschungseinrichtungen, mehrere Ressorts des Landkreises, Landesbehörden, Repräsentanten von Vereinen und Verbänden sowie Landwirte wurden im Rahmen der Erstellung in den Arbeitsgruppen aktiv. Mit diesem Ansatz ging die NLPV deutlich über die in der NLPR-VO fixierten Minimalanforderungen hinaus, in denen weder eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der Erstellung des Konzepts noch die Einbeziehung von Landnutzern und weiteren zusätzlichen Akteuren vorgesehen ist (vgl. Abschnitt 3.2). Trotz der ansprechenden Bereitschaft zur Mitwirkung war die Einrichtung der AGs auch mit einigen Schwierigkeiten verknüpft. Mehrere Vereine und wichtige Verbände sowie Einzelpersonen, die z.B. für die Zusammenarbeit in der AG Kulturlandschaft angefragt worden waren, lehnten die Mitwirkung mit Verweis auf Ressourcenmangel oder auf die Rechtsunverbindlichkeit des Papiers ab.
Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) erarbeitete einen Leitfaden für die Erstellung des Rahmenkonzepts (Scharfe et al. 2009). Dieser Leitfaden bestimmte, ausgehend von den rechtlichen Grundlagen (vgl. Abschnitt 3.2), die Ziele des Rahmenkonzepts. Es wurde eine Organisationsstruktur des Planungsprozesses mit den Aufgaben der Beteiligten sowie eine detaillierte Arbeits- und Zeitplanung entworfen. Das Rahmenkonzept sollte in zwei Hauptschritten erstellt werden: zunächst die Entwicklung „sektoraler Leitbilder und Grundsätze“ zu den in den AGs bearbeiteten Themen, danach die Zusammenführung dieser zu einem Gesamtkonzept. Für die Konzepterstellung war ein Zeitraum von etwa zwei Jahren vorgesehen.
Integraler Bestandteil des Leitfadens war ein Konzept zur abgestuften Beteiligung der Öffentlichkeit. Es orientierte auf einen Kommunikationsprozess, der in der Region eine über die Erarbeitung des Rahmenkonzepts hinausreichende Debatte anstoßen soll (Scharfe et al. 2009: 3). Inhaltlich lehnte er sich an die Empfehlungen von Europarc Deutschland (2000) zur Erstellung von Nationalparkplänen an und verknüpfte diese mit den knappen Ressourcen der NLPV. Er sah die bereits geschilderte aktive Beteiligung von Stakeholdern bei der Erarbeitung des Konzepts und eine dreimalige eher passive Einbindung der breiten Öffentlichkeit in verschiedenen Phasen der Erstellung des Rahmenkonzepts vor: (1) Information über die Aufstellung des Rahmenkonzepts im Amtsblatt des Landkreises, das allen Haushalten zugestellt wird, (2) öffentlichkeitswirksame Zwischenpräsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppen und (3) abschließende Präsentation des Gesamtkonzepts.
3.4 Prozessverlauf
Nach der Konstituierung der Arbeitsgruppen Anfang 2010 wurden innerhalb eines Jahres, also im vorgesehenen Zeitraum, die sektoralen Leitbilder zu den genannten Themen erstellt. Entsprechend dem Zeitplan präsentierten NLPV und AG-Leiter im Frühjahr 2011 in einer eigens dafür anberaumten Sitzung des Nationalparkrates den Arbeitsstand. In der Diskussion würdigten Landrat und Bürgermeister die Ergebnisse, äußerten aber gleichzeitig den Wunsch nach genauerer Information über die Inhalte der Konzeption und nach intensiverer Einbeziehung der Kommunen. Zunächst sollten die Ergebnisse der Arbeitsgruppen jedoch zusammengeführt werden, was dementsprechend erfolgte. Eine Information der breiten Öffentlichkeit sollte erst nach der Abstimmung mit den Gemeindeverwaltungen stattfinden.
Die vollständigen Entwürfe gingen den Gemeinden daraufhin zu. Eine zweite Diskussion im Rahmen des Nationalparkrates fand Ende 2011 statt. Dort wurde der Wunsch geäußert, bereits im Vorfeld des in der NLPR-VO geforderten förmlichen Beteiligungsverfahrens schriftlich Stellung nehmen zu können. Die NLPV ging auf dieses Anliegen ein und bot darüber hinaus an, das Konzept in den Gemeinderäten bzw. in kommunalen Ausschüssen vorzustellen. Von diesem Angebot machten die meisten Gemeinden Gebrauch. Die Sitzungen waren in der Regel öffentlich. In einigen Gemeinden nahmen Bewohner und Landnutzer an den Gesprächen teil. So kam es nach vielen Jahren erstmals zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem LSG in den Gemeinden. Diese Diskussionen erfolgten zwar in einer kritischen Atmosphäre, ergaben aber überwiegend positive Rückmeldung zu den Zielen des LSG. Die NLPV fühlte sich in ihrem Anliegen gestärkt, konnte den ursprünglich vorgesehenen Zeitplan für die Aufstellung des Konzepts aber nicht mehr einhalten.
Im Zuge der schriftlichen Stellungnahmen der Gemeinden, des Landratsamtes, der Landesdirektion sowie des Regionalen Planungsverbandes gingen 330 Hinweise, Anregungen und Bedenken ein, die in ein Abwägungsprotokoll aufgenommen wurden. Ein Großteil der Hinweise beinhaltete Formulierungsvorschläge. Inhaltliche Stellungnahmen bezogen sich hauptsächlich auf die Themen „Erholung und Naturerleben“ (z.B. Radwegekonzept, Zugänglichkeit der Landschaft, Tourismus als Wirtschaftsfaktor), „Landnutzung“ (z.B. ökologische Durchgängigkeit der Fließgewässer, Hochwasserschadensbeseitigung und Hochwasserschutz, Waldbehandlung, Landwirtschaft) sowie „Bauliche Entwicklung und Gestaltung“ (z.B. Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien).
Nach der Überarbeitung wurden der Nationalparkrat und die einzelnen Gemeinden im Juni 2012 über das Anhörungsergebnis in Kenntnis gesetzt. Vom Rat wurde die Forderung erhoben, dass der endgültige Entwurf des Rahmenkonzepts in öffentlichen Informationsveranstaltungen, sogenannten „Regionalkonferenzen“, den Bürgern vorgestellt und erläutert werden soll, allerdings erst im Zusammenhang mit dem geplanten offiziellen Beteiligungsverfahren. Zum Zeitpunkt der Arbeit an diesem Beitrag, vier Jahre nach Bearbeitungsbeginn, befindet sich der Konzeptentwurf zur Prüfung beim zuständigen Landesministerium. Die formelle Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde noch nicht begonnen. Auch eine Beteiligung der breiten Öffentlichkeit gab es bisher nicht.
4 Diskussion: Spielräume und Restriktionen der Bürgerbeteiligung
Ungeachtet der Tatsache, dass das Verfahren zur Aufstellung des Rahmenkonzepts für das LSG Sächsische Schweiz noch nicht abgeschlossen ist, lassen sich bereits Schlussfolgerungen in Bezug auf die Bürgerbeteiligung ableiten. Anhand des in Abschnitt 2 vorgestellten Analyserasters (Reed 2008) sollen im Folgenden Spielräume und Restriktionen im untersuchten Fall genauer herausgearbeitet werden. Dabei werden die acht Kriterien von Reed zu vier Gruppen zusammengefasst: (a) Philosophie der Beteiligung, (b) Prozessdesign und -verlauf, (c) Akteure und Kommunikation sowie (d) Institutionalisierung.
(a) Philosophie der Beteiligung (Regel 1 nach Reed 2008)
Die NLPV ist mit einem hohen Anspruch in den Planungsprozess gegangen. Dabei wurde sowohl von den Herausforderungen eines vergleichsweise dicht besiedelten Lebens- und Wirtschaftsraumes als auch von dem Willen ausgegangen, aus Defiziten früherer Beteiligungsprozesse zu lernen. Davon zeugten sowohl die Strukturen (Projektgruppe, Arbeitsgruppen), die Einbeziehung externer Experten für die Moderation, der kollektive und über die rechtlichen Vorgaben hinausreichende Ansatz bei der Erarbeitung des Konzeptentwurfs mit Stakeholder-Beteiligung als auch die im Leitfaden vorgesehene mehrmalige Einbeziehung der Bürgerschaft. Ob damit alle Ansprüche an „Mitbestimmung, Gleichheit, Vertrauen und Lernen“ (Reed 2008: 2422) voll erfüllt werden konnten, wurde nicht empirisch untersucht. Es ist aber festzuhalten, dass das konzipierte Verfahren allgemeinen Anforderungen entspricht und im Vergleich zur vorausgegangenen Erstellung des Nationalparkprogramms einen deutlichen Fortschritt hinsichtlich der Öffentlichkeitsbeteiligung darstellt.
(b) Akteure und Kommunikation (Regeln 3 und 4)
Angestrebt war die möglichst breite Beteiligung aller relevanten Interessengruppen. Die Ansprache potenzieller Interessenvertreter betreffs Mitwirkung in den Arbeitsgruppen erfolgte durch die NLPV sorgfältig und nach einer Analyse der Betroffenheit. Als unproblematisch erwies sich die Einbeziehung der wichtigsten Landnutzer. Während Forstwirtschaft und Wasserwirtschaft von vornherein als kooperativ in Bezug auf die Schutzziele des LSG galten, überraschte es, dass auch die Vertreter der Landwirtschaft, darunter die drei größten Agrarbetriebe im LSG, schnell zur Mitwirkung bereit waren und sich konstruktiv einbrachten. Ambivalent war die Mitwirkung der Gemeinden im LSG. Von diesen wurden im Rahmen der vorgezogenen Beteiligung sehr viele detaillierte Anregungen beigesteuert. Förderlich wäre gewesen, wenn sich die Kommunen schon vorher aktiver in den Prozess der Erstellung eingebracht hätten. Immerhin gelang es im Verlauf des Prozesses, die Kommunikation zwischen NLPV und Gemeinden deutlich zu verbessern, vor allem durch die zahlreichen Präsentationen des Konzepts in den Gemeinderäten. Dabei wurde punktuell auch eine Einbeziehung der Öffentlichkeit erreicht. Insofern hat das offene, kommunikative Vorgehen sehr wohl dazu beigetragen, die Auseinandersetzung der Kommunen mit den Zielen des LSG zu verbessern.
(c) Prozessgestaltung (Regeln 2, 5, 6 und 7)
Ein durchaus probater Ansatz ist die hier vorgesehene schrittweise Einbeziehung der Öffentlichkeit: Stakeholderbeteiligung bei der Entwurfserstellung bereits in einer frühen Phase, danach Einbeziehung der kommunalen Akteure und schließlich breite Bürgerbeteiligung. Mit der externen Moderation durch ein Forschungsinstitut und zwei Planungsbüros konnten dem Prozess zusätzliche Impulse vermittelt werden (Prozess- und Sachwissen). Die externe, unabhängige Prozess- und Arbeitsgruppenmoderation trug dazu bei, dass der erste Entwurf des Rahmenkonzepts zügig und routiniert erarbeitet wurde. Stakeholder wurden integrativ in den Prozess eingebunden. Sowohl das Praxiswissen regionaler Akteure als auch externe wissenschaftliche Expertise wurden so einbezogen.
Dennoch hatte der Prozess eine Schwäche, die sich fatal ausgewirkt hat: Das Verfahren der Bürgerbeteiligung war nicht von vorn herein mit dem Nationalparkrat, d.h. mit den Kommunen, vereinbart worden, so dass sich diese letztlich nicht an das Konzept der Öffentlichkeitsbeteiligung gebunden fühlten. Auch die Rolle der vorgeschlagenen „öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen“ (Information der Öffentlichkeit oder Integration von Meinungen?) und die Form der Bürgerbeteiligung (Präsenzveranstaltungen, Internet-Beteiligung oder andere Formen?) wurden im Prozessleitfaden nicht verankert. Seitens der NLPV wurde darauf vertraut, dass sich die kommunalen Repräsentanten zum geeigneten Zeitpunkt auf ein Procedere für die breite Öffentlichkeitsbeteiligung einlassen würden.
(d) Institutionalisierung (Regel 8)
Wie oben dargestellt, regelt die NLPR-VO die Beteiligung. Landkreis, Kommunen, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind einzubeziehen. Verbände und Vereine sollen gehört werden, wenn sie betroffen und im Gebiet aktiv sind. Darüber hinaus gibt es weitere Regelungen zur Einbeziehung einzelner Akteure. Dagegen ist ein umfassender Partizipationsprozess, wie er im Leitfaden zur Erstellung des Rahmenkonzepts vorgesehen war, nicht festgeschrieben. Dies führte letztlich zu einer Reihe von Unsicherheiten. Zwar legitimierten der Nationalparkrat und das zuständige Ministerium das von der NLPV vorgeschlagene Verfahren im Voraus, letztendlich fehlte jedoch der politische Wille der Entscheidungsträger dazu, die vorfristige Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Späte Forderungen des Nationalparkrates nach einem umfangreichen Beteiligungsverfahren mit öffentlichen Foren überforderten zudem die finanziellen und personellen Möglichkeiten der NLPV. Reeds Forderung nach einer Institutionalisierung ist damit nur teilweise erfüllt.
5 Schlussfolgerungen und weiterer Forschungsbedarf
Resümiert man den vorgestellten Fall der Erstellung eines Rahmenkonzepts für das LSG Sächsische Schweiz zunächst für sich, so kann Folgendes festgestellt werden: Erstens wird der Öffentlichkeitsbeteiligung seitens der am Verfahren beteiligten Behörden große Bedeutung beigemessen. Man orientiert sich an anerkannten nationalen und internationalen Kriterien und Standards. Aus früheren Erfahrungen wurden Lehren gezogen. Zweitens zeigt sich, dass der gewählte kommunikative und kooperative Ansatz bei der Erstellung des Rahmenkonzepts sehr förderlich war, um die Mitwirkung der Akteure zu erreichen bzw. zu verbessern. Gerade im Spannungsfeld zwischen kommunalpolitischen und Naturschutzinteressen konnten Fortschritte erzielt werden und es fand eine intensivere Auseinandersetzung der Kommunen mit dem LSG statt. Dennoch verbleiben zahlreiche Probleme wie die geringe Identifikation einiger kommunaler Entscheidungsträger mit den Zielen der Nationalparkregion, deren Lösung nur durch die Stärkung des Vertrauens zwischen Kommunen und Naturschutzfachverwaltung erfolgen kann.
Drittens wird deutlich, dass der beschriebene Arbeits- und Beteiligungsprozess komplex und vielschichtig war (und ist) und dass die Umsetzung trotz genauer Planung in der zweiten Phase ins Stocken geriet und modifiziert werden musste. Hieraus kann man lernen, dass derartige Prozesse eine gewisse Flexibilität benötigen, um auf äußere Impulse reagieren zu können. Auf der anderen Seite sind die Ressourcen der Akteure zu berücksichtigen und sensible Verfahrensaspekte (wie die breite Bürgerbeteiligung) frühzeitig zu regeln. Viertens schließlich ist unübersehbar, dass die Erfolgsabhängigkeit der Beteiligungsstrategie von den institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen sie umgesetzt wird, abhängig ist. Im vorliegenden Fall mussten die ursprünglichen Ambitionen in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung zurückgeschraubt werden, weil sie in der NLP-VO nicht vorgeschrieben ist.
Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass das untersuchte Fallbeispiel die Bedeutung von Beteiligungsprozessen für die Umsetzung von Naturschutzzielen unterstreicht. Wenn die Verbesserung der Akzeptanz von Naturschutzzielen erreicht werden soll, werden zwar beträchtliche Ressourcen in Anspruch genommen. Dies ist aber eine lohnende Investition. Es wird auch deutlich, dass es neben den unmittelbar angestrebten Zielen wie der Legitimierung eines behördlichen Rahmenkonzepts auch um die Weiterentwicklung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Akteuren sowie die Auseinandersetzung mit Schutz-, Erhaltungs- und Entwicklungszielen bzgl. Natur und Landschaft geht.
Das hier verwendete Analyseraster von Reed (2008) hat sich zur Bewertung des Beteiligungsprozesses grundsätzlich als geeignet erwiesen. Reed geht von einer idealtypischen Gestaltung von Beteiligungsprozessen aus, die das maximal denkbare Level an Partizipation als Maßstab ansieht. Deshalb sei angemerkt, dass die Realität mitunter Limitierungen vorgibt, die Fragen aufwirft wie: Was ist nötig? Was ist möglich? Und was ist sinnvoll?
Für die Wissenschaft lässt sich der Schluss ziehen, dass eine kritische Auseinandersetzung mit Beteiligungsprozessen in Großschutzgebieten weiterhin große Bedeutung hat. Dabei kommt es sowohl darauf an, Veränderungen in den Anforderungen an Beteiligungsprozesse (z.B. durch ein sich wandelndes Demokratieverständnis) als auch konkrete lokale Akteurskonstellationen und Rahmenbedingungen zu beachten.
Literatur
EPA (2001): Stakeholder Involvement & Public Participation at the U.S. EPA. Lessons Learned, Barriers, & Innovative Approaches. United States Environmental Protection Agency (EPA). http://www.epa.gov/evaluate/pdf/stakeholder/stakeholder-involvement-public-participation-at-epa.pdf (12.05.2014).
Europarc Deutschland (2000): Leitfaden zur Erarbeitung von Nationalparkplänen. Berlin.
Irwin, R., Stansbury, J. (2004): Citizen Participation in Decision Making: is it Worth the Effort? Public Administration Review 64 (1), 55-65.
Jedicke, E. (2007): Partizipation und Kooperation zur Realisierung von Naturschutzprojekten im Biosphärenreservat Rhön. Beiträge Region und Nachhaltigkeit 4 (4), 85-98.
Kühne, O. (2010): Das UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau. Entwicklungen, Beteiligungen und Verfahren in einer Modellregion. Standort – Zeitschrift für Angewandte Geographie 34 (1), 27-33.
Lange, E., Schroth, O. (2005): Partizipation in der Landschaftsentwicklung. Garten und Landschaft (2), 23-25.
Leibenath, M. (2008): Legitimacy of Biodiversity Policies in a Multi-level Setting. The Case of Germany. In: Keulartz, J., Leistra, G., eds., Legitimacy in European Nature Conservation Policy, Case Studies in Multilevel Governance, Springer, Berlin, 233-250.
Liebecke, R., Wagner, K., Suda, M. (2009): Akzeptanzforschung zu Nationalparks. Ein empirisches Beispiel aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Natur und Landschaft 84 (11), 502-508.
Nanz, P., Fritsche, M. (2012): Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren und Akteure. Chancen und Grenzen. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung 1200, Bonn.
NLPR-VO (2003): Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Nationalparkregion Sächsische Schweiz vom 23.10.2003 (SächsGVBl. 15/2003, 663-684).
NLPV (2006): Bürgerbeteiligung zum Entwurf des Nationalparkprogramms. Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz: Pressemitteilung 7/2006 vom 12.05.2006.
– (2007): Nationalparkprogramm für den Nationalpark Sächsische Schweiz. Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz, Bad Schandau.
Rauschmeyer, F., Suškevics, M. Berghöfer, A., Wittmer, H. (2010): Partizipation erfolgreich gestalten in der Umsetzung von Biodiversitäts- und Wasserpolitik in Europa. Policy brief. http://www.governat.eu/files/files/policy_brief_governat_dt_2010.pdf (12.05.2014).
Reed, M.S. (2008): Stakeholder participation for environmental management: A literature review. Biological Conservation 141 (10), 2417-2431.
Scharfe, S., Walz, U., Wirth, P. (2009): Leitfaden zur Erstellung eines Rahmenkonzepts für das Landschaftsschutzgebiet „Sächsische Schweiz“. Unveröff. Ber., 26 S., Dresden.
Schliep, R., Stoll-Kleemann, S. (2010): Assessing Governance of Biosphere Reserves in Central Europe. Land Use Policy 27 (3), 917-927.
Stringer, L.C., Reed, M.S., Dougill, A.J., Rokitzki, M., Seely, M. (2007): Enhancing participation in the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification. Natural Resources Forum 31, 198-211.
UNECE (1998): Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Konvention). UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE). Genf.
Walz, U., Schumacher, U. (2011): Sächsische Meilenblätter als Quelle der Kulturlandschaftsforschung am Beispiel der Sächsischen Schweiz. Cartographica Helvetica (44), 3-15.
Anschriften der Verfasser(in): Dr. Peter Wirth, Sabine Scharfe und Dr. Ulrich Walz, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, D-01217 Dresden, E-Mail p.wirth@ioer.de, s.scharfe@ioer.de und u.walz@ioer.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


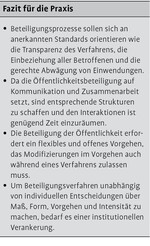
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.