Artenschutz und Windenergieanlagen
Abstracts
Die aktuelle Fassung von Abstands- und Prüfradien zur Vermeidung von Vogelschlagopfern an Windkraftanlagen der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten wird vorgestellt. Diese Fachkonvention war bereits in der Vorgängerfassung („Helgoländer Papier“) eine wichtige Orientierungshilfe für die Praxis der Planung von Windkraftstandorten und die Rechtsprechung. Eine aktualisierte Fassung liegt seit einigen Wochen vor – eine offizielle Veröffentlichung stößt jedoch auf politische Widerstände in einzelnen Umweltministerien und ist derzeit nicht absehbar.
Die Ergebnisse der Vogelschutzwarten werden um eine artenschutzrechtliche Einordnung (§ 44 Abs.1 BNatSchG) ergänzt. Dargelegt wird die Reichweite der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände, die nicht nur bei seltenen Vogelarten zu beachten sind, sondern z.B. in Bezug auf das Tötungsverbot auch bei häufigeren Arten wie Mäusebussard (Buteo buteo), Turmfalke (Falco tinnunculus) oder Feldlerche (Alauda arvensis) zum Tragen kommen. Weiter wird vorgeschlagen, wie damit im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung verfahren werden könnte. Ein Abschnitt mit Vorschlägen für künftige Ergänzungen der Fachkonvention schließt den Beitrag ab.
Species Protection and Wind Power Plants – Annotations on the current convention of the ornithological stations
The paper presents the current version of the LAG-VSW (Interstate Working Group of Ornithological Stations) on the necessary distance and test radius of wind power plants to avoid bird collision. The previous version (“Helgoländer Papier”) of this convention had provided an important orientation guide for legal regulations and for the practical planning of sites for wind power plants. Its updated version has been presented a few weeks ago, but its official announcement has caused political opposition in numerous federal environmental ministries and its publication remains unclear at present.
The paper supplements the results of the ornithological stations have been supplemented by a statement on legal species protection according to Federal Nature Conservation Law (§ 44 (1)). The paper sets out the reach of the legal prohibitions to be considered not only for rare birds but regarding e.g. the prohibition of killing also for more frequent species such as common buzzard (Buteo buteo), kestrel (Falco tinnunculus) or skylark (Alauda arvensis). It gives suggestions how to deal with it in the course of a derogation procedure. Finally the study provides proposals of future complements of the convention.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Bei der Planung von Windenergieanlagen (WEA) muss in naturschutzfachlicher Hinsicht regelmäßig sichergestellt werden, dass mit dem Bau und/oder während des Betriebes der Anlagen keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt werden. Hierbei stehen regelmäßig Kollisionen von Vögeln und Fledermäusen im Fokus. Für die Bewertung der Wirkungen auf ausgewählte Vogelarten liefert bisher das sogenannte Helgoländer Papier der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) eine wichtige Hilfestellung (LAG VSW 2007), denn es listet fachlich erforderliche Mindestabstände und Prüfradien zu avifaunistisch empfindlichen Standorten auf.
Seither hat es unter den Fachbehörden abgestimmte, aber bisher nicht veröffentlichte Aktualisierungen und Ergänzungen der Abstandsempfehlungen gegeben, wie verschiedenen Länderarbeitshilfen zu entnehmen ist (NLT 2014, Richarz et al. 2012 und 2013). Eine weitere Aktualisierung mit Stand 13.05.2014 liegt mittlerweile als „Entwurf“ vor (LAG VSW 2014; im Weiteren: Fachkonvention Abstandsempfehlungen) und wartet auf eine offizielle Verabschiedung durch die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA), um danach endlich das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken. Die LANA hat dies allerdings jüngst auf ihrer September-Sitzung während des Deutschen Naturschutztages in Mainz abgelehnt. Offene Fragen, die einer Veröffentlichung im Wege stehen könnten, thematisiert die neue Fachkonvention nicht. Vielmehr stellt die LAG-VSW einleitend klar, dass hier der beste derzeit verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisstand zusammengetragen wurde.
„Die Staatlichen Vogelschutzwarten in Deutschland verfügen über einen umfangreichen Kenntnisstand zum Thema Windenergienutzung und Vogelschutz. So wird z.B. bei der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg seit 2002 die zentrale Fundkartei über Anflugopfer an WEA (Schlagopferdatei) geführt, fortwährend aktualisiert und im Internet veröffentlicht ( http://www.mugv.brandenburg.de/cmsdetail.php/bb2.c.451792.de/ ). Dies erfolgt im Rahmen der Arbeitsteilung innerhalb der LAG VSW und geht auf eine Festlegung auf deren Frühjahrstagung 2002 zurück. Allerdings enthält die Datenbank auch einen kleinen Prozentsatz weiter zurückliegender Daten.
Diese Fundkartei ist eine geeignete Quelle, um das artspezifische, relative Kollisionsrisiko abzuschätzen (Illner 2012), wenngleich sie nicht nur Ergebnisse systematischer Untersuchungen, sondern in erheblichem Umfang auch Zufallsfunde enthält. Bei der Bewertung von Zufallsfunden muss berücksichtigt werden, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz von Kollisionsopfern überhaupt gefunden und gemeldet wird. Die Gründe hierfür liegen vor allem in der geringen Wahrscheinlichkeit des Auffindens und in der geringen Verweildauer der Kadaver unter den Anlagen. Aus den vorliegenden systematischen Untersuchungen ist bekannt, dass Kollisionsopfer sehr schnell und regelmäßig vor allem von Prädatoren bzw. Aasfressern, aber auch durch Menschen, beseitigt werden. Die realen Opferzahlen sind daher wesentlich höher als die Fundzahlen. Eine systematische Opfersuche in Verbindung mit Begleituntersuchungen zur Fehlereingrenzung kann Hochrechnungen und populationsbiologische Betrachtungen ermöglichen, wie sie Bellebaum et al. (2013) für den Rotmilan vorgenommen haben.
Das vorliegende Papier enthält den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und beschränkt sich im Interesse eines Ausbaus der erneuerbaren Energien auf das aus naturschutzfachlicher Sicht unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips grundsätzlich gebotene Minimum zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (siehe z.B. EU-Kommission 2000, IUCN 2007). Es sei darauf hingewiesen, dass eine sorgfältige und hinreichende Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Belange die notwendige Rechtssicherheit gewährleisten und dadurch auch verfahrensbeschleunigende Wirkungen entfalten kann.“
Der letzte Abschnitt der Einleitung legt sogar nahe, dass sich die Vogelschutzwarten eine gewisse Zurückhaltung auferlegt haben, so dass besonders unverständlich bleibt, weshalb die LANA keine Freigabe beschloss. Nach unbestätigten Meldungen traten insbesondere einzelne grüne Umweltministerien auf die Bremse. Die Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen wartet darauf jedoch nicht: Es kommt nicht nur aus Gründen des Artenschutzes, sondern auch um der Rechtssicherheit der Planungen willen darauf an, auf die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse zugreifen zu können. Daher werden nachfolgend die zentralen Erkenntnisse aus der aktuellen Fachkonvention wiedergegeben und um einige Erläuterungen zur artenschutzrechtlichen Einordnung ergänzt, die der „Fachkonvention Abstandsempfehlungen“ fehlen. (Dem Vernehmen nach enthielten frühere Fassungen Hinweise zur rechtlichen Einordnung, die allerdings wieder gestrichen werden mussten.) Den Abschluss bildet eine Zusammenstellung noch offener Fragen, die Gegenstand künftiger Standardisierungen und Forschungen sein sollten.
2 Die „Fachkonvention Abstandsempfehlungen“ der Vogelschutzwarten
Nachfolgend werden die beiden zentralen Abschnitte der Fachkonvention „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ (Stand: 13.05.2014) abgedruckt (Zitat in Kursivschrift; auch die Tab.1 und 2 sind Zitate):
„Anwendung der Abstandsempfehlungen
Die vorliegenden Abstandsempfehlungen beziehen sich ausschließlich auf das Errichten, den Betrieb und das Repowering von WEA im Binnenland (Kleinwindanlagen sind nicht Gegenstand dieses Papieres) und den Küstengebieten Deutschlands („onshore“). Ihre Anwendung wird als Beurteilungsmaßstab in der Raumplanung und der vorhabensbezogenen Einzelfallprüfung empfohlen. Sie sind als Regelanforderungen zu verstehen.
Für das Repowering von Altanlagen wird die gleiche Vorgehensweise wie bei der Errichtung von neuen Anlagen empfohlen. Dies ist erforderlich, da beim Repowering in der Regel höhere Anlagen mit längeren Rotorblättern zum Einsatz kommen, bei denen sich die von den Rotorblättern beeinflussten Lufträume sowie die auftretenden Luftdruckunterschiede und Sogwirkungen vergrößern. Das Gleiche gilt für die Kranstell- und Montageflächen. Dies wirkt sich u.a. auf den Flächenverbrauch und die thermischen Gegebenheiten im Nahbereich der Anlagen aus, in Wäldern auch auf die Größe der frei zu schlagenden Fläche und damit ggf. verbundene Sekundäreffekte.
Abstandsempfehlungen
Für die Raumplanung stellen die Angaben in den Tabellen 1 und 2 artspezifische Empfehlungen für die planerische Berücksichtigung der Hauptaktivitätszentren um Brut-, Rast- und Schlafplätze dar. Sie dienen dazu, auf das höhere Konfliktpotenzial innerhalb der genannten Abstände hinzuweisen und den Planungsfokus bevorzugt auf Bereiche außerhalb der Abstände zu richten.
In den Tabellen 1 und 2 werden Mindestabstände und Prüfbereiche zwischen WEA und bedeutenden Vogellebensräumen bzw. Brutplätzen WEA-sensibler Arten und Artengruppen vorgeschlagen, die aufgrund der Kollisionsgefahr oder des Meideverhaltens der Arten bzw. der Barrierewirkungen, die von WEA ausgehen können, als angemessen erachtet werden.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Mindestabstände, die zu bedeutenden Vogellebensräumen (z.B. große Ansammlungen von Gastvögeln) empfohlen werden. Bei den genannten Arten bzw. Artengruppen handelt es sich im Wesentlichen um Arten des Offenlandes, die i.d.R. sehr sensibel auf Vertikalstrukturen im Umfeld ihrer Nahrungs- und Rastgebiete reagieren. Diese Arten sind in hohem Maße in EU-Schutzgebieten und in Schutzgebieten nach nationalem Recht repräsentiert. Da die Effekte von WEA mit zunehmender Anlagenhöhe weiter reichen, werden die empfohlenen Mindestabstände für Rastgebiete über die Anlagenhöhe festgelegt. Regelmäßig sollten jedoch 1.200m (Tab.1) eingehalten werden. Windenergieanlagen können aber auch für weitere Artengruppen in Rast- und Konzentrationsgebieten des Vogelzuges durch erhebliche Beeinträchtigungen des Zuggeschehens und Gefahr von Kollisionen bedeutsam sein (Isselbächer & Isselbächer 2001, zentrale Funddatei).
In Tabelle 2 sind die empfohlenen Mindestabstände zu Brutvorkommen WEA-sensibler Arten dargestellt, die anhand von artspezifischen Telemetriestudien, Funktionsraumanalysen, langjährigen Beobachtungen und der Einschätzung von Artexperten ermittelt wurden (Abschnitt 5). Sie repräsentieren den Bereich um den Neststandort, in dem der überwiegende Teil der Aktivitäten zur Brutzeit stattfindet (i.d.R. mehr als 50 % der Flugaktivitäten).
Artenschutzrechtliche Prüfungen sind Einzelfallprüfungen. Es muss daher jeweils orts- und vorhabensspezifisch entschieden werden, ob das Tötungsrisiko signifikant erhöht ist. Dazu muss plausibel dargelegt werden, ob es im Bereich der geplanten Anlage zu höheren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten kommt. Für großräumig agierende Arten sollte in einem Verfahren auch außerhalb der o.g. Mindestabstände geprüft werden, ob der Vorhabensstandort im Bereich regelmäßig genutzter Flugrouten, Nahrungsflächen oder Schlafplätze liegt. Zu beachten sind weiterhin Aufenthaltsmuster ganzjährig territorialer Brutvögel außerhalb der Brutzeit, wenn keine Bindung an den Horstplatz besteht (z.B. Seeadler Haliaeetus albicilla). Dazu sind Raumnutzungsanalysen (vgl. Langgemach & Meyburg 2011) geeignete Methoden. Für solche Raumnutzungsuntersuchungen geben die Tabellen 1 und 2 Prüfbereiche an. Diese Prüfbereiche beinhalten Räume, in denen die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Individuums erhöht sein kann. Solche Räume ergeben sich beispielsweise aus bevorzugten Flugrouten, bevorzugten Jagd- und Streifgebieten der Brut- und Jungvögel, Schlafplätzen oder Reliefstrukturen, die günstige thermische Verhältnisse bedingen.
Die Größe der Prüfbereiche orientiert sich an der Dimension des sog. Homerange, also dem Bereich, der von den betroffenen Individuen regelmäßig genutzt wird. Für seine Abgrenzung wurden artspezifische Telemetriestudien, langjährige Beobachtungsreihen und die aktuelle Einschätzung von Artexperten herangezogen (Abschnitt 5). Aufgrund ihres Verhaltens ist bei einigen Arten die Abgrenzung solcher Prüfbereiche nicht sinnvoll, z.B. Kranich Grus grus, Zwergdommel Ixobrychus minutus und Wespenbussard Pernis apivorus; bei anderen wie dem Schreiadler Aquila pomarina (MEYBURG et al. 2007) ist der empfohlene Abstand in der Regel groß genug, um die wechselnde Lebensraumnutzung bei großem Aktionsraum ausreichend zu berücksichtigen.“
3 Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände
Mit Blick auf die Planung von Windkraftstandorten und den Betrieb der Anlagen sind für die Artengruppe der Vögel alle artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG relevant. Auf die Relevanz und Bewertung des Zugriffs-, Störungs- und Beschädigungstatbestandes soll nachfolgend übersichtsartig eingegangen und der Stellenwert der „Fachkonvention Abstandsempfehlungen“ eingeordnet werden.
3.1 Das Tötungsverbot des § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG
Die vorstehend dokumentierten aktuellen Abstandsempfehlungen und Prüfradien knüpfen insbesondere an das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (u.a.) für europäische Vogelarten an. Das Tötungsverbot gilt individuenbezogen, besondere Rückwirkungen auf die Population müssen für die Feststellung des Verbotstatbestandes nicht vorliegen (siehe z.B. Urteil 4A1075.04 des BVerwG vom 16.03.2006, Rn. 563; Urteil 9A39.07 vom 18.03.2009, Rn. 58).
Gerade für die Planung von WEA-Standorten steht man allerdings vor dem Problem, dass realistischerweise an keinem Ort der Bundesrepublik Deutschland die Kollision eines Vogels oder einer Fledermaus mit einer WEA ausgeschlossen werden kann. Damit wäre jedes Mal der Verbotstatbestand erfüllt und eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung erforderlich. Die fällige Alternativenprüfung käme aber ebenfalls immer zu dem Ergebnis, dass es keine anderen Standorte gibt, an denen es nicht ebenfalls zur Tötung von Individuen kommt. Da ein solcher Ansatz nicht weiter führt, hat die Rechtsprechung für den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG das Zusatzmerkmal der „signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos“ entwickelt (Urteil 9A14.07 des BVerwG vom 09.07.2008, Rn. 90f.; auch: Gellermann & Schreiber 2007), während das Verbot für das allgemeine Risiko, das mit der Realisierung eines Vorhabens an jeder anderen Stelle ebenso erfüllt wäre, nicht einschlägig ist.
Ob der Verbotstatbestand an einem Standort erfüllt ist, lässt sich mithilfe von zwei Prüffragen klären:
(1) Kommen Arten vor, die im Rahmen typischer Verhaltensweisen in den Gefahrenbereich des Rotors geraten?
(2) Treten solche Arten in einer mehr als durchschnittlichen Dichte oder Häufigkeit auf?
Ist eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt, kann auch keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos vorliegen, wie die beiden Beispiele im Textkasten zeigen.
Die Beantwortung der Frage, ab wann das Risiko für Individuen signifikant erhöht und damit das Merkmal des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt ist, erfordert zuerst einmal die Abschätzung des Grundrisikos, welches für europäische Vogelarten und Fledermäuse überall besteht. Die Erfassungen vor Ort liefern anschließend die erforderlichen Informationen darüber, in welchem Maße sich das Risiko erhöht. Die Einordnung als „signifikant“ erfordert für die betroffenen Individuen normalerweise eine deutlich spürbare Erhöhung. Das ist der Fall, wenn geschützte Individuen in großer Zahl am Standort auftreten, weil dann das Risiko besonders groß ist, dass einzelne Tiere „unter die Windräder kommen“ oder einzelne Tiere den Standort besonders häufig nutzen, weil die Wahrscheinlichkeit der Tötung wegen der häufigen Nutzung des Raumes besonders hoch ist. Allerdings darf das Risiko keinesfalls so hoch sein, dass nicht einmal die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt wären, weil sich dadurch nämlich der Erhaltungszustand der betroffenen Populationen dauerhaft und kontinuierlich verschlechtert. Bei stark gefährdeten und besonders seltenen Arten kann eine solche Situation schon bei sehr geringen Zusatzrisiken vorliegen.
In diesen Kontext liefern die Mindestabstände und Prüfbereiche der „Fachkonvention Abstandsempfehlungen“ wichtige Orientierungswerte für die Beurteilung von WEA-Standorten: Die oftmals durch Telemetriestudien und Verhaltensbeobachtungen abgesicherten Mindestabstände lassen sich für die einzelnen Arten nämlich in der Regel als solche Bereiche ansprechen, in denen von einer erhöhten Aktivität auszugehen ist. Je nach konkreter Situation kann dies zusätzlich oder stattdessen aber auch für weitere Flächen gelten. Sofern keine belastbaren anderweitigen Erkenntnisse vorliegen, sind Mindestabstände deshalb aus Gründen der Vorsorge als die Bereiche anzusehen, in denen aus fachlicher Sicht in jedem Fall von einer Erhöhung des Tötungsrisikos auszugehen ist.
3.2 Das Störungsverbot
Nach § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG ist es verboten, „wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören.“ Um nicht mit jeder bloßen Belästigung wie dem kurzzeitigen Aufmerken eines ruhenden Vogels, welches ohne irgendwelche Konsequenzen bleibt, den Verbotstatbestand auszulösen, muss eine Störung „erheblich“ sein. „Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“ Die Begründung zur Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (Bundestagsdrucksache 16/5100, S.11) gibt hierzu die folgende Erläuterung: „Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, der Bruterfolg oder die Reproduktionsfähigkeit vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen Einzelfall untersucht und beurteilt werden muss.“ Was den gesetzestechnischen Begriff der lokalen Population angeht, so lässt der Gesetzgeber die Fachwelt allein, wenn er in der Gesetzesbegründung formuliert: „Eine lokale Population umfasst diejenigen (Teil-)Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen einer Art, die in einem für die Lebens(-raum)ansprüche der Art ausreichenden räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen.“ Wie diese etwa bei kontinuierlich verbreiteten Vogelarten wie Buchfink (Fringilla coelebs) oder Zilpzalp (Phylloscopus collybita) abzugrenzen sein soll, erschließt sich nicht. Klar sollte jedenfalls sein, dass die lokale Population nicht weiter gefasst sein kann als das, was im Rahmen der Erfassungen untersucht worden ist bzw. worüber man aus anderen Zusammenhängen einschlägige Erkenntnisse besitzt.
Störwirkungen spricht die Fachkonvention für eine Reihe besonders gefährdeter und offensichtlich sensibler Vogelarten in den hier nicht wiedergegebenen „Erläuterungen zu einzelnen Arten und Artengruppen“ an, z.B. Raufußhühner, verschiedene Greifvögel, Wachtelkönig (Crex crex) und verschiedene Watvögel. Es stellt sich jedoch die Frage, ob damit der Reichweite des gesetzlichen Störungsverbots bereits hinreichend Rechnung getragen wurde und ob nicht analog zu den Erkenntnissen aus einem Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung (Garniel et al. 2007) auch von Störungseffekten bei den übrigen Vogelarten auszugehen ist, selbst wenn sie nicht unmittelbar mit der Aufgabe des Brutplatzes nach Errichtung einer WEA reagieren. In Bezug auf den Straßenverkehr gilt jedenfalls die Feststellung: „Die ersten 100m vom Straßenrand stellen für alle Vogelarten einen Bereich mit drastisch reduzierter Lebensraumeignung dar. Auch für Arten, die dort mit relativ hohen Dichten vorkommen, ist von einem signifikant reduzierten Reproduktionserfolg auszugehen.“ Nach den Erkenntnissen von Garniel et al. (2005) wirkt hier nämlich bei fast allen Vogelarten ein Bündel verschiedener Effekte (Lärm, Bewegungsreize, Lichtreflexe). Eben diese Störreize – verstärkt um einen von oben einwirkenden Schattenwurf – sind aber auch bei WEA zu verzeichnen.
3.3 Beschädigungsverbot
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verbietet die Zerstörung oder Beschädigung von Lebensstätten. Dies spielte bei der Planung und Errichtung von WEA bisher kaum eine Rolle, weil der Zerstörung nur während ihrer eigentlichen Nutzungszeit geschützten Lebensstätten (z.B. Nistmulde des Kiebitz Vanellus vanellus) durch Verlegung der Baufeldfreistellungen und Errichtung der Anlagen in die Zeit außerhalb der Brutphase leicht ausgewichen werden konnte.
Mit dem weiteren Vordringen der Windkraftnutzung in den Wald und der mittlerweile erreichten Größe der Anlagen und ihrer Nebeneinrichtungen ändert sich diese Situation allerdings. Bei der Errichtung von WEA im Wald wird man es beispielsweise immer wieder mit der Zerstörung von Horst- und Höhlenbäumen zu tun haben. Hierbei handelt es sich jedoch um dauerhaft geschützte Lebensstätten, denn sie werden nicht nur regelmäßig wiederkehrend von denselben Individuen, anderen Individuen derselben Art oder anderen Brutvogel- oder Fledermausarten im Folgejahr genutzt, sondern vielfach auch kontinuierlich während des übrigen Jahres als nächtliche Ruhestätte. Entsprechendes gilt für Greifvogelhorste. Der Umfang der Flächeninanspruchnahme wird ferner zunehmend dazu führen, dass regelmäßig genutzte Singvogelreviere komplett überbaut werden, was nach der Stralsund-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil 9A28.05 vom 21. Juni 2006) den Verbotstatbestand des § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG ebenfalls erfüllt.
4 Anmerkungen zur artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung
Kommt die zuständige Behörde aufgrund der fachlicherseits festgestellten Erhöhung des Tötungsrisikos zu der Einschätzung, dass damit der Verbotstatbestand des § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG erfüllt wird, ist im Rahmen der der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erneut das Fachwissen von Ornithologen gefragt, denn es ist die Frage zu beantworten, welche Auswirkungen vom anzunehmenden Tötungsrisiko für die betroffene Populationen zu erwarten und ob und ggf. in welcher Weise Maßnahmen zu gestalten sind, damit sich der Erhaltungszustand der betroffenen Populationen nicht verschlechtert.
Gerade zu der Frage nach den Auswirkungen auf die betroffenen Populationen, die in der Ausnahmeprüfung von Interesse ist, liefern die Kapitel 4 und 5 der neuen Fachkonvention ausführliche Informationen, die teilweise durch sehr umfangreiche Literaturrecherche untermauert sind (11,5 Seiten mit 242 Literaturstellen). Auf die Wiedergabe wird an dieser Stelle schon allein wegen des Umfangs verzichtet, beispielhaft mögen einzelne Details die Bearbeitungstiefe und kritische Auseinandersetzung mit der Materie veranschaulichen. Sofern Bedarf an den sorgfältig zusammengetragenen Informationen zu diesen Arten besteht, wird empfohlen, das hier besprochene Papier bei den zuständigen staatlichen Vogelschutzwarten oder bei der derzeitigen vorsitzenden Institution anzufordern, ggf. unter Berufung auf das UIG (aktuelle Geschäftsstellenadresse: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Staatliche Vogelschutzwarte, Leibnizstraße 10, 45659 Recklinghausen). Die „Fachkonvention Abstandsempfehlungen“ verweist im Übrigen auf die ausführlicheren und aktuellen Darstellungen der staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg unter http://www.lugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/vsw_dokwind_voegel.pdf (Stand der Bearbeitung: 09.10.2013; letzter Zugriff 05.10.2014).
Beispielhaft sei auf die Ausführungen zum Schreiadler (Aquila pomarina) verwiesen, zu dem es auf S. 6 heißt: „Aus fachlicher Sicht ist ein Mindestabstand von 6km um die Brutplätze dringend geboten (Langgemach & Meyburg 2011), doch beide Bundesländer (Anmerkung: Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) mit Vorkommen der Art haben einen Schutzbereich von 3km festgelegt. Zudem erlischt der Schutz der Horste in Brandenburg (ausschließlich bei Windkraftplanungen!), wenn sie „seit mehr als zwei Jahren nicht mehr besetzt“ sind. Andererseits gibt es mittlerweile zahlreiche Beispiele der Wiederbesiedlung verwaister Brutvorkommen nach mehreren Jahren.“ Zum Schwarzstorch (Ciconia nigra) findet sich der Hinweis: „Zudem wurden Meidungs- bzw. Barrierewirkung durch WEA nachgewiesen. Im wichtigsten Schwarzstorch-Gebiet Hessens, dem EU-Vogelschutzgebiet Vogelsberg (63.671 ha), halbierte sich der Brutbestand von 15 auf 7 Reviere mit der schrittweisen Errichtung von 126 WEA (Stand 1.9.2012), während in anderen hessischen Gebieten der Bestand stabil oder zunehmend war. Ein kausaler Zusammenhang ist hier naheliegend, wenn auch nicht beweisbar.“
Im Kontext des Tötungsverbotes näher einzugehen ist aber auf den unscheinbaren Satz 2 in Kapitel 5 der Fachkonvention: „Im Einzelfall können weitere (hier nicht behandelte Arten) hinzukommen.“ In artenschutzrechtlicher Hinsicht birgt dieser (fast schon verschämte) Hinweis im konkreten Fall erhebliches Konfliktpotenzial, weil bisher regelmäßig verkannt wird, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht nur für Rotmilan & Co., sondern auch für „Amsel, Drossel, Fink und Star“ gelten, auch wenn verschiedene Länderregelungen den Eindruck erwecken mögen, als sei dies anders zu handhaben. Beispielhaft sei hier auf den nordrhein-westfälischen „Leitfaden – Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ vom 12. November 2013 verwiesen, wo es auf S. 9 heißt: „Bei allen anderen, nicht WEA-empfindlichen Arten, die in Anhang 4 nicht näher genannt werden (z.B. Mäusebussard, Turmfalke, Schleiereule), ist im Sinne einer Regelfallvermutung davon auszugehen, dass die o.a. artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote in Folge der betriebsbedingten Auswirkungen von WEA grundsätzlich nicht ausgelöst werden.“ Der individuenbezogenen Prüfungsanforderung des Bundesverwaltungsgerichts wird diese Regelvermutung ganz und gar nicht gerecht! Hat man es also mit Standorten von WEA zu tun, die nahe an Horsten von Mäusebussard und Turmfalke oder deren bevorzugten Nahrungsflächen liegen und somit ein erhöhtes Tötungsrisiko erwarten lassen, ist ebenso von einem Verbotstatbestand auszugehen wie bei Rotmilan oder Weißstorch in einer entsprechenden Situation. Genau darauf geht die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Landkreistages (NLT 2014) ein und empfiehlt z.B. für Mäusebussard und Turmfalke einen Mindestabstand von 500 m und einen Prüfbereich von 1000 um deren Nester. Gleiches gilt für WEA-Standorte, die in Revieren von Feld- oder Heidelerchen errichtet werden sollen. Denn sie sind aufgrund ihres Flugverhaltens regelmäßig einem erhöhten Tötungsrisiko ausgesetzt, welches sich in der Totfundstatistik der Vogelschutzwarte Brandenburg niederschlägt.
In solchen Fällen ist die Annahme des Verbotstatbestandes nicht nur aus Gründen des Artenschutzes, sondern auch im Interesse des Investors geboten. Standardausreden in Planungsunterlagen und daran regelmäßig anknüpfend in Genehmigungen lauten etwa „Der Erhaltungszustand der Population verschlechtert sich nicht.“ oder „Die Tiere können ja ausweichen.“ Zu „Argument“ 1 ist festzustellen: Die Beurteilung des Tötungstatbestandes hat individuenbezogen zu erfolgen, hier wird jedoch, oftmals sogar ohne jegliche fachliche Grundlage, eine populationsbezogene Relativierung angeführt. Zu „Argument“ 2: Diese umgangssprachliche Formulierung lehnt sich an § 44 Abs.5 S.2 BNatSchG an, ist aber ausdrücklich ausschließlich als Legalausnahme für die Beschädigung von Lebensstätten eingeführt worden, nicht jedoch zur Vermeidung des Tötungstatbestandes!
Wird nämlich der Verbotstatbestand nicht festgestellt, können im Kollisionsfalle Haftungsfragen auf den Investor oder auf den Gutachter zukommen, weil nach Inbetriebnahme der Anlage Kollisionen erkannt und ein Umweltschaden geltend gemacht wird, aber vorher womöglich von Gutachterseite ausdrücklich in Abrede gestellt wurde (Otto 2009). Mittlerweile gibt es verschiedene Beispiele, in denen aufgrund erfolgter oder befürchteter Kollisionen die Stilllegung von WEA verfügt und dies auch durch Gerichte bestätigt wurde (Abschaltung einer WEA wegen des Tötungsrisikos für Wiesenweihen: Beschluss 5B1433/11 des VG Oldenburg vom 07. Juli 2011; Abschaltung von WEA wegen Kollisionsrisiken für Weißstörche: Beschluss 8B356/14 des OVG Münster vom 23. Juli 2014).
Während die Feststellung eines signifikanten Tötungsrisikos bei seltenen und/oder gefährdeten Arten, die im Wesentlichen Gegenstand der Fachkonvention sind, in den meisten Fällen einen Verzicht des Vorhabens oder aber dessen Modifikation nach sich ziehen wird (Verlagerung eines Standortes; Verkleinerung einer Windfarm; Abschaltzeiten während sensibler Phasen – so festgesetzt vom Landkreis Osnabrück im Fall einer Einzelanlage, um das Tötungsrisiko für Rotmilan und Rohrweihe zu reduzieren), weil die übrigen Ausnahmevoraussetzungen nicht gegeben sind, stellt sich dies für häufige und ungefährdete Vogelarten u.U. anders dar.
Sofern ein verträglicherer Standort ausgeschlossen werden kann und für die betroffenen Vogelarten zielgerichtete Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes ergriffen werden, besteht hier die Aussicht, dass eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs.7 BNatSchG zu einem positiven Ergebnis führt. Das zeigen erste Beispiele aus der jüngeren Genehmigungspraxis des Landkreises Osnabrück, der für die Arten Feldlerche, Turmfalke und Mäusebussard Ausnahmen erteilt hat. Im Heidekreis (Niedersachsen) hat man sich mit einer Ausnahme sogar an den Rotmilan herangetraut (dass hier dennoch eine zeitweilige Stilllegung von Anlagen verfügt wurde, hatte damit zu tun, dass der Investor die festgelegten Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt hatte).
Abgesehen davon, dass es in rechtlicher Hinsicht äußerst zweifelhaft erscheint, bei häufigen Arten die signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos einfach zu ignorieren, profitieren von einer korrekten Abarbeitung der Verbotstatbestände sowohl der Antragsteller als auch der Artenschutz: Der Investor erhält auf dem Ausnahmeweg mit der „Lizenz zum Töten“ Rechtssicherheit, wenn es an seinen Anlagen während des Betriebes zu Kollisionen dieser Arten kommt, muss vorher aber zielgerichtete Maßnahmen zur Stützung ihrer Populationen ergreifen. Mehraufwendungen müssen damit insgesamt nicht verbunden sein, wenn die Maßnahmen sinnvoll in das Kompensationskonzept eingebunden werden.
Problematischer stellen sich die Aussichten auf einen für den Antragsteller positiven Ausgang einer Ausnahmeprüfung allerdings für insgesamt seltene und/oder gefährdete Vogelarten dar. Für sie liegt nicht nur auf der Hand, dass sich in der artenschutzrechtlichen Abwägung das Gewicht des öffentlichen Belangs „Energiegewinnung durch WEA“ in Richtung des öffentlichen Belangs „Wahrung der Artenvielfalt“ verschiebt. Es ist also kaum anzunehmen, dass für sie eine Ausnahme zur Regel werden kann. In fachlicher Hinsicht ist nämlich bei solchen Arten so ohne weiteres nicht einmal eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes zu verneinen, weil jedes einzelne Individuum für den Erhalt der Population relevant sein kann (siehe zum Schreiadler Böhner & Langgemach 2004 bzw. aufgrund der Vorbelastung beim Rotmilan auch in Brandenburg Bellebaum et al. 2011, 2013). Dieser Frage widmet die neue Fachkonvention der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten zwei besonders lange Kapitel („Populationsbiologische Aspekte – kumulative Effekte“, „Erläuterungen zu einzelnen Arten und Artengruppen“: S. 5-19).
5 Weiterer Erarbeitungsbedarf
Die „Fachkonvention Abstandsempfehlungen“ unterstreicht durch ihre umfangreiche Literaturauswertung in den allermeisten Fällen die bereits 2006 festgelegten Empfehlungen des sog. Helgoländer Papiers. Für die darin behandelten Arten kann daher von einem konsolidierten Wissen ausgegangen werden, welches bei der Auswahl und Bewertung von WEA-Standorten mit hoher Verlässlichkeit einsetzbar ist. Gleichwohl lässt die Konvention Lücken naturschutzfachlicher und artenschutzrechtlicher Art, die um einer rechtssicheren Planung willen mit der nächsten Überarbeitung geschlossen werden sollten:
Komplettierung des relevanten Artenspektrums
Neben den „Klassikern“ wie Rotmilan, Seeadler (Haliaeetus albicilla) oder Uhu (Bubo bubo) gilt das individuenbezogene Tötungsverbot des § 44 Abs.1 BNatSchG in völlig gleicher Weise auch für Vogelarten wie Mäusebussard, Turmfalke, Feld- und Heidelerche (Lullula arborea). An anderer Stelle können es weitere Arten sein, die regelmäßig oder sogar gehäuft Kollisionsopfer werden. Verwiesen sei z.B. auf die Stockente (Anas platyrhynchos), für die die Funddatei der Vogelschutzwarte Brandenburg in einem einzigen Windpark in Ostfriesland 32 Totfunde dokumentiert. Als Produkt reiner Zufallsbeobachtungen im Rahmen allgemeiner Bestandserfassungen kam es ebendort im Frühjahr 2014 zu weiteren elf Funden dieser Art, die offensichtlich allesamt Opfer von Kollisionen mit WEA geworden waren. Weite Teile des unmittelbaren Mühlenumfeldes waren dabei aufgrund der Feldbestellung überhaupt nicht einsehbar. Zur Vereinheitlichung der Genehmigungspraxis und für solche Planungsbüros, die nicht regelmäßig mit avifaunistischen und populationsökologischen Fragestellungen zu tun haben, sollte anhand der oben formulierten Merkmale das betroffene Artenspektrum vervollständigt und hierfür entsprechende Abstands- und Prüfradien definiert werden. Die bereits vorliegenden Erkenntnisse zur Biologie dieser Arten geben dies ohne zusätzliche Grundlagenforschungen her.
naturschutzfachliche Anforderungen an die Erteilung von Ausnahmen
Während die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei seltenen Arten (siehe Tabellen der „Fachkonvention Abstandsempfehlungen“ und Anmerkungen weiter oben) in der Regel ausscheiden dürfte, ist dies für häufigere Arten nicht von vornherein anzunehmen. Hier wären Empfehlungen hilfreich, die die fachlichen Anforderungen für die Beurteilung einer Ausnahmeerteilung formulieren.
Standards für Bestandserfassungen
Die Fachkonvention beschreibt und begründet zwar ausführlich zu beachtende Abstände und Prüfräume zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote bei der Errichtung von WEA, eine klare Vorgabe zu den Anforderungen für Bestandserfassungen der Brut- und Gastvögel fehlt jedoch. Ein ausdrückliches Votum zu den in Südbeck et al. (2005) für Umweltverträglichkeitsprüfungen und Landschaftspflegerische Begleitpläne formulierten Standards, wie sie der Niedersächsische Landkreistag schon seit 2005 aufgegriffen hat (NLT 2014), wäre mehr als hilfreich, zumal von Seiten mancher Planungsbüros in Bezug auf Erfassungsstandards ein „lockerer Umgang“ gepflegt wird und sich dadurch in Gerichtsverfahren hinein der Eindruck fortpflanzt, es gebe keine fachlichen Standards zur Erfassung der Avifauna und vorgelegte Erkenntnisse seien einer gerichtlichen Überprüfung deshalb nicht zugänglich.
Standardisierung der Bewertung von Rast- und Brutgebieten
Die Fachkonvention fordert zwar die Freihaltung von Gastvogellebensräumen internationaler, nationaler und landesweiter Bedeutung und spricht hier beispielhaft sogar Ackerpopulationen des Kiebitz an, sofern diese regionale Bedeutung aufweisen. Nach welchem Standard diese Wertigkeit bemessen werden soll, bleibt jedoch offen.
Anforderungen an Raumnutzungsanalysen
Die Mindestabstände und Prüfradien der Fachkonvention stellen gewichtige Anhaltspunkte für den Ausschluss von WEA dar. Gleichwohl kann es im Einzelfall gute Gründe geben, von diesen Werten abzuweichen. Wird der Windkraftnutzung nach pauschaler Anwendung der Mindestabstände nicht der vom Gesetzgeber geforderte Raum gegeben und dabei sogar nachweislich verträgliche Standorte ausgeschieden, wird das komplette Konzept eines Planungsraumes angreifbar. Deshalb sollten die Vogelschutzwarten die fachlichen Anforderungen formulieren, die an Raumnutzungsanalysen zur Differenzierung der Abstandsempfehlung zu stellen sind. Bisher bleibt es lediglich bei Empfehlungen, den Vorschlägen von Langgemach & Meyburg (2011) zu folgen. In dieser Hinsicht weiter ist erneut die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Landkreistages (NLT 2014), die auf S.16 klare Anforderungen formuliert.
Berücksichtigung des Vogelzuges
Die Fachkonvention fordert die Freihaltung von Hauptflugkorridoren und überregional bedeutsamen Zugkonzentrationskorridoren. Welche Merkmale solche Bereiche erfüllen müssen und welche Bestandserfassungen zu deren Ermittlung durchzuführen sind, ist jedoch noch festzulegen, sollen diese Anforderungen nicht ins Leere laufen.
systematisches Totfundmonitoring
Das Totfundmonitoring ist dominiert durch die systematische Arbeit vor allem in Brandenburg und „lebt“ darüber hinaus von Zufallsfunden, was mit einiger Sicherheit zu einem schiefen Bild führt (siehe das weiter oben beschriebene Beispiel zur Stockente). So darf angenommen werden, dass eine systematische Totfundsuche in Windparks an der Nordseeküste ziemlich schnell zu einem deutlichen Aufstieg der einheimischen Möwenarten im Todes-„Ranking“ führen würde. Davon sind aber nicht nur „irgendwelche“ Möwen betroffen, sondern Erhaltungszielarten der vorgelagerten Nationalparks, die bei ihren Nahrungsflügen aufs Festland nun einer erhöhten Mortalität ausgesetzt sind und so der Erhaltungszustand der Populationen innerhalb des Natura-2000-Gebietes nachteilig beeinflusst wird.
Mit dem Vordringen der Windkraftnutzung in bewaldete Bereiche ist ferner mit einer Verschiebung hin zu waldbewohnenden Arten zu rechnen (siehe z.B. Dorka et al. 2014). Zu fordern ist deshalb, zusätzlich zur Sammlung von Zufallsfunden ein bundesweit standardisiertes Monitoring an repräsentativ ausgewählten Parks und Einzelanlagen zu organisieren, um zu einem verlässlichen Bild vom Kollisionsrisiko an WEA zu kommen.
Anforderungen an ein Repowering
Aus Gründen des Vogelschutzes reicht es nicht aus, Anforderungen an den künftigen Zubau von WEA zu formulieren. Trotz aller Bemühungen um den Klimaschutz und aller Euphorie beim Ausbau der Windkraft sollte nämlich erinnert werden, dass z.T. eklatante Sünden der Vergangenheit zu bereinigen sind. Beispielhaft sei auf eine Reihe von Windparks und Einzelanlagen in ostfriesischen EU-Vogelschutzgebieten verwiesen, die dort aus naturschutzfachlicher und rechtlicher Sicht nie hätten errichtet werden dürfen. In Rheinland-Pfalz wurde eine Windfarm aufgestellt, in der bis heute bereits drei Uhus zu Tode kamen. Bei dem Standort handelt es sich vermutlich um ein faktisches Vogelschutzgebiet zum Schutz des Uhus (EGE 2014). An anderer Stelle sind sowohl die Grenzen der Umwelt- als auch der Sozialverträglichkeit längst überschritten. Deshalb sollten Anforderungen an eine „Flurbereinigung“ der Windparklandschaft formuliert und einschlägige Anlagen und Parks in einer Liste für vorrangigen Ab- oder Umbau zusammengestellt werden.
Störungsverbot nach § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG
Die vornehmliche Fokussierung auf Kollisionsrisiken an WEA hat die Frage nach deren Störungseffekten gegenüber Brutvögeln in den Hintergrund treten lassen. Analog zu den Ergebnissen des BMVBS (2010), wonach die straßenverkehrsbedingten Effekte als ein Bündel aus Lärm, Bewegungsreizen und Lichteffekten regelmäßig zu reproduktionsmindernden Störungen führen, sollte untersucht werden, ob ähnliche Auswirkungen nicht auch von WEA ausgehen (s.o.). Mit Blick auf die oben diskutierten Konsequenzen für eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung müssten sich festgestellte nachteilige Effekte zumindest in einer an den spezifischen Bedürfnissen der betroffenen Vogelarten orientierten Kompensation bzw. entsprechenden Maßnahmen zur Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes niederschlagen.
6 Schlussbemerkung
Die ressourcenschonende Nutzung von Energie ist ein hohes umweltpolitisches und gesellschaftliches Ziel. Die Wahrung der Artenvielfalt bzw. ihre Restaurierung ist ein ebensolches und genießt über Artikel 20a Grundgesetz sogar den Rang eines Staatszieles. In einer zunehmenden Zahl von Fällen geraten sie jedoch in Konflikt, die – ebenso zunehmend – erst vor Gericht entschieden werden. Ursache hierfür sind fast immer unzureichende Sachverhaltsermittlungen, fehlende Sorgfalt in der Planung und die Erwartung, andere Belange hätten hinter der Rettung des Klimas und der Realisierung der Energiewende gefälligst zurückzutreten, insbesondere der Schutz einzelner Vögel oder Fledermäuse. Diese Erwartungshaltung ist durch politische Zielvorgaben genährt worden. Gerade Politiker, die sich ökologischen Fragen verpflichtet fühlen, sollten sich jedoch darauf besinnen, dass es auf dem Feld des Umweltschutzes neben der Energiefrage weitere Probleme zu bewältigen gilt und „Ökologie“ nie als einfache Ursache-Wirkung-Beziehung zu handhaben ist. Und in politischer Hinsicht wäre zu bedenken: Wie die jüngste Parteiengeschichte gezeigt hat, kann eine thematische Verengung des Blickwinkels letale Risiken und Nebenwirkungen für das politische Überleben von Parteien bergen, die nicht unter dem Schutz des § 44 Abs.1 BNatSchG stehen.
Dank
Ich danke Wilhelm Breuer, Geschäftsführer der Europäischen Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen (EGE), Prof. Dr. Martin Gellermann, Westerkappeln, und anonymen Gutachtern von Naturschutz und Landschaftsplanung für die Durchsicht des Manuskripts und wertvolle Hinweise.
Literatur
Behm, K., Krüger, T. (2013): Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in Niedersachsen. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 33 (2), 55-69.
Bellebaum, J., Korner-Nievergelt, F., Mammen, U. (2011): Rotmilan und Windenergie in Brandenburg – Auswertung vorhandener Daten und Risikoabschätzung. Unveröff. Gutachten.
–, Korner-Nievergelt, F., Dürr, T., Mammen, U. (2013): Wind turbine fatalities approach a level of concern in a raptor population. Journal Nature Conservation 21, 394-400.
Böhner, J., Langgemach, T. (2004): Warum kommt es auf jeden einzelnen Schreiadler Aquila pomarina in Brandenburg an? Ergebnisse einer Populationsmodellierung. Vogelwelt 125, 271-281.
Dorka, U., Straub, F., Trautner, J. (2014): Windkraft über Wald – kritisch für die Waldschnepfenbalz? Erkenntnisse aus einer Fallstudie in Baden-Württemberg (Nordschwarzwald). Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (3), 69-78.
EGE (Europäische Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen, 2014): Wie kollisionsgefährdet sind Uhus an Windenergieanlagen? Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (8), 256-257.
EU-Kommission (2000): Die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips. Mitteilung der Kommission. 32 S.
Garniel, A., Daunicht, W.D., Mierwald, U., Ojowski, U. (2007): Vögel und Verkehrslärm. Quantifizierung und Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna. Schlussbericht November 2007 (02.237/2003/LR). Unveröff. Gutachten.
Gellermann, M., Schreiber, M. (2007): Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen in staatlichen Planungs- und Zulassungsverfahren. Schr.-R. Natur u. Recht 7, 519S.
Isselbächer, K., Isselbächer, T. (2001): Vogelschutz und Windenergie in Rheinland-Pfalz. Gutachten zur Ermittlung definierter Lebensraumfunktionen bestimmter Vogelarten (Vogelbrut-, -rast- und -zuggebiete) in zur Errichtung von Windkraftanlagen geeigneten Bereichen von Rheinland-Pfalz. GNOR e.V. im Auftrag Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, 183S.
IUCN (2007): Guidelines for applying the precautionary principle to biodiversity conservation and natural resource management. Meeting of the IUCN Council 14-16 May 2007.
Krüger, T., Ludwig, J., Südbeck, P., Blew, J., Oltmanns, B. (2013): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 33 (2), 70-87.
LAG VSW (Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, 2007): Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. Ber. Vogelschutz 44, 151-153.
– (2014): Fachkonvention „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“. Unveröff. Entwurf, 13.05. 2014.
Langgemach, T., Meyburg, B.-U. (2011): Funktionsraumanalysen – ein Zauberwort der Landschaftsplanung mit Auswirkungen auf den Schutz von Schreiadlern (Aquila pomarina) und anderen Großvögeln. Ber. Vogelschutz 47/48, 167-181.
Meyburg, B.-U., Meyburg, C., Franck-Neumann, F. (2007): Why do female Lesser Spotted Eagles (Aquila pomarina) visit strange nests remote from their own? J. Ornithol. 148, 157-166.
NLT (Niedersächsischer Landkreistag, 2011): Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie: Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und UVP bei Standortplanung und Zulassung von WKA (Stand: Oktober 2011). 35 S.
– (2014): Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie: Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und UVP bei Standortplanung und Zulassung von WKA (Stand: Oktober 2014). 37S. Download: http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_ 01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie __5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeits hilfe.pdf .
Otto, C.W. (2009): Die Auswirkungen des Umweltschadensrechts auf die Bebauungsplanung und das Baugenehmigungsverfahren. ZfBR 2009 (4), 330-339.
Richarz, K., Hormann, M., Werner, M., Simon, L., Wolf, T., Störger, L., Berberich, W. (2012): Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz – Artenschutz (Vögel, Fledermäuse) und NATURA 2000-Gebiete (Stand: 13.09.2012). 145 S. Download: http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4650/e4652/NatSch-fachlRahmen_WindenergieRP_Natura200_ArtSch_2012-09-13_VSW-LUWG_final.pdf.
–, Hormann, M., Braunberger, C., Caspari, S., Harbusch, C., Süssmilch, G. (2013): Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung im Saarland – Artenschutz (Vögel, Fledermäuse) und NATURA 2000-Gebiete. 112S. Download: http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf .
Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.
Anschrift des Verfassers: Dr. Matthias Schreiber, Blankenburger Straße 34, 49565 Bramsche, E-Mail Schreiber.Umweltplanung@t-online.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


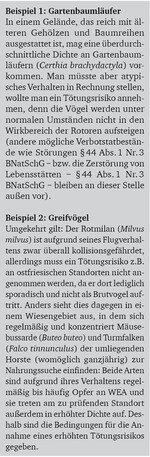
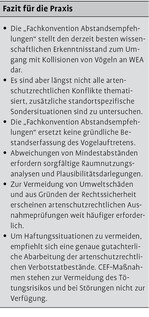
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.