Citizen Science als Beitrag zum Schutzgebietsmanagement?
Abstracts
Dieser Beitrag widmet sich den möglichen Leistungen von Citizen Science für wissenschaftliche Aussagen, Schutzgebietsmanagement und Planung am Beispiel von Streuobstbeständen in einem österreichischen Naturpark. Betrachtet werden die Anforderungen an den Aufnahmebogen, an die Vorbereitung auch im Hinblick auf mögliche Kommentare der Grundstückseigentümer sowie die Frage, ob und wieweit mit einfachen Grundlagenerhebungen relevante Beiträge für das Naturparkmonitoring und -management geleistet werden können. Die erhobenen Daten zeigen, dass der Streuobstbestand, der auf einer repräsentativen Teil des Naturparks untersucht wurde, erheblich überaltert ist. Insgesamt sind zwei Drittel der Streuobstbestände gefährdet.
Das Beispiel belegt, dass wichtige Beiträge für das Management und Fachplanungen geleistet werden können – wenn einfache Aufgabenstellungen zu formulieren, deren Wert und Bedeutung für die naturschutzfachliche Arbeit klar umrissen sind. Allerdings darf der Aufwand für Auswertung und Visualisierung der Daten nicht unterschätzt werden. Naturparke und andere Schutzgebiete mit Gebietsbetreuung könnten diese Unterstützung gewährleisten und daher mehr als bisher von gut geplanten Citizen-Science-Aktivitäten profitieren.
Citizen Science as Contribution to the Management of Protection Areas – A conceptual investigation using the example of traditional orchards in the Nature Reserve ‘Pöllauer Tal’
The paper investigates the potential contribution of citizen science for the scientific evaluation, management and planning of an Austrian nature park. The paper discusses the requirements for data collection, the preparation of citizen scientists to interact with land owners and whether and how citizen science may contribute to monitoring and management of the park. First results based on a representative part of the park show that the majority of traditional orchards are overmature. Altogether two thirds of all orchards are endangered.
The exemplary results show that important findings for management and planning can be generated if the exercise is reduced to simple and clear tasks. However the overall effort for data management, analysis and visualisation should not be underestimated. Nature parks and other protection areas should be able to ensure the relevant coordination and benefit more than they currently do from well organised citizen science activities.
- Veröffentlicht am

1 Einführung
In vielen Beiträgen wird die Bedeutung des Laienmonitorings vor allem im Zusammenhang mit der Bewusstseinsbildung hervorgehoben (Bremer et al. 2006, Holzner et al. 2006: 121). So zählt auch das neu eingeführte sogenannte „Bauernmonitoring“ (ÖKL 2012), ebenso wie die Monitoringprojekte mit Schulklassen, zu den klassischen Bildungsprojekten. Vielen Autoren zufolge kommt es weniger darauf an, dass Arten richtig bestimmt werden, als vielmehr auf die Beschäftigung mit dem Objekt, mit der Natur und mit naturschutzfachlichen Inhalten. In diesem Beitrag möchten wir an einem Fallbeispiel der Frage nachgehen, ob Laienmonitoring unter bestimmten Voraussetzungen nicht doch mehr kann, als „nur“ für die Natur zu interessieren und welche Voraussetzungen dazu gegeben sein müssen. So liegt diesem Beitrag die Frage zugrunde, ob und in welcher Weise Citizen Science im Rahmen eines Schutzgebietsmanagements und bei den Bemühungen um eine Qualitätssicherung in Schutzgebieten eingesetzt werden kann. Als Grundlage für diese Diskussion dient eine Studie im Naturpark Pöllauer Tal und das dort entwickelte Konzept für ein Laienmonitoring.
2 Das Untersuchungsgebiet: der Naturpark Pöllauer Tal
Der österreichische Naturpark Pöllauer Tal befindet sich in der Oststeiermark und wurde bereits 1983 eingerichtet. Er umfasst die sechs Gemeinden mit insgesamt ca. 8500 Einwohnern auf einer Fläche von rund 122 km². Das zwischen etwa 550 und 650m Seehöhe gelegene Gebiet zeichnet sich trotz der Lage in den Ostausläufen der Alpen durch eine klimatische Gunstzone aus. Das Talbecken stellt sich als nebelarm dar und weist aufgrund eines häufigen Nordföhns und eines autochthonen Talwindsystems eine gute Durchlüftung auf. Da nur eine mäßig hohe Frostgefährdung vorliegt, ist bereits nahe der Talsohle der Anbau von Obstkulturen und Wein möglich (Wilfling & Möslinger 2005: 30 f). Grund für die Ausweisung des Naturparks war seine herausragende landschaftliche Schönheit durch die vielfältige und kleinstrukturierte Landschaft mit dem Wechsel von Wiesen, Wäldern, zahlreichen Streuobstwiesen und Ackerflächen.
In der Steiermark wird in den Naturparken besonderer Wert auf den Schutz der naturräumlichen Grundlagen gelegt. Im Naturpark Pöllauer Tal sind dieses vor allem die alten Streuobstwiesen, Extensivgrünland und die kleinstrukturierte Landschaft mit Hecken und Rainen. Im Mittelpunkt naturschutzfachlicher Bemühungen steht daher der „Schutz durch Nutzung“, der in besonderem Maße die Streuobstbestände betrifft. Die attraktive Erholungslandschaft wird durch familienfreundliche Wanderwege, Erlebnisspielplätze, Rad- und Reitwege für Touristen und Ausflügler erschlossen. Diese Angebote tragen – wie Befragungen der Einwohner zeigen (Pröbstl & Schuster 2011) – auch zu Erhöhung der Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung bei. Ein umfangreiches Bildungsangebot für Urlauber und Einheimische prägt den Naturpark. Dazu gehören u.a. Erlebnisführungen, Themenwege, Seminare, Ausstellungen und zahlreiche Veranstaltungen. Eine wichtige Rolle spielen in der Steiermark auch die sogenannten Naturparkschulen. Sechs von acht Schulen im Naturpark Pöllauer Tal erfüllen die besonderen Anforderungen an Naturpark-Schulen und nutzen den Naturpark aktiv als Lernort. Im Hinblick auf die Regionalentwicklung durch den Naturpark steht die Vermarktung des Naturparks als Genussregion rund um die Hirschbirne, eine lokale vorkommende Mostbirne alter Streuobstwiesen, im Mittelpunkt. In Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Tourismus, Gewerbe und Kultur erfolgt die Entwicklung neuer Produkte vom Hirschbirn-Leberkäs, über Hirschbirneneis, Hirschbirnenessig, Saft, Schnaps oder Schokolade bis hin zum Hirschbirndirndl und einem regionalen Kochbuch. Durch die regionalwirtschaftlichen Impulse, einen sozial- und umweltverträglichen Tourismus sowie durch die Vermarktung von Naturparkprodukten und Spezialitäten besitzt der Naturpark einen hohen Rückhalt in der Bevölkerung (Pröbstl & Schuster 2011).
Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage, ob und in welcher Weise Laienmonitoring in diesem Naturpark eingesetzt werden könnte, dessen wesentliche Ziele auf die Erhaltung der besonderen Kulturlandschaft ausgerichtet sind.
Der Landschaftscharakter des Naturparks Pöllauer Tal (Abb. 1), aber auch das touristische Profil und die regionalwirtschaftlichen Impulse hängen stark von der Erhaltung markanter Streuobstbestände ab.
3 Methode
Der Naturpark Pöllauer Tal verfügt als einer der wenigen Naturparke in Österreich über eine ausführliche Grundlagenarbeit im Hinblick auf ein professionelles Naturschutzmonitoring (Wilfling & Möslinger 2005). Überprüfungen dieser Datengrundlage im Bereich der wertvollen Streuobstwiesen ergaben, dass in Teilen des Naturparks bereits erhebliche Verluste zu verzeichnen sind (Greylinger et al. 2010). Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der aktiven Naturparkschulen entstand die Idee, ob und wieweit für ausgewählte Lebensräume, wie die Streuobstwiesen, Laien für diese Aufgabe gewonnen werden können. Dazu mussten für die potenziellen Zielgruppen, wie interessierte Personen aus dem Naturpark, aber auch engagierte Erholungssuchende und Urlauber, aber auch für die möglichen Betreuer auf Seiten des Naturparks zunächst regional einsetzbare Unterlagen erstellt werden. Dazu gehört neben einem standardisierten Aufnahmebogen (vgl. Abb. 2) auch Erläuterungs- und Schulungsmaterial, das die einzelnen zu erhebenden Merkmale differenziert anhand von Bildmaterial und Schemazeichnungen erläutert.
Abb. 2 zeigt den Aufnahmebogen für eine Flurnummer. Zu den einzelnen zu erhebenden Merkmalen gibt es gesonderte Erläuterungen in Text, Bild und Zeichnung zur Einschulung.
In einem zweiten Schritt wurde ein Teilbereich des Naturparks, die Katastralgemeinde Hinteregg (ehemals selbständiger Ortsteil der Gemeinde Schönegg), ausgewählt, um die folgenden drei Aspekte zu überprüfen:
1. Enthalten der Aufnahmebogen und die Erläuterungen alle vorkommenden Fallkonstellationen und ist er praxistauglich?
2. Wie ist die Reaktion der Grundeigentümer, gibt es Schwierigkeiten und Widerstände, die ggf. einem Laienmonitoring entgegenstehen oder die bei Vorbereitung und Schulung zu berücksichtigen sind?
3. Wenn die Aufnahmen erfolgreich durchgeführt werden, welche Relevanz für die örtliche naturschutzbezogene Arbeit darf von den Ergebnissen in der Region erwartet werden?
Von August bis Oktober 2011 wurde die Begehung der Katastralgemeinde Hinteregg durchgeführt und alle vorgefundenen Streuobststrukturen kartiert. Mithilfe des Erhebungsbogens wurden Lage und Größe der Strukturen, Anzahl, Alter und Pflegezustand der Obstbäume, Nutzungsart und intensität, Vorkommen ökologisch wertvoller Strukturen in den Beständen, Beeinträchtigungen sowie notwendige Pflegemaßnahmen für die einzelnen Bestände erfasst. Insgesamt wurden 7469 Obstbäume aufgenommen, die sich auf 640 Streuobstbestände verteilen. 620 Bestände konnten vollständig, 20 Bestände nur teilweise aufgenommen werden, da entweder die Erlaubnis zum Betreten nicht gegeben wurde oder die Bestände nicht zugänglich waren. Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, werden die 20 unvollständig erhobenen Streuobstbestände in die Analyse und Datenauswertung nicht miteinbezogen. Die Auswertung bezieht sich somit auf 620 Streuobststrukturen mit 7399 Bäumen.
Die Ergebnisse wurden weiterhin in einer Flurkarte und einem Luftbild digital erfasst, um die Ergebnisse nicht nur in Tabellen, sondern auch in Karten visualisieren zu können.
Äußerungen der Grundbesitzer wurden unmittelbar nach Abschluss der Kartierarbeiten auf der jeweiligen Flurnummer protokolliert. Ziel der hier dargestellten Auswertung ist es, anhand der konkreten Erfahrungen und Ergebnisse interessierte Personen motivieren zu können und darzulegen, was Laienmonitoring zu leisten imstande ist und welche beeindruckenden Ergebnisse ihre Arbeit liefern kann.
4 Ergebnisse
4.1 Eignung des Erhebungsbogens
Bei der Erstellung der Erhebungsmethode war eine Abwägung erforderlich zwischen den wichtigsten Aufnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht einerseits und einer möglichst einfachen Durchführbarkeit durch unterschiedliche Zielgruppen andererseits. Das bedeutete Abstriche bei der Aufnahmetiefe. Beispielsweise hätte eine Einteilung der Obstgehölze in fünf Entwicklungsphasen (Jugendphase, ansteigender Ertrag, Ertragsphase, Altersphase, Abgangsphase) detailliertere Ergebnisse zum Altersaufbau geliefert als die verwendete Einteilung in nur drei Altersklassen (Bünger 1996: 111f.), die jedoch verständlicher ist und mit einer geringen Fehlerwahrscheinlichkeit umgesetzt werden kann. Dieses gilt auch für die Bewertung des Pflegezustands, bei dem eine getrennte Bewertung der Pflegequalität und des Baumzustands detailliertere Ergebnisse hervorbringen kann, oder die Empfehlung notwendiger Maßnahmen, bei der etwa genauere Angaben zu notwendigen Schnittmaßnahmen (Erziehungsschnitt, Regenerationsschnitt etc.) hätten aufgenommen werden können. Die Erhebung der Stammhöhen, des Baumabstands oder der Umgebungsstrukturen von Streuobstbeständen stellen weitere mögliche Aufnahmeparameter dar, die interessante Erkenntnisse über den Streuobstbestand liefern können, hier aber bewusst ausgespart wurden.
Trotz dieser Einschränkungen erwies sich die vorliegende Kartiermethode bei verschiedenen Testpersonen als in der Praxis gut und einfach anwendbar. Trotz der beigefügten Erläuterungen zu den einzelnen Aufnahmekriterien sollte bei Streuobst-Monitoring mit Freiwilligen eine ausführliche Einschulung vorgesehen werden. Diese dient der Absicherung der Teilnehmer und trägt wesentlich zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse bei. Das gilt insbesondere für die Alterseinteilung der Bäume und die Zustandsbewertung. Empfohlen wird dazu eine Vorveranstaltung, die Idee, Vorgehen und Ziele des Lebensraumsmonitorings vorstellt. Daran sollte ein weiteres Treffen mit Ortsbegehung anschließen, bei dem zunächst die Bäume von jedem Teilnehmer auf einer Fläche getrennt bewertet und anschließend die Ergebnisse diskutiert werden.
Eine entscheidende Rolle spielt, wie sich zeigte, der Erhebungszeitraum, da von Laien meist nur in den Herbstmonaten eine sichere Ansprache der Obstarten erwartet werden kann. Bei Unsicherheiten oder Aufnahmezeitpunkten im Frühsommer kann auch auf diese Spezifizierung nach Obstarten verzichtet werden und nur die naturschutzfachlich wichtige Altersstruktur der Bestände und deren Vielfalt aufgenommen werden. Unsicherheiten gab es auch bei Einträgen in die Kategorie der Pflegemaßnahmen, was Baumschnitt und Baumbehandlung anging sowie im Hinblick auf Baumkrankheiten. Für die zentralen Aussagen und die Datengrundlagen, die im Naturpark derzeit gebraucht werden, spielen diese Defizite keine entscheidende Rolle (siehe Abschnitt 4.3).
4.2 Reaktion der Grundeigentümer
Wie die Untersuchung zeigt, muss im ländlichen Raum immer davon ausgegangen werden, dass ein flurstücksbezogenes Monitoring, die Besichtigung von Bäumen und die Dokumentation in Erhebungsbögen vor allem auf siedlungsnahen Wiesen auf Reaktionen durch die Eigentümer stoßen, auf die die Freiwilligen unbedingt vorher hingewiesen werden müssen. Typische Fragestellungen sollten bei der Auftaktveranstaltung angesprochen werden. Insbesondere ein schlechter Erhaltungszustand der Bäume führt bei vielen Besitzern zu einer spontanen Erläuterung der Ursachen und Hintergründe. Die wichtigsten Aspekte sind nachstehend aufgelistet. Trotz der Produktentwicklung rund um das Streuobst im Naturpark entspricht der Aufwand für das Sammeln der Früchte nicht dem Ertrag. In den meisten Fällen wird das Streuobst in Hinteregg zur Versorgung des eigenen Bedarfs, zur Weitergabe an die Verwandtschaft sowie zur Saft- und Schnapsproduktion verwendet. Nur wenige Betriebe haben sich auf die differenzierte Verwertung u.a. von Dörrobst spezialisiert. Typische Äußerungen sind daher:
„Der Treibstoff für die Fahrt zum Abnehmer kostet mich mehr als ich für das Obst bekomme.“
„Es ist zu viel Arbeit und man kriegt für das Obst ja nichts.“
Als weitere Begründung für ein abnehmendes Interesse bzw. eine unzureichende Verjüngung und Pflege von Streuobstbeständen wird der Generationswechsel in der Landwirtschaft angeführt:
„Die Jungen haben kein Interesse mehr an Streuobst. Wenn wir einmal nicht mehr sind, dann verkommen die Bäume.“
„Mit der Förderung durch ÖPUL (d.h. Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft, Anm. der Verfasser) bin ich zwar zufrieden, aber ich werden keinen Vertrag mehr abschließen, weil ich aus Altersgründen bei der Baumpflege von Anderen abhängig bin.“
Zu den Folgen des Generationswechsels gehört vielfach auch der Wunsch der jüngeren Betriebsleiter, große, effizient zu bewirtschaftende Einheiten herzustellen, denen die Bäume dann zum Opfer fallen:
„Die Bäume stehen beim Mähen nur im Weg.“
Weitere Äußerungen beziehen sich auf die Veränderungen bei den angebotenen Sorten und Qualitäten, die eine Fortführung des Streuobstbaus in der traditionellen Form erschweren.
„Ich pflanze keine neuen Bäume mehr, weil die Sorten, die ich haben will, nirgends erhältlich sind.“
In diesem Zusammenhang wurden dann auch Wünsche nach Jungbaumaktionen zu vergünstigten Bezügen mit Schwerpunkt auf regionale Obstsorten geäußert, die zu Nachpflanzungen motivieren würden.
Auch die Beziehung zwischen den Streuobstwiesen und dem Marketing des Naturparks wird kritisch diskutiert:
„Ein paar Leute profitieren vom Naturpark, aber wir haben nichts davon.“
Die Gespräche mit Grundeigentümern haben gezeigt, dass die Aufmerksamkeit, die durch das Laienmonitoring auf die Bestände gerichtet wird, auch die Wertschätzung der Bestände erhöhen kann. In seiner Reaktion auf „beeindruckende alte Birnbäume, die es nur hier gibt“, trägt der Kartierer u.U. auch wesentlich zu ihrer Erhaltung bei. Deutliche Kritik kann im umgekehrten Fall den Prozess der Beseitigung noch beschleunigen. Diese Zusammenhänge sind mit den Freiwilligen im Rahmen der Einschulung zu diskutieren. Auch sollte immer vermittelt werden können, wann und wo die Ergebnisse durch die Besitzer eingesehen werden können.
Bis auf einzelne Ausnahmen ergaben sich bezogen auf die Kartierungen keine Schwierigkeiten oder Widerstände. Ein lebendiges Interesse an der Studie und ihren Ergebnissen dominierte.
4.3 Relevanz für die örtliche naturschutzbezogene Arbeit
Um die Relevanz der Aufnahmen herauszustellen, sollen nur einige wenige Aspekte der Aufnahmen herausgegriffen werden, wie Flächengröße, Lage und Alter der Bäume.
Allein diese wenigen Aspekte unterstreichen, welche Bedeutung solchen Daten zukommen kann.
Flächen- und Bestandsgröße
Nachdem in der Nachkriegszeit dem Obstbau eine wichtige Rolle bei der Nahrungsmittelversorgung zukam, gibt es für Hinteregg eine Obstbaumzählung aus dem Jahr 1947, die den aktuellen Daten gegenüber gestellt werden kann (Tab. 1).
Demnach ging der Bestand an Streuobstbäumen in Hinteregg innerhalb von 64 Jahren um 52 % zurück und hat sich damit mehr als halbiert. Bei Apfelbäumen ist die größte Abnahme zu verzeichnen, gefolgt von den Birnbäumen. Bis auf die Nussbäume, deren Zahl sich in diesem Zeitraum annähernd verdoppelt hat, ist bei allen Obstarten ein Rückgang der Baumzahlen gegeben. Allerdings ist bei Nussbaum eine Naturverjüngung möglich, was die positive Bilanz sicher stark beeinflusst.
Der Gesamtanteil von ca. 4,6 % der Streuobstwiesen auf der Gemeindefläche entspricht in etwa auch dem anderer Naturparkgemeinden (vgl. Wilfling & Möslinger 2005).
Nach Schramayr & Reiterer (2002: 170 und 176) können Streuobststrukturen mit einer Fläche von 0,5 ha und darüber als große Bestände angesehen werden, bei weniger als 0,2 ha spricht man von sehr kleinen Beständen. Bei Bünger (1996: 39) werden bereits Streuobstbestände bis 0,5ha als sehr klein bezeichnet. Ein charakteristisches Merkmal des Streuobstbestands in Hinteregg stellt demnach die extreme Kleinflächigkeit dar. Mehr als die Hälfte der Bestände sind kleiner als 0,25 ha. Ein durchschnittlicher Streuobstbestand in Hinteregg umfasst eine Fläche von 1000 m2 und besteht aus zwölf Obstbäumen. Die geringe Größe der Bestände hinsichtlich Fläche und Baumanzahl hat mehrere Auswirkungen. Die Ausdehnung eines Bestandes hat Einfluss auf seine Störanfälligkeit und seine Eignung für anspruchsvolle Tierarten (Kornprobst 1994: 100). Die vielen kleinflächigen Streuobstbestände in Hinteregg sind zudem besonders stark durch Nutzungswandel bedroht.
Der Biotoptyp Streuobst entfaltet sein Potential als Lebensraum für Tier- und auch Pflanzenarten erst ab einer bestimmten Flächengröße. Lucke et al. (1992: 49) führt als Mindestnorm eine Flächengröße von 0,3ha an, Bestände über 1ha sind als Lebensraum noch wirkungsvoller. Streuobstbestände mit mehr als 1ha sind in Hinteregg die absolute Ausnahme, lediglich 3,5 % der aufgenommenen Streuobststrukturen erreichen eine Flächengröße von 0,5 ha.
Auch für eine mögliche Inanspruchnahme ökologischer Förderprogramme spielen Flächengröße und Baumbestand von Streuobstbeständen eine wesentliche Rolle. Damit Streuobstbestände im Rahmen des derzeitigen ÖPUL-Programms förderbar sind, müssen sie neben der Mindestbaumanzahl von fünf Bäumen einen Mindestbaumabstand von 30 Bäumen pro Hektar und eine Fläche von zumindest 0,1ha aufweisen (Biotoptypenkatalog der Steiermark 2008 und ÖPUL 2007). Ein Drittel der Streuobstfläche in Hinteregg erfüllt somit nicht die Voraussetzungen für eine Förderung im Rahmen von ÖPUL.
Lage und Verteilung
Diese kritische Einschätzung relativiert sich etwas, wenn man die Lage und Verteilung im Raum ansieht. Abb.3 zeigt den Wald- und Offenlandanteil in Hinteregg sowie die Anordnung der aktuellen Streuobstbestände. Die Darstellung veranschaulicht, dass sich die Streuobststrukturen relativ gleichmäßig über den Offenlandbereich verteilen. Die meisten Haushalte in Hinteregg besitzen noch zumindest einige Streuobstbäume. Im bereits beschriebenen nördlichen Teil von Hinteregg liegt eine relativ gute Vernetzung der Streuobststrukturen untereinander vor. Die Obstbaumreihen in der freien Flur sind hierfür von besonderem Wert. Die hier bestehenden Streuobststrukturen sind meist kleinflächiger und liegen isolierter vor. Besonders im südlichen Teil Hintereggs würden Neupflanzungen zu einer verbesserten Vernetzung extensiver Landschaftselemente innerhalb des intensiv genutzten Offenlandes beitragen. Die Lage der Streuobstbestände hat nicht zuletzt auch für das Landschaftsbild in Hinteregg eine große Bedeutung. Besonders die Bestände zwischen den landwirtschaftlichen Kulturen tragen zur Auflockerung und Strukturierung des Landschaftsbildes bei.
Altersstruktur
Die Aufnahmen ergaben im Hinblick auf die Altersstruktur kritische Ergebnisse. Der Gesamtbestand besteht mehrheitlich aus überalterten Bäumen. So setzen sich 70 % aller Bestände überwiegend aus Altbaumbestand zusammen. Das ist in Abb. 4, die die Bestände nach Altersstruktur differenziert darstellt, besonders gut zu erkennen.
Die meisten der mindestens 50 Jahre alten Obstbäume – hier in roter Farbe dargestellt – haben ihr Ertragsmaximum bereits überschritten und gehen dem Ende ihres Lebensalters entgegen.
Mit 6 % Jungbaumanteil am Gesamtbestand ist eine Bestandserneuerung in Frage gestellt. Eine Nachpflanzung junger Obstbäume geschieht nur in einem Fünftel der Bestände. 30 % aller Streuobstbestände weisen bereits einen lückenhaften Bestand auf.
Es ist daher damit zu rechnen, dass die eingangs beschriebene Bestandsentwicklung anhält und ein beträchtlicher Teil des Streuobstbaumbestands in absehbarer Zeit aufgrund von Überalterung verschwinden wird. Gefährdet sind zwei Drittel der Streuobstbestände. Nur rund 15 % der Streuobstbestände in Hinteregg können in Bezug auf ihren Altersaufbau als längerfristig gesichert angesehen werden, da in diesen Beständen junge Bäume nachgepflanzt werden und mittelalte bzw. junge Obstbäume dominieren.
Die Relevanz der erhobenen Daten lässt sich dann sehr anschaulich zeigen, wenn man sich ihre Konsequenzen für die Landschaft und die herausragenden Merkmale des Naturparks vor Augen führt.
Die 419 bis zu zehn Jahre alten Obstbäume, die in Hinteregg erhoben wurden, entsprechen sechs Prozent des gesamten Baumbestands. Dieses Ergebnis offenbart, dass die aktuelle Nachpflanzung junger Bäume in Hinteregg nicht ausreicht, um den derzeitigen Streuobstbestand langfristig zu erhalten. Der voraussichtlich hohe Abgang vieler Obstbäume aufgrund von Überalterung kann mit der derzeitigen Nachpflanzungsleistung nicht kompensiert werden. Bei dem Gesamtbestand von 7234 Bäumen (abgestorbene Bäume exkludiert) wäre für einen Jungbaumanteil von zehn Prozent eine Nachpflanzung von weiteren 304 Obstbäumen notwendig, für einen 15-%igen Jungbaumanteil müssten rund 670 Obstbäume neu gepflanzt werden. Hinzu kommt, dass sich die bestehenden Jungbäume sehr ungleichmäßig auf die Streuobstbestände verteilen und junge Streuobstbestände zudem einer intensiven Pflege bedürfen.
Diese Ergebnisse machen den Handlungsbedarf offensichtlich und können die Naturparkgemeinden bei ihren Maßnahmen und der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Die Naturparkgemeinden und das Management können umgekehrt die Leistung der freiwilligen Teilnehmer würdigen und mit ihrer Hilfe ein Langzeitmonitoring begründen.
5 Diskussion
Die Ergebnisse dieses Fallbeispiels zeigen bezogen auf die Problematik der Streuobstbestände ein alarmierendes Bild und die Notwendigkeit aktiv zu werden. Ohne Zweifel kann der Naturpark dann, wenn er ein Laienmonitoring initiiert, davon ausgehen, damit die Bewusstseinsbildung erheblich zu fördern. In unserem Fallbeispiel führte allein die Kartierung zu lebhaften Gesprächen mit den Besitzern der Streuobstbestände. Bewusstseinsbildende Effekte und neue Erkenntnisse dürfen auch bei den Freiwilligen und den Naturparkgemeinden erwartet werden.
Darüber hinaus verstehen wir diesen Ansatz auch als ein Beispiel, wie ein besonderer Mehrwert im Zusammenhang mit dem Laienmonitoring entstehen kann. Kartierungen, die nur das Befüllen von Datenbanken zum Ziel haben und dem teilnehmenden Bürger nicht klar machen können, welchen Wert und welchen naturschutzfachlichen Nutzen seine Arbeit hat, sind weniger attraktiv als solche, die ein klares Ziel erkennen lassen. Bei den Streuobstkartierungen im Naturpark Pöllauer Tal wird die Bedeutung anschaulich, aber auch in anderen Bereichen könnte ein Laienmonitoring einem klaren Auftrag folgen. Ein Beispiel dafür wären die Artenverschiebungen und Wanderungen von Arten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Im Naturpark Sölktäler, ebenfalls in der Steiermark, beobachten Einheimische, in welcher Höhenlage des Bergwaldes der Borkenkäfer mittlerweile vorkommt. Andere Studien zielen unter Hinzuziehen von Laienmonitoring auf klimawandelbedingten Arealverschiebungen von Tagfaltern ab. Einfache Fragestellungen, wie Vorkommen oder phänologisches Auftreten von Arten, Zugvogeltermine oder Bedrohungsszenarien, wie bei Streuobst oder Heckenelementen oder auch im Zusammenhang mit Rückgängen bei Sperling und Amsel, sind klar umrissene Aufträge, auf wenige Punkte reduzierte Fragestellungen, die sich nicht nur sehr gut für ein Laienmonitoring eignen, sondern die sich – gerade bei den Arealverschiebungen durch den Klimawandel – eigentlich nur durch eine große Anzahl an Mitwirkenden wissenschaftlich zufriedenstellend leisten lassen.
Wer Citizen Science oder Laienmonitoring nur in die „Ecke“ der Bewusstseinsbildung stellt, wird den Chancen und Möglichkeiten dieses Themas nicht gerecht. Es liegt auch an der Wissenschaft und der Fachplanung, die Fragen für ein Laienmonitoring so zu formulieren, dass das enorme Kapital einer interessierten Bevölkerung für beide Seiten befriedigend genutzt werden kann.
Nicht nur im Naturpark Pöllauer Tal in Österreich, sondern auch in deutschen Naturparken soll, wie die Auftaktveranstaltung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von Naturparken im Sauerland im Jahr 2012 zeigte, Laienmonitoring als identitätsstiftender und wichtiger Beitrag zum regionalen Naturschutz zukünftig eine wichtige Rolle spielen (Klein 2012).
Im Hinblick auf das Streuobstmonitoring, aber auch viele andere Fragestellungen wird jedoch eine Anlaufstelle benötigt, die nicht nur die Kontinuität und gleichbleibende Qualität gewährleistet, sondern die darüber hinaus auch die Datenzusammenschau und Visualisierung qualifiziert übernehmen kann. Ohne diese zusätzlichen Leistungen ist die Effizienz gering. Gerade in Schutzgebieten, wie den Naturparken, könnte diese Kontinuität in der Regel personell und fachlich gewährleistet werden.
Literatur
Bremer, S., Erdmann, K.-H., Hopf, T. (2006): Freiwilligenarbeit im Naturschutz. Naturschutz und Biologische Vielfalt 37.
Bünger, L. (1996): Erhaltung und Wiederbegründung von Streuobstbeständen in Nordrhein-Westfalen. Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung NRW, Hrsg., LÖBF-Schr.-R. 9.
Greylinger, A., Haider I., Kahkashani, S., Thyringer, B. (2010): Naturschutz. In: Naturpark Pöllauer Tal. Projektbericht zu Landschaftspflege und Naturschutz am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Universität für Bodenkultur Wien.
Holzner, W., Kriechbaum, M., Kummer, S., Ulbel, E., Winter, S., Bogner, D., Mohl, I., Banko, G., Peterseil, J., Sauberer, N., Tiefenbach, M., Frank, G., Geburek, T., Milasowszky, N., Schadauer, K., Schüler, S., Zechmeister-Boltenstern, S., Klingler, S., Zech, S. (2006): MOBI-e, Entwicklung eines Konzeptes für ein Biodiversitäts-Monitoring in Österreich; Anhang. BMLFUW, Hrsg., Umweltbüro Klagenfurt, Klagenfurt.
Klein, A. (2012) Mündliche Mitteilung im Rahmen der Naturparkfusion im Sauerland und der Qualitätsoffensive des Verbands Deutscher Naturparke. Olpe.
Kornprobst, M. (1994): Landschaftspflegekonzept Bayern, Band II, 5: Lebensraumtyp Streuobst. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, Hrsg., München.
Lucke, R., Silbereisen, R., Herzberger, E. (1992): Obstbäume in der Landschaft. Eugen Ulmer, Stuttgart.
Pröbstl, U., Schuster, S. (2011): Naturpark Pöllauer Tal. Eine Bilanz nach 20 Jahren Entwicklung im ländlichen Raum. zoll+ 18, Österr. Schr.-R. für Landschaft und Freiraum, Wien.
Schrank, J. (2012): Erfassung des Streuobstbestandes in Hinteregg. Streuobstmonitoring durch Laien als Beitrag zum Naturschutz in Naturparken. Unveröff. Dipl.-Arb., Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Univ. für Bodenkultur, Wien.
Schramayr, G., Reiterer, R. (2002): Ökologische Funktionalität von Streuobstbeständen und deren betriebliche Sicherung. Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung.
Wilfling, A., Möslinger, M. (Hrsg., 2005): Biodiversität im Naturpark Pöllauer Tal. Wissenschaftliche Grundlagenforschung als Basis für künftiges Management. Endber. Bd. I/1, Untersuchungsgebiet und Lebensräume. Unveröff. Projektber. im Auftrag des Vereins Naturpark Pöllauer Tal, Gleisdorf, 420 S.
Internetquellen
Biotoptypenkatalog der Steiermark 2008, Amt der steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 13c Naturschutz, Graz (letzter Zugriff: 11.12.2011), http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11108166_2654916/f6b6108b/Biotypen.pdf.
ÖPUL 2007 – Erhaltung von Streuobstbeständen (ES) (letzter Zugriff: 11.12.2011), http://www.ama.at/Portal.Node/public?gentics.rm=PCP&gentics. pm=gti_full&p.contentid=10008.47316&MEB_ES.pdf.
Anschrift der Verfasser(in): Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider und DI Georg Schrank, Universität für Bodenkultur Wien, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (ILEN), Peter-Jordan-Straße 82, A-1190 Wien, E-Mail ulrike. proebstl@boku.ac.at.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen



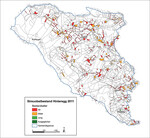
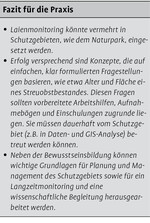
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.