Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei artenschutzrechtlichen Betrachtungen in Theorie und Praxis
Abstracts
Im ersten Teil des Beitrages [Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (8)] wurde auf die juristische und naturschutzfachliche Betrachtung bei der Bestimmung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der europäischen Vogelarten eingegangen, wobei ein Schwerpunkt auf den Fortpflanzungsstätten lag. Dabei wurden speziell die Grenzfälle aufgezeigt, bei denen juristische und naturschutzfachliche Einschätzung auseinanderfallen können und entsprechende Lösungsansätze für den Umgang mit dieser Problematik in der Praxis unterbreitet.
Der zweite Teil beschäftigt sich nach einer kurzen Zusammenfassung der rechtlichen und fachlichen Definitionen mit dieser Problematik am Beispiel von Reptilien und Tagfaltern. Anders als in Teil 1 wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Betrachtung der Auswirkungen des Freibergurteils in der praktischen Umsetzung bei weniger mobilen Arten gelegt. Es werden die faunistischen Kartiermöglichkeiten und die sich daraus ergebenden naturschutzfachlichen Einschätzungen zur Bestimmung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorgestellt und versucht, praktische Vorschläge für die Anwendung zu geben.
Breeding Sites and Resting Places in Theory and Practice of Species Protection – Legal Base, Annotations and Suggestions – Part II: Reptiles and Butterflies
The first part of the study [cf. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (8)] focussed on the definition of breeding sites and resting places of the European Bird Species from a legal and from a nature conservation point of view, with a particular emphasis on the breeding sites. It specifically pointed out several difficult cases with diverging legal and conservation assessments, and it suggested practical approaches to their solution. After a short summary of the legal and technical definitions the second part deals with these difficulties using the example of reptiles and butterflies. Other than in the first part the investigations particularly focus on the effects of the “Freiberg”-decision for the practical handling of less mobile species. The study presents the options of faunistic mapping and the resulting assessments of nature conservation to identify their breeding sites and resting places, and it aims to find practical suggestions for their implementation.
- Veröffentlicht am
1 Einleitung
Bei wenig mobilen Arten wie den in diesem Beitrag behandelten Reptilien oder Tagfaltern ist es zwar häufig möglich, die genaue Lage der Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu bestimmen; dieses ist aber nicht unbedingt zweifelsfrei, leicht oder schnell durchzuführen. Aus dem Artenschutzrecht ergibt sich jedoch die Anforderung, diese zu kennen: „Es ist verboten…, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören…“ (§ 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 3). Daher ist zum einen eine Definition erforderlich, was juristisch unter der Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu verstehen ist. Dieses wurde bereits im ersten Teil dieses Beitrages ausgeführt (HVNL-Arbeitsgruppe Artenschutz et al. 2012).
Eine Konkretisierung ist für Ruhestätten notwendig, da Ruhestätten für Reptilien und Tagfalter naturschutzfachlich eine besondere Bedeutung haben. Ob sich bei der vergleichenden Betrachtung der juristischen und der naturschutzfachlichen Definitionen ähnliche Probleme ergeben wie bei den sehr mobilen Vogelarten, wird untersucht und ggf. Lösungsansätze vorgeschlagen. Noch wesentlicher erscheint bei der Betrachtung der Arten, die bei Bauvorhaben nicht ohne weiteres ausweichen können, der im Urteil vom 14.7.2011 (BVerwG, Freibergurteil) gesetzte neue rechtliche Rahmen. Die relevanten Kerne dieses Urteils für die Praxis werden vorgestellt.
2 Definitionen
Die unterschiedliche Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätte in der naturschutzfachlichen Praxis und der rechtlichen Anwendung kann in einigen Grenzfällen zu unterschiedlichen Beurteilungsergebnissen führen.
2.1 Definitionen rund um den Verbotstatbestand in der Rechtsprechung
Die Rechtsprechung definiert in verschiedenen Entscheidungen die Fortpflanzungs- und Ruhestätte als Lebensstätten, die durch die bestimmte Funktion (Fortpflanzen oder Ruhen) für die jeweilige Art geprägt sind (BVerwG, Urteil vom 09.07.2008, 9 A 14/07 Rn. 100; BVerwG, Urteil vom 12.08.2009; 9 A 64/07, Rn. 68). Hierunter wird üblicherweise der konkret zur Fortpflanzung oder Ruhe dienende Gegenstand gefasst, nicht jedoch darüber hinausgehende Bereiche, insbesondere nicht der gesamte Lebensraum der geschützten Art, ob er nun für eine erfolgreiche Fortpflanzung erforderlich ist oder nicht. Beschädigt oder zerstört wird die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte, wenn dieser konkrete Gegenstand zukünftig seine Funktion zur Fortpflanzung oder Ruhe nicht mehr erfüllen kann, beispielsweise der Baum gefällt oder ein Revier vollständig überbaut wird. Zudem ist erforderlich, dass dieser Verlust nicht durch ein Ausweichen der Art innerhalb eines Quartierverbundes aufgefangen werden kann. Die Frage, ob von einer Beschädigung bereits bei einem teilweisen Funktionsverlust der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte gesprochen werden kann, lässt sich nicht ohne weiteres beantworten, da hierzu bislang keine konkreten Aussagen getroffen wurden.
Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte prüft das Gericht erst, wenn es zu dem Ergebnis gekommen ist, dass eine Zerstörung oder Beschädigung vorliegt. Auf einer „zweiten Stufe“ im Rahmen des § 44 Abs.5 S.2 BNatSchG wird hinterfragt, ob die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden kann. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn in einem Verbund an Höhlenbäumen auch zukünftig eine ausreichende Anzahl an Höhlen zur Verfügung steht. Bei der Betrachtung dieser ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) berücksichtigt werden. Der räumliche Zusammenhang bestimmt sich danach, ob die Ausweichquartiere oder Maßnahmenflächen entsprechend dem artspezifischen Aktionsradius für die Tiere erreichbar sind (Kratsch in Schumacher & Fischer-Hüftle 2010, BNatSchG § 44 Rn. 73).
Kritisch sind Fälle, in denen eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte nur mittelbar in ihrer Funktion beeinträchtigt wird (etwa durch Inanspruchnahme lediglich eines Teils der Fortpflanzungsstätte oder Beeinträchtigung durch Lärm). Die Gerichte verneinen hier bereits den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und eine Prüfung der ökologischen Funktionalität der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte (auf der „2. Stufe“) entfällt. Stattdessen erfolgt eine Prüfung, ob in diesen Fällen gegebenenfalls eine erhebliche Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bejaht werden kann.
2.2 Naturschutzfachliche Definitionen rund um den Verbotstatbestand
Die naturschutzfachliche Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätte variiert sehr stark nach der jeweils zu betrachtenden Art und geht oftmals über den in der Rechtsprechung gebräuchlichen Rahmen hinaus. Der von der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission ausgearbeitete Leitfaden nennt als Fortpflanzungstätte beispielhaft „Bereiche für die Paarung, für die Wahl des Ortes der Eiablage, der Niederkunft oder der Eientwicklung und des Schlüpfens“ (EU-Kommission 2007). Als Ruhestätte werden Gebiete definiert, die für das Überleben eines Tieres oder einer Gruppe von Tieren während der nicht aktiven Phase erforderlich sind. Beispielhaft werden Strukturen und Habitatelemente zur Wärmeregulierung, zum Schlaf, zum Versteck und zur Überwinterung genannt (EU-Kommission 2007). „Bei Arten mit vergleichsweise kleinen Aktionsradien sowie bei Arten mit sich überschneidenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die eine ökologisch-funktionale Einheit darstellen, ist häufig eine umfassende Definition geboten: In diesen Fällen ist bei der räumlichen Abgrenzung einer Stätte das weitere Umfeld mit einzubeziehen und eine ökologisch-funktionale Einheit zu bilden. Diese weite Auslegung hat zur Folge, dass nicht mehr der einzelne Eiablage-, Verpuppungs- oder Versteckplatz etc. als zu schützende Fortpflanzungs- oder Ruhestätte zu betrachten ist, sondern ein größeres Areal bis hin zum Gesamtlebensraum des Tieres“(LANA 2009).
Insbesondere bei kleinräumig agierenden Arten ist der Begriff der Beschädigung fast ebenso wichtig wie der der Zerstörung. Der EU-Leitfaden führt dazu aus: „Beschädigung kann als die materielle Verschlechterung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte definiert werden. Im Gegensatz zur Vernichtung kann eine solche Beschädigung auch schleichend erfolgen und zur graduellen Verschlechterung der Funktionalität der betreffenden Stätte führen. … Die Beschädigung muss somit nicht unmittelbar zum Verlust der Funktionalität einer Stätte führen, sondern wird sie qualitativ und quantitativ beeinträchtigen und auf diese Weise nach einiger Zeit zu ihrem vollständigen Verlust führen. … Dieser besondere Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätte vor Beschädigung und Zerstörung hängt selbstverständlich mit der wesentlichen Funktion dieser Stätte zusammen, die weiterhin alles bieten müssen, was für die Fortpflanzung oder die Rast eines bestimmten Tieres … erforderlich ist.“ (EU-Kommission 2007). Ist eine Verminderung des Fortpflanzungserfolges oder der Ruhemöglichkeit des betroffenen Individuums… wahrscheinlich zu prognostizieren, wird von einer Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte ausgegangen (LANA 2010).
Naturschutzfachlich bedeutet der Erhalt der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang, dass innerhalb des Aktionsraumes der betroffenen Art als Ersatz für die beschädigte oder zerstörte Fortpflanzungs- und Ruhestätte durch ein unbesetztes, geeignetes Habitat vorhanden sein oder geschaffen werden muss. Der räumliche Zusammenhang und die Frage nach der Gewährleistung der ökologischen Funktion richten sich naturschutzfachlich nach Ökologie und Raumanspruch der Art. Dies ist daher nicht pauschal, sondern artbezogen differenziert zu betrachten (s. Abschnitt 3).
2.3 Folgen
Unterschiede bei Anwendung der oben genannten Definitionen ergeben sich meist in den Fällen der mittelbaren Beeinträchtigung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte.
Verneinen die Gerichte das Vorliegen einer Beschädigung oder Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte durch die mittelbare Beeinträchtigung, so kommen sie immer zu einer Prüfung des Störungstatbestandes (§44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Dieser Verbotstatbestand hat aber für die geschützten Arten gegenüber dem des §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG den Nachteil, dass er einen populationsbezogenen und keinen individuenbezogenen Ansatz verfolgt, d.h. eine erhebliche Störung der Art wird nur bejaht, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population durch die Störung verschlechtert. Die Schwelle, eine Verwirklichung des Verbotstatbestandes anzunehmen, liegt damit bei diesem um einiges höher, weshalb Sachverständige mit dieser Herangehensweise oftmals nicht einverstanden sind. Keine Differenzen gibt es bei der Zerstörung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte.
3 Beispielhafte Betrachtung der Reptilien und Tagfalter
Bei Reptilien und vielen Tagfaltern können die Fortpflanzungs- und Ruhestätten zwar häufig gefunden werden, dieses ist aber nicht immer zweifelsfrei, leicht oder schnell durchzuführen. Aus dem oben Genannten ergibt sich jedoch die Anforderung, diese möglichst genau zu lokalisieren. Da Ruhestätten für Reptilien und Tagfalter naturschutzfachlich eine besondere Bedeutung haben, ist insbesondere hier eine weitere Konkretisierung erforderlich. Im Folgenden wird beispielhaft für die Zauneidechse (Lacerta agilis) und den Dunklen und Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous und M. teleius) der Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätte naturschutzfachlich definiert, deren Erfassungsmethoden und mögliche Beeinträchtigungen dargestellt und auf den naturschutzfachlich abzuleitenden räumlichen Zusammenhang eingegangen.
3.1 Beispiel Zauneidechse
Die Zauneidechse (Lacerta agilis) zählt zu den in Hessen noch weit verbreiteten und relativ häufigen, ungefährdeten Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie. In Hessen und Nordrhein-Westfalen gilt ihr Erhaltungszustand (anders als in anderen deutschen Bundesländern und Europa) als günstig. In Hessen weist die Zauneidechse aber langfristig einen mäßigen Rückgang und eine kurzfristige mäßige Abnahme auf, so dass sie lokal oder regional durchaus gefährdet sein kann (AGAR & FENA 2010).
3.1.1 Naturschutzfachliche Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bei Zauneidechsen
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Zauneidechsen können in ihrer Ausprägung und Größe sehr unterschiedlich sein, wobei die Flächengröße eines home range (bewohnter Habitatkomplex) stark abhängig von der Habitatqualität und der Vernetzung mit benachbarten Habitaten ist. Sie zählen zu den Biotopkomplex-Bewohnern, die ganzjährig in ihren Habitaten anzutreffen sind und keine Reviere gegenüber Artgenossen verteidigen. Zauneidechsenhabitate sind vielgestaltige teilbesonnte Ökotone, in denen die Tiere ihre Optimaltemperatur aktiv durch kleinsträumige Ortswechsel steuern können (Blanke 2004). Die ausreichende Tiefe des zum Graben geeigneten Bodens stellt einen wichtigen Schlüsselfaktor dar (Märtens et al. 1997), obwohl kleine Populationen auch auf Lehm- oder Steinböden vorkommen können. Hier werden alternativ Mäuselöcher, Spalten im Substrat u.Ä. genutzt.
Die Aktionsräume der Individuen sind stark abhängig von geografischer Lage und Habitatqualität, weshalb die Angaben in der Literatur deutlich schwanken. Bei dauerhaft genutzten (sommerlichen) Aktionsräumen der Individuen liegt der Flächenbedarf/Tier zwischen 5 und 99 m2. Bei saisonalem Wechsel von Aktionsräumen erhöht er sich auf 196 bis 1396 m2. Für die Gesamtspanne der genutzten Aktionsräume werden Flächen von 35 bis 3751 m2 angegeben ( http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de ). Glandt (1979) geht davon aus, dass Zauneidechsenpopulationen in optimalen Habitaten eine Mindestgröße von 1 ha benötigen; aus den oben zitierten Aktionsräumen ergibt sich ferner, dass die Mindestgröße in suboptimalen Lebensräumen 3 bis 4 ha betragen kann. Für die Planungspraxis bedeutet das, dass die Mindestarealgröße, die für die Funktionalität einer spezifischen Lebensstätte benötigt wird, fallspezifisch gutachterlich mit ≥1 bis 4 ha festgesetzt werden muss.
Die Individuen einer lokalen Population besetzen gemeinsam genutzte home ranges (bewohnte Habitatkomplexe), die nicht oder nur selten verlassen werden. Wichtig für das Vorkommen der Art ist das enge Nebeneinander von Fortpflanzungsstätten (= Eiablageflächen) und regelmäßig genutzten Ruhestätten (Sonnenplätze, Tages- und Nachtverstecke, Überwinterungsplätze), deren Lage und Struktur im Jahresverlauf stark wechseln kann und die tagsüber und nachts mit hoher Ortstreue aufgesucht werden. Die Art überwintert in frostfreien und gut durchlüfteten Fels- und Erdspalten, vermoderten Baumstubben, Nagerbauten oder selbst gegrabenen Erdhöhlen in Bodentiefen von 10 bis 150cm (Leopold 2004).
Die Eiablage erfolgt an sonnigen, offenen und nicht zu trockenen Stellen in selbst gegrabenen 4 bis 10 cm tiefen Röhren, unter flachen Steinen, Brettern etc. (Blanke 2004). Diese 1 bis 1,5 m2 großen Eiablagestätten, die ohne die unmittelbar angrenzenden Ruhestätten aber ihre ökologische Funktion nicht erfüllen können, müssen bei ausreichender Wasserverfügbarkeit gut durchlüftet und erwärmbar sein, wobei die Beschattung <40 % betragen muss (Elbing et al. 1996).
Eine räumliche Differenzierung zwischen Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist bei der Zauneidechse nicht möglich, da die unterschiedlichen Funktionsräume der sehr standorttreuen Art eng miteinander verzahnt sind und immer nur in ihrer Gesamtheit ihre Funktionalität als Lebensraum erfüllen. Alle Strukturen werden regelmäßig und dauerhaft von den Tieren genutzt, obwohl sie im Laufe des Tages oder Jahres innerhalb des home range verlagert werden können (s. hierzu Blanke 2004). So wird im Fall der Zauneidechse der gesamte bewohnte Habitatkomplex (home range) als Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne des § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG definiert (LANA 2010: 8).
3.1.2 Methodische Erfassungsgrundlagen der Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Zauneidechsen sind stumm und können nur durch die direkte Sichtbeobachtung nachgewiesen werden, indem geeignete Lebensräume und Strukturen gezielt abgesucht werden, wobei auch auf raschelnde Geräusche flüchtender Tiere zu achten ist. Außerdem können versteckte Tiere durch das Umdrehen von flachen Steinen, Brettern etc. gefunden werden, weshalb es ratsam ist, zusätzlich künstliche Verstecke auszulegen (s. hierzu Hachtel et al. 2009). Ein Nachweis ist von Anfang März bis Mitte Mai an sonnigen Tagen am wahrscheinlichsten. Schlüpflinge lassen sich in Mittelhessen gut im August und September beobachten (zur Phänologie s. Blanke 2004, Hahn-Siry 1996 und Hafner & Zimmermann 2007). Einen Anfangsverdacht liefert die Abfrage vorhandener Datenbanken (z.B. in Hessen der Natis-Daten) und der ortsansässigen Bevölkerung.
Eine sehr effiziente, aber kostenaufwändige Nachweismethode ist das Aufstellen von Fangzäunen mit Fangeimern. Diese Methode wird wegen des hohen Aufwands in der Regel nur bei Umsiedlungen angewendet.
Zum Nachweis individuenreicher Populationen halten Hachtel et al. (2009) vier Begehungen für notwendig. Zur Abschätzung der Abundanz im Rahmen der FFH-Berichtspflicht werden sechs Begehungen pro Saison empfohlen (BfN 2010).
Oftmals sehen Vorhabenträger für die Erfassung von Reptilien lediglich drei Begehungen vor, die möglichst zu optimaler Jahres- und Tageszeit bei optimalem Wetter durchgeführt werden sollen. Tatsächlich ist der Nachweis der Zauneidechse anhand dieses Untersuchungsumfangs häufig möglich. Vor allem im März bis Mitte Mai werden z.B. schwarze Teerpappen gerne als Sonnenplatz oder Tagesversteck angenommen (s. Abb. 2). Allerdings wird die Art bei dieser geringen Exkursionszahl häufig übersehen, ein Negativnachweis kann so grundsätzlich nicht erbracht werden (eigene Beobachtung und Blanke 2004).
Eine realistische Analyse der Raumnutzung ist mit diesem Untersuchungsumfang nahezu unmöglich, so dass meist die Biotoptypenkartierung zur theoretischen Abgrenzung des Lebensraums einer lokalen Population herangezogen wird (Analogieschluss). In klar definierten Landschaftsräumen, in denen geeignete Biotopstrukturen eindeutig von nicht besiedelbaren Flächen abgegrenzt werden können, kann anhand dieser Vorgehensweise eine relativ sichere Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte erfolgen. In strukturreichen Landschaften mit zahlreichen untereinander vernetzten mehr oder weniger geeignet erscheinenden Teilflächen ist eine fachlich belastbare Aussage so jedoch unmöglich. Es kann nach eigener Erfahrung weder davon ausgegangen werden, dass Teilflächen ohne Sichtbeobachtung unbesiedelt sind, noch dass Flächen, die dem Gutachter gut geeignet erscheinen, auch wirklich besiedelt sind.
3.1.3 Funktionsverlust durch Beschädigung
Da die Zauneidechse ganzjährig in ihren Aktionsräumen anwesend ist und alle Strukturen in tages- und jahreszeitlichem Wechsel in der Regel von mehreren Individuen gleichzeitig genutzt werden, führt im ersten Prüfschritt des §44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG jede Flächenbeanspruchung eines als Fortpflanzungs- und Ruhestätte identifizierten Biotops zu einer Beschädigung oder Zerstörung. Eine Bauzeitenregelung allein stellt wegen der ganzjährigen Anwesenheit der Art und der regelmäßigen Nutzung aller Strukturen keine geeignete Vermeidungsmaßnahme dar. Je nach Größe der Population muss ein Abfang vorgesehen werden. Bei teilweiser Inanspruchnahme eines home range muss wegen der stark von geografischer Lage und Habitatqualität abhängigen Minimalgröße einzelfallbezogen vom Gutachter entschieden werden, ob der Teilverlust dazu führen wird, dass das Minimalareal für die dortige Population unterschritten wird.
3.1.4 Räumlicher Zusammenhang
Als Minimalareal für stabile Populationen werden je nach Habitatqualität in der Literatur 1 bis 4ha angegeben. Sobald die für den Planungsfall zu ermittelnde Mindestarealgröße durch den Eingriff unterschritten wird, ist die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht mehr gegeben und der Verbotstatbestand des §44 Abs. 1 Satz 5 ist erfüllt. Wegen der spezifischen Habitatansprüche ist davon auszugehen, dass die Individuen nicht beliebig in angrenzende bisher unbesiedelte, da nicht den Lebensbedingungen entsprechende Bereiche ausweichen können. Grundsätzlich sind geeignete Bereiche unabhängig von der Abgrenzung des Untersuchungsraums bereits besetzt und die Individuen können hier nicht beliebig „zusammenrücken“.
Die theoretische Abgrenzung des Lebensraums anhand der Biotoptypenkartierung reicht zur Beantwortung dieser Frage nicht in jedem Fall aus. Um sicher zu gehen, dass es sich bei den durch den Eingriff beanspruchten Flächen nicht um elementare Strukturen des home ranges handelt, müssen ggf. vertiefte Untersuchungen zur tatsächlichen Raumnutzung und Populationsgröße durchgeführt werden. Alternativ bietet sich aber auch eine häufig kostengünstigere worst-case-Betrachtung mit einer möglichen Überkompensation an.
3.1.5 Schlussfolgerung, mögliches Vorgehen
Die Zauneidechse ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie sehr das Verhalten der Art und die Erfassungsmöglichkeiten (oder eben auch -unmöglichkeiten) Auswirkungen auf die Betrachtung der Verbotstatbestände hat: Da die Zauneidechse ganzjährig in ihren Aktionsräumen anwesend ist und alle Strukturen in tages- und jahreszeitlichem Wechsel i.d.R. von mehreren Individuen gleichzeitig genutzt werden, führt im ersten Prüfschritt des §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG jede Flächenbeanspruchung eines als Fortpflanzungs- und Ruhestätte identifizierten Biotops zu einer Beschädigung oder Zerstörung. Abhängig von erforderlichen Minimalarealen ist einzelfallbezogen vom Gutachter zu entscheiden, ob trotz des Teilverlustes die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrt ist (§44 Abs. 5 S.s BNatSchG). Sobald die für den Planungsfall zu ermittelnde Mindestarealgröße von 1 bis 4ha durch den Eingriff unterschritten wird, dürfte dies zweifelhaft sein. Vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen würden dann erforderlich werden.
3.2 Beispiel Tagfalter: Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling
Der Dunkle und der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous und M. teleius) unterliegen als Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) einem besonderen Schutz. Bei beiden Tagfalterarten liegt der Verbreitungsschwerpunkt in den südlichen Bundesländern (Hessen, Thüringen, Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg). Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist in Hessen im Gegensatz zum Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling weit verbreitet. Er ist regelmäßig von Eingriffsvorhaben betroffen und daher auch häufig Gegenstand von artenschutzrechtlichen Prüfungen.
3.2.1 Naturschutzfachliche Definition der Fortpflanzungs- und Ruhestätte
Die Fortpflanzungsstätte des Dunklen und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings besteht im Verbund von besiedelten Wiesenflächen mit regelmäßigen Beständen des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) in Kombination mit dem Vorkommen von Wirtsameisennestern verschiedener Arten der Knotenameisen (Myrmica ssp.) (Leopold 2004). Zur Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte sollte zumindest ein flächenbezogener Reproduktionsverdacht bestehen oder am besten eindeutige Nachweise vorliegen. Dabei ist es für die Einstufung als Fortpflanzungsstätte unerheblich, ob es durch eine landwirtschaftliche Nutzung, die nicht an die Ökologie der Art angepasst ist, regelmäßig zum teilweisen oder auch zum vollständigen Verlust des Reproduktionserfolges kommt (Runge et al. 2009).
Bei der Fortpflanzungsstätte beider Arten handelt es sich weitestgehend um extensiv genutzte wechselfeuchte bis feuchte Wiesen oder Weiden, junge Wiesenbrachen und Säume entlang von Wegen und Gräben. Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling bevorzugt in der Regel weniger verbrachte Grünlandkomplexe als die Schwesterart.
Die Größe geeigneter Vermehrungshabitate ist nicht unbedingt für die Abundanzen von Faltern entscheidend, da für beide Arten bekannt ist, dass sie unter optimalen Bedingungen z.T. sehr hohe Populationsdichten generieren können. In optimal strukturierten Habitaten können 1000 bis 2000 m2 Habitatfläche für eine Population schon ausreichen. So werden für Südostbayern Populationsdichten für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling von 30 bis 60 Individuen/1000 m2 und für den Hellen von 10 bis 20 Individuen/1000 m2 angegeben (Stettmer et al. 2001). Für Hessen sind diese Populationsdichten vermutlich recht unwahrscheinlich. So kommen in hervorragenden und optimal strukturierten Habitaten im Taunus (Naturräumliche Haupteinheit D41 Taunus) für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 10 bis 15 Individuen/1000 m2 und für den Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 1 Individuum/1000 m2 (Fehlow 2010) vor.
Die Raupen leben während der ersten Entwicklungsstadien ausschließlich in den Blütenköpfchen des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis). Zwischen Mitte August und Mitte September verlassen die Larven nach der dritten Häutung das Blütenköpfchen und lassen sich auf den Boden fallen. Dabei imitieren die jungen Raupen durch chemisches Maskieren die Oberfläche und Chemie der Haut der Ameisenlarven so perfekt, dass die Ameisen sie für ihren eigenen Nachwuchs halten und in das unterirdische Nest transportieren. Dort ernähren sich die Raupen räuberisch von der Ameisenbrut, daneben fungieren die Raupen als lebende Nahrungsspender für die Ameisen, indem sie zuckerhaltige Sekrete und Aminosäuren bereitstellen (Fartmann & Hermann 2006).
Da die Raupen des Falters in den Ameisennestern myrmekophag leben, kann das Ameisennest die Verluste nur verkraften, wenn dieses optimal entwickelt ist. Insofern spielt beim Überleben einer Wiesenknopf-Ameisenbläulings-Population in der Regel nicht die Deckung der Wiesenknopf-Blüten die limitierende Rolle, sondern die Nestdichte der Wirtsameisenbaue (Elmes et al. 1998). Die Raupen überwintern in den Ameisennestern, um sich im Frühsommer des nächsten Jahres nahe der Bodenoberfläche im oberen Teil der Nester zu verpuppen. Ab Ende Juni schlüpfen die ersten Falter, verlassen die Nester und der Entwicklungszyklus beginnt mit der Eiablage neu.
Für den Fortpflanzungserfolg ist die räumliche Überlappung von Ameisennest und der Wirtspflanze entscheidend. In manchen Fällen, z.B. im Bereich von häufig überschwemmten Auenwiesen oder Einstauflächen durch Hochwasserdämme, kommt es auch vor, dass das Ameisennest von der Wirtspflanze entfernt liegt, weil im Falle von Myrmica rubra diese gern in trockenen Bereichen nisten. Allerdings ist der Abstand durch den Aktionsradius der Ameisen begrenzt. Elmes (1998) erwähnt Distanzen von 8m zum Ameisennest. Größer wird sie vermutlich nur in Ausnahmefällen sein. Deshalb werden vom Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling oft die trockeneren Bereiche von Saumbiotopen entlang der Wegränder oder Straßenböschungen außerhalb von häufigen Überschwemmungsflächen besiedelt.
Zur Fortpflanzungsstätte werden alle Teilhabitate gezählt, die in Tab. 1 dargestellt sind. Es handelt sich um die Teilhabitate des beschriebenen Fortpflanzungszyklus, dazu zählt auch das Überwinterungshabitat. Als Ruhestätte dienen lediglich die Schlafplätze der Falter (Runge et al. 2009), die sich räumlich mit der Fortpflanzungsstätte decken können. Die Nahrungshabitate entsprechen bei den Wiesenknopf-Ameisenbläulingen der Fortpflanzungsstätte. Normalerweise wird das Nahrungshabitat bei Tierarten mit größeren Aktionsräumen und wechselnden Fortpflanzungshabitaten nicht zur Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte gezählt; hier liegt jedoch eine Überschneidung vor. Bei den beiden Tagfalterarten ist bekannt, dass sie sehr standorttreu sind. D.h. dass der überwiegende Anteil einer Individuengemeinschaft alle Entwicklungsstadien und Aktivitätsphasen weitgehend innerhalb einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte verbringt bzw. maximal 300 bis 400 m in benachbarte Vermehrungshabitate als Falter ausweichen kann, sofern keine gravierenden Ausbreitungshindernisse vorliegen (Runge 2009, Stettmer 2001). Die einzelnen Vermehrungshabitate sollten hierbei durch geeignete Vernetzungsstrukturen (Dispersionswege) verbunden sein. Einzelne Falter-Individuen der beschriebenen Wiesenknopf-Ameisenbläulinge können auch größere Entfernungen als 300 bis 400 m vom Vermehrungshabitat zurücklegen.
Sowohl der Dunkle als auch der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling leben in übergeordneten Metapopulationen eines größeren Gebietes. Diese Struktur ermöglicht insoweit auch einen Genfluss bzw. ggf. die Neu- oder Wiederbesiedlung durch lokales Erlöschen verwaister „patches“ (Trautner 2008). Das mittel- bis langfristige Überleben der Metapopulation ist somit auf einen Individuenaustausch und Wiederbesiedeln geeigneter Habitate angewiesen. Die maximal nachgewiesene Flugdistanz nach Stettmer et al. (2001) lag beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling bei 8 km und beim Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling bei 2,0 bis 2,5 km.
3.2.2 Methodische Erfassungsgrundlagen
Die klassische Nachweismethode von Vorkommen der Wiesenknopf-Ameisenbläulings-Arten ist die Transekt-Begehung von Teilflächen mit blühendem Großen Wiesenknopf während der Flugzeit der Falter. Der Untersuchungsrahmen und die Bewertungen orientieren sich an den Vorgaben, die im Rahmen der Umsetzung der FFH-Richtlinie entwickelt wurden (z.B. Lange & Wenzel 2004a, b; 2008 a, b). Die Flächen werden je nach Form und Übersichtlichkeit in Linien mit ca. 10 bis 15m Abstand langsam und vollständig abgeschritten, dabei wird besonders auf die Wiesenknopf-Blütenköpfchen geachtet. Je nach Detaillierungsgrad der Bestandsaufnahme sind eine flächige Begehung, eine Erfassung der Deckung des Großen Wiesenknopfes, Angaben zur Habitatnutzung sowie Beobachtungsnotizen zum Verhalten der Falter (Nahrungssuche, Paarung, Eiablage) zu empfehlen. Standardbedingungen für die Begehungen sind zwischen 10 und 17 Uhr MESZ, bei mindestens 18 °C Lufttemperatur, Bewölkung höchstens 50 %, Windstärke max. 3 der Beaufort-Skala (Sachteleben & Behrens 2010). Für die Erfassung sollten vier Begehungen zur Hauptflugzeit von Anfang Juli bis Mitte August bei vermuteten Vorkommen von beiden Arten (Hessen-Forst FIV 2006) nicht unterschritten werden. Kenntnisse über die Mobilität und den Austausch der Arten liefert die Fang-Wiederfang-Methode, die allerdings mit einen sehr hohen Arbeitsaufwand verbunden ist (Mühlhofer 1999). Bei Wiederherstellung von beeinträchtigen Flächen ist neben der Etablierung des Großen Wiesenknopfes auch der Nachweis der Ameisennestdichte erforderlich (Methode, s. Münch 1999).
3.2.3 Funktionsverlust durch Beschädigung
Zu den direkten Beeinträchtigungen der Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge zählt die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme. Bei der Betrachtung des ersten Prüfschrittes führt jede Teilflächen-Inanspruchnahme unabhängig von ihrer Größe zu einer Beschädigung nach § 44 Abs. 3 BNatSchG.
Auch kurzzeitige Inanspruchnahmen wie Befahren oder Zwischenlagerung von Boden oder sonstigen Materialien in den Wintermonaten der Fortpflanzungs- und Ruhestätte führt zur Beeinträchtigung und hat damit eine Auswirkung auf den Reproduktionserfolg der Art. Selbst indirekte Beeinträchtigungen können zur Beschädigung der Lebensstätte führen, wenn sie dauerhaft wirken und damit den Reproduktionserfolg der Individuen verschlechtern (s. Tab. 2).
3.2.4 Räumlicher Zusammenhang
Bei der Betrachtung des räumlichen Zusammenhangs geht es um den Erhalt der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Umgriff des Eingriffs. Es handelt sich hier um eine enge Betrachtungsweise, die auf die kleinräumige Dynamik der Art abzielt und die ausschließlich Flächen mit einbezieht, die mit dem betroffenen Vermehrungshabitat in enger funktionaler Beziehung stehen, um dem möglichen Austausch des betroffenen Individuums oder der betroffenen Individuengruppe zu dienen.
Die Betrachtungsebene bezieht sich daher auf einen kleinen Bezugsraum, der von besiedelbaren Habitaten für die Individuen der Arten abhängig ist. Sie ist daher nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit dem Begriff der lokalen Population nach § 44 Abs. 2 BNatSchG oder dem Begriff der Metapopulation, die populationsökologische Vorgänge getrennter Populationen in größeren räumlichen Zusammenhängen umschreibt.
Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang ist bei den Wiesenknopf-Ameisenbläulingen im Kontext der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte in Verbindung mit benachbarten Vermehrungshabitaten, zwischen denen ein regelmäßiger Austausch der Individuen stattfinden kann, zu sehen. Nachzuweisen ist nun, ob die Falter der beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätte in geeignete und noch unbesetzte Habitatflächen im räumlichen Zusammenhang ausweichen können.
So dienen Flugkorridore wie z.B. nicht gemähte Grabensäume und Böschungsränder zur Wieder- oder Neubesiedlung von Habitaten, wenn diese im räumlichen Kontakt zu besiedelten Vermehrungshabitaten stehen. Stettmer et al. (2001) stellen fest, dass bei einem Großteil der Individuengruppe die Ausbreitungsbewegungen der Falter bei 300 bis 400 m liegt. Für einzelne Individuen sind aber durchaus auch Flüge bis 600 bis 700 m denkbar. Diese Größenordnung sollte auch für die Unterstellung eines räumlichen Zusammenhangs von Ersatzhabitaten nicht überschritten werden.
Sofern nachweislich geeignete Vermehrungshabitate im Umgriff der betroffenen Fortpflanzung- und Ruhestätte ohne gravierendes Ausbreitungshindernis entfernt liegen und nachweislich günstige Aussichten einer artgerechten Bewirtschaftung der Flächen bestehen, könnte ein „Ausweichen“ über Falterflug in vermeintlich freie Habitate postuliert werden. Häufig sind dafür kapazitätserhöhende CEF-Maßnahmen auf den Übernahmeflächen zu vereinbaren.
Neben diesen optimalen Bedingungen spielt allerdings auch noch das Verhältnis der Eingriffsfläche zur Gesamtfläche der Fortpflanzungs- und Ruhestätte eine Rolle. Dieser Anteil sollte auf jeden Fall geringfügig sein, da zu vermeiden ist, dass eine sukzessive Verkleinerung einer solchen Stätte durch eine isolierte Betrachtung von Einzelvorhaben dann zulässig wäre. Ob und in welchem Rahmen ggf. Bagatellschwellen (Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling = 40 m2) in Anlehnung an die Konventionsvorschläge im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (Lambrecht & Trautner 2007) für bestimmte artenschutzrechtliche Fragen herangezogen werden können, ist noch offen (vgl. Trautner & Hermann 2011).
Bei davon abweichenden Sonderfällen (z.B. Betrachtung von mehreren betroffenen lokalen Individuengemeinschaften in einem größeren Raumbezug) ist ebenfalls wie oben beschrieben mit detaillierten Begründungen oder Untersuchungen die Übernahme der beeinträchtigten Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten an anderen Stellen zu belegen.
3.2.5 Schlussfolgerung, mögliches Vorgehen
Das Spannende bei der Beurteilung von möglichen Beeinträchtigungen bei Ameisenbläulingen ist die Berücksichtigung der verschiedenen „Stationen“ des Lebenszyklus‘, um eine Reproduktion zu gewährleisten. Für den Fortpflanzungserfolg ist die räumliche Überlappung von Ameisennest und der Wirtspflanze entscheidend. Es gibt noch eine weitere Besonderheit: Während normalerweise das Nahrungshabitat bei der Beurteilung des Verbotstatbestandes §44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG bei Arten mit größeren Aktionsräumen nicht relevant ist, liegt hier jedoch eine Überschneidung vor, da Nahrungssuche und Fortpflanzung kleinräumig auf der gleichen Fläche stattfinden.
Aufgrund der kleinräumigen Dynamik der Falter ist eine Neu- oder Wiederbesiedlung benachbarter Vermehrungshabitate als typisch für die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge anzusehen, allerdings sollten diese in der Regel nicht mehr als 300 bis 400m auseinanderliegen, keine gravierenden Ausbreitungshindernisse dazwischen liegen und nachweislich günstige Aussichten einer artgerechten Bewirtschaftung für die Übernahmeflächen bestehen.
4 Auswirkungen des Urteils zur Ortsumgehung Freiberg
Bei der eigentlichen Festlegung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt es sowohl bei der Zauneidechse als auch bei den Ameisenbläulingen meist nicht zu Widersprüchen zwischen rechtlicher und naturschutzfachlicher Bewertung, da auch die Rechtsprechung davon ausgeht, dass der gesamte besiedelte Lebensraum gleichzeitig die Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Art darstellt. Durch ein Abfangen der Tiere (z.B. bei der Zauneidechse) vor dem Beginn der Bautätigkeit und deren Verbringung in Ersatzhabitate oder ein Verdrängen in zuvor attraktiv gestaltete Habitate (z.B. beim Wiesenknopf-Ameisenbläuling) ließ sich bislang in Verbindung mit der Privilegierung des §44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG die Verwirklichung des § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG und auch des § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG vermeiden.
§44 Abs. 5 BNatSchG besagt, dass im Falle eines nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffes die Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erfüllt, wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Auch die unvermeidbar mit der Beseitigung der Lebensstätte zusammenhängende Tötung von Individuen (§44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) sollte nach dem Willen des Gesetzgebers von den Verbotstatbeständen ausgenommen werden.
Diese Privilegierungsmöglichkeiten wurden durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur Ortsumgehung Freiberg (Urteil vom 14.07.2011, AZ. 9 A 12/10) nun stärker eingeschränkt.
So hat das Gericht in seinem o.g. Urteil nochmals deutlich gemacht, dass die Privilegierung des § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG nur den Vorhaben zu Gute kommt, deren Eingriffe nach §15 BNatSchG zulässig sind (§ 44 Abs. 5 S. 1 BNatSchG). Es betont jedoch, dass diese Zulässigkeit für das komplette Vorhaben und alle damit verbundenen Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen vorliegen muss, weshalb also nicht auf die konkrete Beeinträchtigung (beispielsweise einer Art) abgestellt werden darf, sondern das Vorhaben als Ganzes betrachtet werden muss.
Führt das Vorhaben in irgendeiner Hinsicht zu Beeinträchtigungen, die den Vorgaben der Eingriffsregelung widersprechen, so ist der Eingriff unzulässig, mit der Folge, dass auch anderen von ihm ausgehenden Beeinträchtigungen die Privilegierung des § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 verwehrt bleibt (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, 9 A 12/10, Rn. 117).
Mit diesem Urteil wurden die Vorhabenträger an die Notwendigkeit der korrekten Abarbeitung der nationalen Eingriffsregelung des §15 BNatSchG erinnert, wobei Fehler in diesem Bereich sich unmittelbar auf die artenschutzrechtliche Betrachtung durchschlagen können (falls in dieser auf § 44 Abs.5 S.2 BNatSchG zurückgegriffen wurde). Deshalb sollte immer, wenn von der Privilegierungsregelung Gebrauch gemacht wird (und natürlich nicht nur dann), besonderer Wert auf einen ordnungsgemäß aufgestellten Landschaftspflegerischen Begleitplan und ein ausreichendes Kompensationskonzept gelegt werden.
Besondere Auswirkungen hat das Urteil aber in Bezug auf die Privilegierung von mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbundenen Tötungen von Individuen, der durch das Urteil quasi ein Riegel vorgeschoben wurde.
Bei der Ortsumgehung Freiberg war als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF) vorgesehen, die im Bereich des Baufeldes vorgefundenen Zauneidechsen vor dem Beginn der Bautätigkeit einzufangen und in geeignete Ersatzhabitate zu verbringen. Das Bundesverwaltungsgericht hielt diese Maßnahme jedoch nicht für ausreichend, um die Tötung von einigen Exemplaren der Zauneidechse vollständig zu vermeiden. Die Berufung auf die Privilegierung des § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG lehnte es mit dem Hinweis auf den Individuenbezug des Tötungsverbotes ab und erklärte die deutsche Regelung damit indirekt für europarechtswidrig. So erläuterte das Gericht, dass Art. 12 Abs. 1a der FFH Richtlinie, anders als das deutsche Recht, keine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes enthalte. Zwar schränke die unionsrechtliche Norm das Tötungsverbot auf absichtliche Tötungen ein, jedoch könne man zumindest in den Fällen, in denen der Handelnde die Tötung in Kauf nehme, von einer Verwirklichung des Absichtsmerkmals ausgehen (BVerwG 2011, Rn. 119).
Da üblicherweise kein Sachverständiger eine Garantie dafür aussprechen kann, allen Individuen einer Art bei einer solchen Abfangmaßnahme habhaft zu werden, und folglich von einer Tötung von Einzelindividuen auszugehen ist, wäre das Absichtsmerkmal in solchen Fällen ebenfalls als erfüllt anzusehen und die Verwirklichung des Tötungstatbestands zu bejahen.
Das Entfallen der Privilegierung des § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG in Bezug auf die mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbundene Tötung von Individuen führt dazu, dass in diesen Fällen (zusätzlich zu der CEF-Maßnahme des Umsiedelns) grundsätzlich die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. Die Folge ist, dass sich das Regel-Ausnahme-Verhältnis ins Gegenteil verkehrt und damit die Ausnahme zur Regel wird.
Einige Stimmen in der Literatur haben bereits versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie si
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen






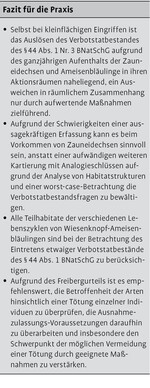
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.