Leserzuschriften zur Maiausgabe
Zu unserem Themenschwerpunkt „Naturschutzverwaltung in Deutschland“ in der Maiausgabe von Naturschutz und Landschaftsplanung haben uns zahlreiche Zuschriften erreicht. Wir möchten mit Ihnen im Austausch bleiben – die Wortmeldungen finden Sie deshalb hier.
von Red erschienen am 08.05.2024Leserbrief zu: Für eine zukunftsfähige Naturschutzverwaltung im 21. Jahrhundert, Teil 1: Grundprobleme auf den drei Verwaltungsebenen in den Bundesländern
Eine lucide Darstellung zum traurigen Zustand des amtlichen Naturschutzes, Danke!
Aus einer (benachbarten) Verwaltung betrachtet, fürchte ich, die Autor:innen unterschätzen stark, wie sehr das Wesen der Verwaltung selbst die Menschen und die Aufgaben auch in den Naturschutzverwaltungen prägen. Innerhalb einer Stelle werden sich keine Future Skills bilden, so Mann oder Frau sie nicht bereits mitbringt. Die Verengung der Aufgaben ist zum großen Teil selbst gewählt und gemacht. Es ist leichter, Forderungen mit Zahlen auf Punkt und Komma zu hinterlegen, als zu diskutieren und Lösungen zu entwickeln.
Die Verwaltungen erfüllen bestens ihren Zweck, Genehmigungsverfahren rasch und rechtssicher durchzuwinken, Komplexität zu verringern. Auf den zweiten Teil freue ich mich sehr. Dass hier so klar benannt wird, wie der amtliche Naturschutz seinen eigentlichen Zweck verfehlt, ist ein wichtiges Zeichen.
von NuL-Leserin (Name ist der Redaktion bekannt)Leserbrief zu den Themenschwerpunkten: Naturschutz, Naturschutzverwaltung sowie der INA Vilm
So – nun ist es gedruckt und online und verfügbar und keiner kann mehr sagen, dass er es nicht wusste. Jeder kann lesen, wie es um den hauptamtlichen Naturschutz im Land steht. Und um die INA, die mit so viel Hoffnung und offenbar Naivität des Ossis ins Leben gerufen wurde, um eine Arbeit im nationalen wie internationalen Rahmen zu leisten, die ihresgleichen sucht und sich nicht von Beamtenkram hat bremsen lassen – bis vor wenigen Jahren. Da begann sich Bonner Behördendenken durchzusetzen und die freifliegenden Ideen des richtig Thinktank genannten Kreises von Ökologen, Philosophen, Biologen, Gesellschaftswissenschaftlern, der sich über viele Jahre auf der Insel Vilm in der Internationalen Naturschutzakademie traf, zu bremsen.
Als ich vor zwei Jahren nach der INA im Organigramm des BfN suchte, fand ich sie nicht mehr – sie sollte verschwinden. Es ist gut, den Prozess, der dahinter steht, zu beleuchten und zu bewerten, denn er steht exemplarisch für eine Entwicklung im Land, die Naturschutz wieder zurück an den Katzentisch schicken will, und international braucht er schon gar nicht mehr zu sein.
Hier in Brandenburg steht es nicht anders – Naturschutz stört und behindert die Wirtschaft, er wird kleingemacht und am besten nicht mehr erwähnt. Das sogenannte Tafelsilber der Nation, von Bundesumweltminister Toepfer noch in höchsten Tönen gelobt, es wurde verscherbelt. Genug Interessenten hat es ja gegeben. Aber so ist das eben in einer Gesellschaftsordnung, in der es ums Geld geht – und zwar nur ums Geld.
von Beate Blahy, Koppel 1, 16278 Steinhöfel, c/o Grüne Liga Brandenburg e.V.Leserbrief zu: Für eine zukunftsfähige Naturschutzverwaltung im 21. Jahrhundert, Teil 1: Grundprobleme auf den drei Verwaltungsebenen in den Bundesländern
Ich habe mich sehr über den ausführlichen Grundsatz-Artikel in der aktuellen NuL gefreut. Viele der dort angesprochenen Grundprobleme treffen zu. Überrascht hat mich, dass keine bzw. keiner der Autorinnen und Autoren selbst in Naturschutzbehörden arbeiten.
Gerne möchte ich daher als Teil der Naturschutzverwaltung meine Erfahrungen einbringen. Ich bin seit 1981 im Naturschutz aktiv, erst ehrenamtlich und nun seit 31 Jahren hauptberuflich in einer Unteren Naturschutzbehörde im Bergischen Land, die ich seit über 20 Jahren leite.
Wir brauchen im Naturschutz weniger „Future Skills“, wir brauchen vor allem mehr klassische „Soft Skills“.
Das brauchen wir im Naturschutz:
- Pragmatismus, Praxisnähe und Praxiserfahrung, Engagement, Ausdauer, Herzblut
- Vernetzung innerhalb und außerhalb der Verwaltung, Verbündete suchen und pflegen
- Gute Kenntnisse der regionalen Besonderheiten und Erfordernisse
- Guter Kontakt zur Bevölkerung und zu Naturschützenden und Naturnützenden
- Entscheidungs- und Umsetzungsfreude
- Die Fähigkeit, schnell und unbürokratisch zu handeln
- Das Vermögen, mit langjährigen Negativtrends im Naturschutz positiv umzugehen
- Die Fähigkeit, Konflikte auszuhalten und zu lösen
- Einfühlungsvermögen
- Die Kunst, aus wenig viel zu machen, einfache Maßnahmen mit großer Wirkung
- Das Team und die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter wertschätzen, loben und unterstützen
- Präsente Kommunikation (tue Gutes und erzähle davon), vermitteln vor Ort
- Zuversicht und Experimentierfreude
- Grenzen austesten
- Naturschutz durch konsequente Maßnahmenumsetzung sichtbar machen, besondere Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen
Die im Fachartikel angesprochenen sechs Herausforderungen lassen sich lösen. Hier ein paar ganz kurze Anregungen.
- Durch tägliche Prioritäten-Setzung (Wo lohnt sich mein Einsatz, wo nicht?) und pragmatische Fallbearbeitung (Beispiel: Muss es immer ein Bescheid sein? Reicht nicht ein „Okay“ per Mail?) gelingt es oft, zeitliche Überforderung zu vermeiden. Tipp: Nach dem Pareto-Prinzip handeln. Es besagt, dass 80 % der Ergebnisse mit 20 % des Gesamtaufwandes erreicht werden. Die verbleibenden 20 % der Ergebnisse erfordern mit 80 % des Gesamtaufwandes die meiste Arbeit.
- Besser die vorhandenen Instrumente (u.a. Artenschutz und Eingriffsregelung) nutzen, statt auf die Erreichung ganzheitlicher, fast utopischer Ziele zu warten.
- Den oft zu bürokratischen Rahmen verlassen, wo es möglich ist. Das „weite Ermessen“ nutzen. Ungewöhnliche und kreative Wege gehen.
- Förderung muss viel unkomplizierter werden. In Zeiten des Artensterbens und vieler Kommunen im Nothaushalt muss auch 100 %-Förderung möglich sein.
- Statt „Future Skills“ stärker „Soft Skills“ (s.o.) in den Fokus nehmen.
- Selbstständigkeit der Mitarbeitenden fördern, flache Hierarchien schaffen, wohlwollender Umgang miteinander.
- Zeit für Reflexionen einplanen, Supervisionen anbieten.
Leserbrief zum Themenheft 5/2024
Die INA Vilm war für mich, der ich am Nationalparkprogramm der DDR mitgearbeitet und dann fast 3 Jahrzehnte das Nationalparkamt Müritz als Naturschutz-Landesbehörde geleitet habe, ein starker Fels im Chaos von Länder-Klein-Klein, Umstrukturierungen und anderen steten Schwächungen des Naturschutzes in Deutschland!
Enttäuscht hat mich aber stets die Rolle des BfN, von dem ich (als wohl naiver Ossi?) die dringend erforderliche, strategische Ausrichtung für den gesamtdeutschen Naturschutz erwartet hatte.
Die INA machte immer als Denkfabrik Hoffnung, neue Wege zu finden. Dies wurde aber im BfN - so wie wir in diesem Heft bitter bestätigt bekommen – nicht verstanden oder nicht gern gesehen.
Sich nun selbst den letzten Lebensnerv zu kappen, ist leider symptomatisch für "den Naturschutz": die Selbstzerfleischung durch Kleinkariertheit.
Wenn auf dieser Ebene (BfN/INA) nichts mehr an großen Würfen zu erwarten ist, leiden die immer mehr überforderten, stets geprügelten und schließlich demotivierten Unteren Naturschutzbehörden in den Landkreisen und Ländern immer mehr. Und der Naturschutz versinkt weiterhin in Bedeutungslosigkeit für diese Gesellschaft.
von Ulrich Meßner, U.Messner@t-online.deLeserbrief zum Themenheft 5/2024
Gratulation an den Herausgeber und die Autoren zu dieser mutigen und auch selbstkritischen Autopsie der immer mehr erstarrenden Naturschutzverwaltung. Die Beiträge beschreiben aus unterschiedlichen Blickwinkeln ein Potpourri aus Fremdbestimmheit, fehlendem Mut, Ohnmacht, Unfähigkeit, Wissens- und Erfahrungserosion, Realitätsverweigerung, Praxisferne, Empathiemangel, struktureller und strategischer Überalterung, Verkrustung, Resignation sowie verzweifelten Versuchen „doch noch was zu retten“.
Das alles ist nicht naturschutzspezifisch, sondern vielleicht der leider normale, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen erfolgte und im Öko-Bereich gerade galoppierende Alterungsprozess, der sich aber gerade in der Kombination mit fehlendem Reformwillen und wachsenden Ansprüchen von außen und innen verheerend auf die eigentlichen Ziele – nämlich die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen – auswirkt. Gerade auch weil es den vielen Anspruchsgruppen, die Natur- und Heimatbewahrung, Landschaftsmanagement und Umweltvorsorge meist nur in Sonntagsreden vor sich hertragen, allzu einfach gemacht wird.
Das fängt schon damit an, wer oder was „DER Naturschutz“ eigentlich ist. Etliche meiner Weggefährten und Freunde sind auch Weingärtner, Jäger, Fischer, Handwerker ... Dabei gibt es viele, die mehr einbringen, bewegen und tagtäglich machen – trotz ständiger „Gängelei“ durch „DEN“ behördlichen und verbindlichen Naturschutz – als Naturschutzbehörden jedweder Art noch Verbandsvertreter aus dem (wichtigen) Ökobereich die sich immer mehr zu Naturschutzverhinderern entwickeln.
Natürlich gibt es auch neue Ideen und punktuelle Erfolge und es darf das oft bis zur Selbstaufgabe gehende Engagement Vieler nicht verkannt werden. Doch wirklich vorangekommen – so auch der Grundtenor im Schwerpunktheft – sind „wir“so gut wie nicht. Das Ganze ist so komplex, dass ich nur ein paar, aus vielen Erfahrungen heraus resultierende Beispiele und Gedanken anführen kann. Im Sinne meines Mottos „Gedanken über Nachgedachtes“ danke ich für den Impuls in Naturschutz und Landschaftsplanung und bringe gerne ein paar Überlegungen – auch als Anregung zur durchaus provozierenden Diskussion – ein. Dabei erscheint mir die Diskrepanz unserer Binnenbetrachtung zur Relevanz, wie „der Naturschutz“ von außen gesehen wird, für künftige Entwicklungen immer bedeutender zu werden.
1. Neid und Strukturerstarrung – Spezialfall Internationale Naturschutzakademie Vilm
Reinhard Piechocki und Norbert Wiersbinski haben die von Vielen erlebte Behinderung und schrittweise „Entmachtung“ bis jetzt zur faktischen Ausschaltung der segensreichen, vom weitsichtigen Klaus Töpfer auf den Weg gebrachten, Naturschutzakademie Insel Vilm mit ihren verschiedenen, durchdacht angelegten Forschungs- und Bildungsbereichen erleben oder beobachten können und müssen. Wir kennen dies aus der Verhaltensforschung bei vielen Säugetieren: Ist eine Erhebung wie ein Hügel oder Fels da, kacken erst die einen, dann die anderen drauf, um zu markieren „hier bin ich“. Am Schluss ist es der Löwe, der zeigt, wer Herr der Savanne ist. Nicht anders bei den Maulwurfshaufen auf unserer Obstwiese. Da ist es erst der Marder, dann der Dachs, der eins draufsetzt und mit seinem Häufchen markiert, was Sache und wer der Chef ist. Oder auch bei uns Menschen: Auf den von Cäsar und später von Napoleon „importierten“ Obelisken sitzen sei langem kirchliche (bewusst sage ich hier nicht christliche) Insignien.
Neid und falsch verstandenes Machtgehabe sowie Kompetenzmissbrauch führen, es scheint ein Naturgesetz zu sein, dann dazu, dass nicht in das System passende Strukturen und Menschen – erst recht, wenn sie sich als erfolgreich und PR-mächtig erweisen sollten – in Schranken verwiesen werden.
Außer es gelingt gesellschaftlich so erfolgreich zu sein, dass man sich nicht mehr getraut „Hand anzulegen“. Es ist vergleichbar mit einer klassischen Blumenwiese. Wenn die ersten Gräser und Blumen sich gegen den Himmel strecken und sie werden gleich niedergemäht, gibt’s halt schnell nur einen „Deutschen Einheitsrasen“. Von wegen Vielfalt.
Hinzu kommt, dass Institutionen wie Vilm und viele andere trotz hervorragender Arbeit dennoch ein soziologisches Schattendasein führen und nicht die gesellschaftliche Wirkmächtigkeit entfalten (können) wie andere Strukturen. Erst recht nicht, wenn die „neuen Machthaber“ ihre eigenen grünen Wurzeln, Ideen und Ideale vergessen, weil es um Macht und nicht um Natur geht. So, wie dagegen ankämpfen? Die Rufe nach Toleranz und gesunden Menschenverstand bleiben leider meist ungehört. Macht sticht Macher!
Fazit: die Zerschredderung der INA ist leider nur ein Beispiel von vielen. Eine traurige wie ärgerliche Entwicklung, weil Wissen und Erfahrung sowie Impulspotenziale für andere pulverisiert werden.
Es ist auch eine Respektlosigkeit gegenüber Prof. Dr. Klaus Töpfer, der – unterstützt von seiner damaligen Verwaltung, politischen und fachlichen Weggefährten – „Vilm entscheidend auf den Weg brachte“.
Über Jahre hinweg war die INA mannigfaltiger Thinktank und Impulsgeber, gerade auch für die akribische Aufarbeitung grundsätzlicher und wegweisender Themen. Hier denke ich unter anderem an die Vilmer Thesen zur Heimat, zur Biodiversität, zu Grundsatzfragen des Naturschutzes und vieles mehr.
Wir haben bei der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg den Austausch mit Vilm immer als wertvolle Unterstützung empfunden, erhielten wir doch Diskussionsgrundlagen, die wir in diesen Dimensionen nicht hätten erstellen und aufarbeiten können. Meinen damaligen Kolleginnen und Kollegen der anderen, im Bundesweiten Arbeitskreis der Umweltbildungsstätten in Deutschland (BANU) Akademien ging es sicherlich ebenso.
Leider durften bei unseren Koordinationskonferenzen die Vilmer immer nur als Gast – nicht als Mitglieder – teilnehmen, weil „Vilm zu einer Bundeseinrichtung“ gehörte. Das mag verstehen, wer will, mit gesundem Menschenverstand ist das nicht nachvollziehbar.
Es ist zu befürchten, dass die „Entscheider“ nicht die Größe und den Mumm haben, auf das eigentlich erforderliche „Reset“ zu gehen. Ungeachtet dessen bleibt die Frage im Raum, mit welcher „Herrenmenschen-Mentalität“ hier mit verdienten und hoch engagierten, weithin anerkannten Mitarbeitern umgegangen wurde. Was tun? So wie jetzt Mut zeigen und die Dinge ansprechen. Auch in vielen anderen Bereichen.
2. Kompetenz-Illusion
Viele Leute des amtlichen Naturschutzes werden heute auf die Menschheit „losgelassen“, ohne dass sie über irgendeine Praxiskenntis verfügen. Die meisten unserer Praktikanten bei der Umweltakademie Baden-Württemberg hatten ab etwa der Jahrtausendwende trotz des Interesses an der Natur noch nie in einem Garten gearbeitet, einen Baum oder eine Hecke gepflanzt oder waren – wie früher in meiner Heimat am Mittleren Neckar üblich – mit Eltern oder Großeltern in kontinuierlichem Einsatz im Weinberg oder auf der Obstwiese. Auch Artenkenntnis hatten sie nicht. Kein Wunder, wurde diese weder vom Elternhaus noch von der Schule vermittelt.
In etlichen Bundesländern wurde der Biologieunterricht als eigenständiges Lehrfach in verschiedenen Klassenstufen sogar gestrichen. Wie aber sollen die letzten Helden der Landschaft, die nicht Biologie oder Geografie studiert haben, aber oft mehr Artenkenntis aufweisen als die akademisch „gebildeten Naturschützer“, gewonnen und überzeugt werden, wenn sie realisieren, mit welch welt- und praxisfremden Gesprächspartnern sie es zu tun haben? Mit Beispielen könnte ich locker mehrere Bücher füllen. Wir haben gut durchdachte Studiengänge, aber oft die falsche Prioritätensetzung. Wie kann es möglich sein, ein Biologiestudium zu absolvieren, ohne Amsel und Spatz voneinander unterscheiden zu können? Sie unterliegen in viel zu vielen Fällen ganz einfach der Kompetenzillusion. Das aber führt zu abstrusen Forderungen und Vorschriften, weshalb viele der ohnehin letzten Praktiker, die artenreiche Kulturlandschaft durch Pflege und mühevollen körperlichen Einsatz erhalten, resignieren und aussteigen. Da helfen auch Förderprogramme nicht.
Die Jungen steigen schon gar nicht mehr ein, sind gefrustet, wenn sie an heißen Tagen in einem Terrassenweinberg – etwa hier am Neckar – stehen, nach dem Job noch Laubarbeiten verrichten, während die anderen im Tal fröhlich Radfahren, Joggen oder Wandern, um anschließend den Tag im Biergarten oder beim Italiener mit billigem Importwein ausklingen zu lassen. Währenddessen kommen viele „Hobbywinzer“, die zunehmend gerne vom Hobby ablassen, dann auch keine Trockenmauern mehr reparieren, und erst recht die Profis selbst bei Selbstausbeutung auf Stundenlöhne von 2,50 bis 10 Euro. Wie sie angesichts des internationalen Drucks und der steigenden Kosten (Dünger, Treibstoff, Pflanzenschutz) noch ihren Wein verkaufen wollen, ist die andere Frage. Wir stehen an Neckar, Rhein, Mosel, Ahr und anderen Terrassen-Weinbaugebieten vor einem dramatischen Wandel der über 1000-jährigen Kulturlandschaft mit ihrem reichen Naturerbe. Währenddessen bemängeln in vielen Fällen Naturschutzvertreter kleinste Kleinigkeiten, wenn eine neu errichtete – weil zuvor eingefallene – Trockenmauer nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht. Wer eigentlich legt fest, was in den Einzelfällen „gute fachliche Praxis“ ist?
Müssen wir uns nicht alle fragen, wie solche Landschaften ohne Natur- und Denkmalschutz, ohne Landschaftsplaner und -ökologen so ganz ungeplant entstehen konnten? Warum wird nicht mehr auf die Erfahrungswerte der Bürger – des jetzt häufiger zitierten Citizen Sience – vertraut?
Erst recht abstrus und kontraproduktiv wird es, wenn gut gemeint, aber völlig weltfremd Vorschriften entwickelt werden, die weder Natur noch Mensch helfen. So der Versuch des gescheiterten (eigentlich erforderlichen) Pestizidgesetzes. Verboten werden sollte der Pflanzenschutz in Schutzgebieten; damit auch in Landschaftsschutzgebieten. Viele Weinberge aber liegen in Landschaftsschutz- oder anderen Schutzgebieten. Welcher Schwachsinn. Auch der biologische Pflanzenschutz wäre verboten gewesen. Warum? Weil nicht mit den Machern, den Praktikern geredet wurde. Natur- und Umweltschutz lässt sich nicht „durchregieren“, nur mit grünen Fantasien enden wir in der grauen Wirklichkeit. Die Winzer, „unsere“ natürlichen Partner, darunter viele Bio-Pioniere, waren entsetzt, gingen auf die Barrikaden, wie auch viele Landwirte. Jetzt wurde gar nichts erreicht, weil die „Großen“ – den Bauernprotesten zum Dank – gesiegt haben, flankiert von den Helden der Landschaft. Die Agrargroßbetriebe machen weiter wie bislang, kassieren die meisten öffentlichen Gelder; die Kleinen – Steillagenweingärtner, Obstwiesenbesitzer und kleine Höfe – gehen drauf. Die Antworten „des Naturschutzes“: „Da braucht es Forschung, um neue Modelle zur entwickeln …“ Das ist gerade so, als wenn man einem Verhungerndem an der Saharapiste sagt, dass man ein ausgewogenes Ernährungsprogramm für ihn entwickelt, statt ihm gleich einen Leberkäsweck oder was auch immer in die Hand zu drücken.
Es wurde leider jahrelang mit viel Engagement an den in der Praxis (noch) engagierten Menschen vorbeiverwaltet und geforscht.
3. Wir stecken in der Ökoblase – Wissenserosion und Entgleisungen
Früher – noch in den 60er und 70er Jahren – wusste jede Oma, jeder Opa, ganz einfach durch die Lebensumstände, das Elternhaus, die Schule (Kindergärten gabs für viele vor und direkt nach dem Krieg noch selten) mehr über biologische Vielfalt, den Umgang mit dem Lebendigen, als viele heutige Akteure. Ja, wir haben super Wissenschaftler in den Naturkundemuseen, in zoologisch-botanischen Einrichtungen, an mancher Uni und anderen Hochschulen und – behindert durch administrativen Ballast – auch in Umweltverwaltungen, in denen die Leute selten noch frei arbeiten könne. Aber wie viele Taxonomie-Lehrstühle gibt es noch? Währenddessen gibt es in Deutschland über 170 Lehrstühle, die sich mit Genderforschung beschäftigen … Unter Artenschutz müssten längst die noch verbliebenen Fachleute – die Generation der heute über 80- und 90-jährigen – gestellt werden. Was nützen Unterschutzstellungen von Arten und Lebensräumen, wenn es bald niemanden mehr gibt, der die Arten bestimmen kann.
Wenn es nicht gelingt, die eigene Öko-Blase zu verlassen und auf andere gesellschaftliche Bereiche ohne Vorbehalte zuzugehen, werden wir in 10 Jahren keinen Schritt weiter sein. Signifikant für die Situation ist der Deutsche Naturschutztag: für die Akteure ein riesiger Aufwand, man sieht sich, kennt sich, schaut argwöhnisch, wenn andere vielleicht besser sind, bzw. buhlt um die wenigen öffentlichen Mittel, aber wo sind etwa bei den Eröffnungen die wirkmächtigen Wirtschaftsvertreter, Banker, wenn das Ganze – wie u.a. in Magdeburg erlebt – in Hinterquartieren, fern des normal pulsierenden Lebens stattfindet?
Es ist auch nicht gelungen, die gesellschaftlichen Entgleisungen der „neuen“, eigentlich erforderlichen Jugendbewegung zu verhindern bzw. frühzeitig klare Abgrenzungen und Distanzierungen zur formulieren. So aber sind in der öffentlichen Wahrnehmung Friday for Future, Extincton Rebellion oder Last Generation im selben Ökosumpf wie „wir alle“. Vertrauen, Verlässlichkeit und Partner gewinnen wird damit angesichts der Erosion des Artenwissens und der öffentlichen Akzeptanz immer schwieriger.
Was tun? Offen, mit Bildungsempathie auf andere zugehen, hören, welche Nöte die potenziellen Partner haben, womit sie täglich kämpfen, akzeptieren, dass sie keine Feinde sind. Aus Konfliktgegnern Konfliktpartner machen.
4. Falsch verstandener Artenschutz - Wenn der Mensch nicht mehr zählt
Wenn tausende von Saatkrähen nach Krähenart krähen und kacken und dies in Schul- und Wohnvierteln Jung und Alt die Frühjahr- und Sommerwochen verdirbt, Behörden dann gleichermaßen lapidar wie hilflos auf den rechtlichen Schutzstatus verweisen, sind wir längst in der Sackgasse. Gezielter Artenschutz hat viel bewirkt – denken wir an Wanderfalke, Uhu, Storch, Biber. Doch wenn Schutzvorschriften in Unbeweglichkeit erstarren und die Menschen in den Siedlungen weniger zählen, als die nicht mehr gefährdete Kreatur, werden wir noch viel mehr Akzeptanz verlieren. Und das bei einer Bevölkerung, die trotz vieler Krisen und der leider um sich greifenden Lethargie selbst etwas zu tun. Noch nie – das habe ich bei vielen Projekten positiv erleben können – war die Bevölkerung so für die Natur aufgeschlossen wie heute. Was tun? Wenn es nicht mehr anders geht und Vergrämungsmaßnahmen nicht wirken (das ist überall der Fall) müssen die Bestände kontrolliert werden. Etwa durch Eierentnahme und/oder Abschuss. Das trifft in anderer Weise etwa auch bei Nilgänsen zu. Doch welche Jäger trauen sich noch etwas? Was tun? Probleme erkennen, benennen und die Entwicklung nicht einfach laufen lassen.
5. Es gibt genug Personal - es ist falsch eingesetzt
Von einigen Bereichen abgesehen, gibt es heute genug Naturschutzpersonal, rechnet man die anderen, verwandten Gebiete wie Gewässer- und Bodenschutz, Landschafts- und Raumplanung und vieles andere – erst recht die verschiedenen Hierarchieebenen – mit ein. Wenn in einem ambitionierten Weideprojekt den zwei, drei (ehrenamtlichen) Wasserbüffelmanagern bei Terminen oft mehr als ein Dutzend Machthaber von Behörden – die Machthaber-Meinenden der Verbände nicht einberechnet – gegenüberstehen und alle für ihren Bereich ihre Forderungen stellen, kontrollieren und kritisieren, geben die Praktiker bald auf, andere fangen erst gar nicht an.
Im amtlichen Naturschutzbereich ist in den vergangenen Jahren erfreulich aufgerüstet worden. Die Effizienz ist angesichts überforderter und überbordender Bürokratie auf der Strecke geblieben. „Ich habe das Gefühl, dass da oft zwei einen vom schaffen abhalten“, sagte mir ein ehemaliger Naturschutzbehördenleiter zur heutigen Situation. Hinzu kommt, dass viele nur einmal im Monat rauskommen und sonst in Meetings und im (einst selbst gepflanzten) Vorschriftendschungel hängen. Viele fühlen sich angesichts dieser Ohnmacht als Kontrolleure, statt als Helfer und Administrations-Guides, die den Praktikern zur Hand gehen.
Viele Ressourcen sind durch nicht mehr nachvollziehbare „Kontroll- und Dokumentationsaufgaben“ gebunden. Beispiel: Der ganze Eidechsenwahn, bei dem jedes einzelne Tier geschützt werden muss, obwohl etwa die Mauereidechsen-Bestände in vielen Gegenden geradezu „explodieren“, um eine unwissenschaftliche Beschreibung zu gebrauchen. Wenn dennoch bei eigentlich unstrittigen Bauvorhaben Gutachten gefordert werden, welche die Maßnahmen oft ein, zwei Jahre und mehr verzögern und die Kosten in die Höhe bis zur nicht mehr Finanzierbarkeit treiben, ist keinerlei Akzeptanz seitens der Maßnahmenträger oder der Bevölkerung zu erwarten.
Was passiert? Es waren etliche Bürgermeister, Bauhof- und Stadtgärtnereileiter oder Betriebsinhaber, die mir unter vorgehaltener Hand und im Vertrauen erzählten, dass sie es an Interimsflächen – etwa Natursteinzwischenlagerungen für die spätere Wiederverwendung – erst gar nicht zur Ansiedlung von Zaun- oder Mauereidechsen kommen lassen, sondern alles „sauber“ halten um dem „ganzen Zirkus“ und damit Ärger zu entgehen.
Mehrere engagierte Leute aus Unteren Naturschutzbehörden in verschiedenen Regionen fassen dies – der Frust ist groß – etwa so zusammen: „Wenn ich richtigen Naturschutz machen würde, verstoße ich laufend gegen Rechtsvorschriften“. Viele trauen sich nicht, dies öffentlich auszusprechen, weil sie Repressalien befürchten. Ganz klar: natürlich gibt es Ausnahmen. Was tun? Positive Beispiele herausstellen, auch wenn nicht alles perfekt scheint. Bürgerinnen und Bürger gewinnen, so wie es u.a. die Nationalparke, Naturparke, die Naturschutzzentren, Biosphärengebiete, die Umweltakademien (sofern sie noch dürfen) im Bereich Wissensvermittlung und Umweltbildung machen, und auf dieser Basis mehr einfordern. Kommunen viel stärker als bislang einbinden.
Das wird aber nichts, wenn es keine Bereitschaft gibt, Gesetze und Verordnungen, die aus einer anderen Zeit mit anderen Verhältnissen stammen, zu reformieren. Mit dem damals epochalen Artenschutzrecht auf EU Ebene aus den 70ern und 80ern Jahren – gut gedacht, aber überholt – können keine Zukunftsprobleme für die biologische Vielfalt bewältigt werden. Ebenso beim Gebietsschutz: in BW stehen alle Obstwiesen generell unter Schutz. Gut gemeint. Aber was nützt dies, wenn all die Menschen, die Helden der Landschaft, die wie ihre Vorfahren das Natur- und Kulturerbe gepflegt haben und noch teilweise pflegen, jetzt wegbrechen? Das alles ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, für die Naturbewahrung lästiges Beiwerk ist. Was tun? Der Realität ins Auge sehen, Reformbedarf erkennen und akzeptieren und handeln. Sonst nehmen dies andere in die Hand, die ganz bestimmt weniger sorgsam vorgehen werden.
6. Wir lassen uns ablenken.
Auch die Mittel für Naturschutzforschung in verschiedenen Ausprägungen, für Erhaltungs- und Pflegeprogramme wurden in den vergangenen 15 Jahren massiv erhöht. Doch diese verpuffen angesichts der Flut an Aufgaben und lenken von echtem Handeln ab. Bei der Suche nach Finanzmitteln – daran hängen in Forschung und Praxis ja nicht wenige Stellen – lassen wir uns schon lange viel zu sehr blenden, ablenken ... So werden Kartierungen und Gutachten erstellt, die wegen der dynamischen Entwicklung in Feld, Wald, Flur und Gesellschaft schon nach kurzer Zeit obsolet sind. Wir brauchen viel mehr Flexibilität, um dynamische Prozesse zuzulassen und die Bereitschaft „lernende Projekte“ anzugehen.
Was tun? Selbstkritisch bei aller Erfordernis für Forschung und Erprobung auch in unserem eigenen Wirken mehr Dynamik und Flexibilität zulassen. Die Zeit dafür ist denkbar knapp.
von Claus-Peter Hutter, claus-peter.hutter@naturelife-international.orgLeserbrief zum Themenheft 5/2024
Zum Mai-Heft von 'Naturschutz und Landschaftsplanung‘ möchte ich Sie herzlich beglückwünschen. Die Artikel zur Geschichte und zum Schicksal der INA Vilm und zu aktuellen Problemen des administrativen Naturschutzes sind außerordentlich informativ, decken fragwürdige Entscheidungen und Entwicklungen auf und geben eine zwar pointierte, aber konstruktive Kritik. Man kann nur hoffen, dass im BfN die Entscheidungen zur INA revidiert werden, sodass diese nicht nur bundesweit, sondern weltweit hochgeschätzte Institution auch weiterhin als interdisziplinäre ‚Denkfabrik‘ für zeitgemäßen Naturschutz wirken kann.
Ich selbst habe seit vielen Jahren an einer ganzen Reihe von Veranstaltungen auf Vilm mitwirken können und habe immer wieder erfahren, wie inspirierend die Tagungen, Konferenzen und Workshops für die Teilnehmenden aus den verschiedensten Tätigkeitsbereichen waren. 1996 war ich zusammen mit Horst Stern zum ersten Mal auf der Insel – nicht nur er war beeindruckt.
Ich möchte mit dieser Zuschrift aber auch noch einen kleinen Hinweis geben auf eine Chance, die das BfN leider verspielt hat. 2015 wurde in kleinem Kreis während der Sommerakademie der Deutsche Preis für Nature Writing aus der Taufe gehoben. Die INA-Leitung, der Verleger Andreas Rötzer (Matthes&Seitz) und andere Beteiligte waren überzeugt, dass eine Literatur, die sich der intensiven Naturerfahrung widmet, auch für den Naturschutz von großer Bedeutung sein kann. Es gelang, das BfN für eine Unterstützung und Beteiligung bei der Preisvergabe und für das Schaffen der Preisträger*innen zu gewinnen. Ein dreiwöchiger Schreibaufenthalt auf der Insel wurde vom Amt gestiftet.
In der Praxis erwies sich dann die Durchführung der Aufenthalte als teilweise schwierig, die Abstimmung mit der Leitung des BfN gestaltete sich mühselig und eine sichtbare Mitwirkung des Amtes an der Preisvergabe kam leider nicht zustande. So war es wohl nur folgerichtig, dass sich das BfN nach wenigen Jahren aus der Beteiligung an dem inzwischen etablierten Preis zurückzog. Es gelang aber, stattdessen das UBA für eine Mitträgerschaft beim Preis zu gewinnen und in Person der Kunstbeauftragten des Amtes gibt es eine sehr konstruktive und engagierte Mitwirkung.
Ich denke, das BfN hat eine Möglichkeit verpasst, auch in der kulturellen Öffentlichkeit Aufmerksamkeit für das Naturschutzanliegen zu fördern. Was auf den interdisziplinären Sommerakademien immer wieder gelang – Impulse auch durch die Einbeziehung der kulturellen Dimension des Naturschutzes zu geben – scheint aus Sicht der Behörde offenbar keine Aufgabe zu sein. Das ist angesichts der aktuellen Krisen unseres Naturbezugs mehr als bedauerlich. Kaum jemand hat das schärfer gesehen als Horst Stern, der große Journalist, Schriftsteller und Naturschützer.
von Prof. Dr. Ludwig Fischer, fld.fischer@t-online.deLeserbrief zum Themenheft 5/2024
Glückwunsch an die Schriftleiter der Sonderausgabe aus Anlass der Auflösung der INA Vilm. Reinhard Piechockis Artikel ist zwar demonstrativ betitelt, aber eher noch zurückhaltend, dafür umso treffender. Ich habe in den vergangenen fast 30 Jahren immer wieder ausländische Gäste ehrenamtlich auf der Insel fachlich mitbetreuen dürfen, insbesondere aus dem Iran, auch um den Dauerwaldgedanke Alfred Möllers im Ausland bekannt zu machen. Ich konnte erleben, wie gerade die Abgeschlossenheit der Insel dabei unterstützte, die internationalen Verbands- und Amtsgäste, die meistens nicht aus den übersättigten westlichen Wohlstandländern kamen, auf der Insel für einen anderen, neuen Blick auf ihre Naturschönheiten und -kostbarkeiten daheim zu gewinnen. Es war regelmäßig ein geheimnisvoller genius loci, der das unterstützte und wie wohl keine andere Institution des Naturschutzes weltweit mit so wenig Mittelaufwand Gewaltiges für den Weltnaturschutz ermöglichte. Die INA Insel Vilm ist (oder war) die glaubwürdigste Art seitens der reichen Bundesrepublik, immerhin einer der historischen Hauptschuldigen weltweiter Zerstörung von Natur und Umwelt auf dem Globus, zur Bewusstseinsumkehr beizutragen. Die jetzige, offenkundig scheibchenweise beabsichtigte Zerschlagung der INA ist deswegen eine Fehlentscheidung sondergleichen. Ich bin fest überzeugt, dass die zuständige Ministerin Steffi Lemke weder über das Ausmaß noch die Tragweite dieser fast Nichts einsparenden innerbehördlichen Organisationsentscheidung umfassend informiert wurde – und sicher nicht im Geringsten über die desaströse internationale Wirkung.
Ich kenne Steffi Lemke seit Beginn Ihrer politischen Laufbahn als junge Bundestagsabgeordnete der Grünen Sachsen Anhalts Anfang der 90er Jahre und habe sie später seitdem fortlaufend aufmerksam beobachtet. Damals ist es mir mit ihrer Unterstützung gelungen, die damalige grüne Umweltministerin Heidrun Heidecke zu gewinnen, den zur Privatisierung anstehenden ehemaligen Privatwald v. Kalitsch in Bärenthoren durch einen Waldtausch mit dem Land zu verhindern. Dieser (informale und leider noch immer forstamtlich versteckte) echte „Kulturwelterbe“-Ort, an dessen Bespiel Alfred Möller 1922 seinen weltberühmten Dauerwaldgedanken erstmals publizierte, ist seitdem in öffentlicher Hand immerhin gesichert. Ich kann deswegen aus persönlicher Erfahrung der damaligen Zusammenarbeit sagen: Steffi Lemke ist eine bemerkenswert glaubwürdige, wie menschlich verlässliche Umweltpolitikerin, wie wir in der langen Zeit später nur noch sehr wenige hatten. Ich glaube, wenn es den Protagonisten gelänge, die Tragweite wie die Unhaltbarkeit dieser Hintergrund-Machenschaft ihr persönlich näherzubringen, dass sie sich dann korrigierend einschalten würde. Ich bin mir dessen sogar sicher.
von Wilhelm Bode, wilh.bode@gmail.comLeserbrief zu: Für eine zukunftsfähige Naturschutzverwaltung im 21. Jahrhundert, Teil 1: Grundprobleme auf den drei Verwaltungsebenen in den Bundesländern
Dem Artikel über eine zukunftsfähige Naturschutzverwaltung kann ich aus der Praxis (über 30 Jahre Planungsbüro) voll zustimmen. Ich möchte mich v.a. auf Entwicklungen konzentrieren, die wir als „Bürokratisierung und Entökologisierung des Naturschutzes“ bezeichnen.
Von der Ökologie zum TierschutzVor 50 Jahren revolutionierte die Ökologie den Naturschutz, man entwickelte ökologisches Denken, entdeckte bald den Biotopschutz, der „Nistkasten-Naturschutz“ wurde belächelt (heute ist Nistkästen Aufhängen wieder eine der häufigsten Naturschutzmaßnahmen, ein Treppenwitz der Naturschutzgeschichte). Dann kam der Artenschutz, da begann es schon mit dem Scheuklappendenken und nun haben wir faktisch Tierschutz (=Individuenschutz selbst für häufige Arten). Und uns vom ökologischen Denken weit entfernt. Dass wir das meist der Rechtsprechung zu verdanken haben ist das Eine, aber dass wir als Fachleute dies noch als Erfolg empfinden, statt solche Fehlentwicklungen zu korrigieren, ist bitter.
Was ist die Folge des Individuenschutzes und des Artenschutzes selbst für häufige Arten? Bsp. Feldlerche: Sie ist in ganz Bayern mit 55.000 bis 135.000 Brutpaaren häufig, ein starker Rückgang ist v.a. In Südbayern erfolgt, in Nordbayern ist die Art sehr häufig und in vielen Regionen auch in suboptimalen Habitaten anzutreffen, was für eine starke und vermehrungsfreudige Population spricht. Entsprechend regelmäßig betreffen Planungen Reviere der Feldlerche. In Bayern gilt seit kurzem der Grundsatz: Es darf keine Feldlerche weniger geben. Jeder Brutrevierverlust muss 1:1 ausgeglichen werden und zwar mit hohem Flächenanspruch auf Grundlage eines faktisch verbindlichen Leitfadens (z.B. 0,5 ha Ackerbrache oder 1 ha Extensivgrünland pro Brutrevier). Und so bestimmen aufgrund ihrer Häufigkeit die Artenschutzmaßnahmen für die Feldlerche regelmäßig das Ausgleichserfordernis. Mit der Folge, dass wir meist Allerweltsbiotope als Ausgleichsflächen entwickeln (Blühstreifen, Ackerbrachen …).
Ausgleichsflächen sind ein wichtiges Instrument des Naturschutzes. Früher haben wir bei Ausgleichsflächen versucht, das Beste für den Naturhaushalt, für die Biodiversität herauszuholen. Wir haben Feuchtgebiete vergrößert, Trockenbiotope geschaffen etc. Das ist (fast) vorbei. Der Acker ist in unserer Praxis das Wichtigste geworden, als Blühstreifen, Lerchenfenster oder Brache.
Ökologischer Effekt: überschaubar, für den Naturhaushalt eher gering. Dabei hätten wir gigantische Aufgaben im Hinblick auf die Biodiversität oder den Wasserhaushalt. Das letzte Mal ist es vor ca.5 Jahren gelungen, trotz Betroffenheit von 5 Feldlerchenrevieren bei einer Straßenplanung nachhaltige und hochwirksame Ausgleichsflächen zu schaffen: auf 4,5 ha zusammenhängender Ackerfläche direkt neben einem wertvollen Sumpfwald und Niedermoor konnte eine Flussrenaturierung mit Stillgewässern und Auwaldsukzession realisiert werden. Heute ein fantastisches Biotop, Folgepflege, Energieaufwand gleich null + großer Effekt für Biodiversität und Naturhaushalt. Heute wären es 3 ha Ackerbrachen geworden, der Spielraum der Naturschutzbehörde ist verloren gegangen. Der Artenschutz für die Feldlerche steht über allem. Wir verplempern unsere Potenziale für Maßnahmen an den wirklichen Hotspots der Biodiversität für Ackerbrachen und angesäte Blühstreifen.
Wir müssen mit unseren begrenzten Ressourcen im Naturschutz effektiv umgehen! 60.000 € für 3 Zauneidechsen, davon ein Großteil für Gutachten, Fangen, Umsiedeln …, nur wegen des völlig übertriebenen Individuenschutzes. Mit der Hälfte des Geldes könnten wir ganze Populationen aufbauen und stärken!
Deshalb ist Habecks Ansatz im Wind-an-Land-Gesetz mit den Artenhilfsprogrammen richtig: Wir müssen wieder proaktiven Naturschutz betreiben, statt uns nur als Reparaturbetrieb zu verwalten. Viele Ausgleichsmaßnahmen sind ineffektiv (und viele werden gar nicht umgesetzt, s.u.). Nehmt das Geld von den Eingreifern und baut ein schlagfertiges Naturschutzmanagement auf (Basis z.B. Landschaftspflegeverbände)! Wir können mit dem Geld und den Flächen viel mehr Sinnvolles machen als dieser unsägliche Individuenschutz!
Und wir verplempern Fachwissen, Geld und Flächen für Banalitäten. Die Feldlerche ist wieder ein gutes Beispiel; ökologische Zeigerfunktion unbedeutend (Sommergetreide gut, Wintergetreide schlecht ? Ökologie? Hecke schlecht, Offenland gut). Als sich die offenen Ranken in der Fränkischen Alb Ende des 19 Jh. zu Schlehenhecken entwickelt haben, ist die Feldlerchenpopulation massiv zurückgegangen. Heute freuen wir uns dafür an einer enormen Dichte an Neuntötern und Dorngrasmücken. Hat die Ökologie hier Schaden genommen?
Wie weit sich die Naturschutzverwaltung vom nachhaltigen Denken und der ganzheitlichen Betrachtung des Naturhaushalts entfernt hat, zeigt folgendes Beispiel: Wir haben eine anerkannte Ausgleichsfläche, bei der in einer ackerbaulich geprägten Flussaue extensives Grünland entwickelt werden soll. Nun soll diese Fläche gleichzeitig als Ausgleich für ein Feldlerchenbrutrevier dienen. Da die Bodenzahl zu hoch ist, wird dies nicht anerkannt. Aber stattdessen könnten wir doch eine Ackerbrache machen, diese würde anerkannt. Aus Naturschutzgründen Ackerbrache statt Grünland im Überschwemmungsgebiet. Ein gutgemeinter Vorschlag, aber ökologisch sinnvoll? Dabei würde die Feldlerche ohnehin vermutlich weniger auf der Grünlandfläche selbst brüten, sondern eher im Grenzstreifen zwischen neuem Grünland und Acker.
Diese Grenzlinien sind für die Feldlerche wichtig. Unser Büro hat viele Jahre erfolgreich mit 3-5 m breiten Grünlandstreifen (und damit relativ kleinen Flächen) Feldlerchenpopulationen in Verfahren der Flurneuordnung stabilisiert. Hierfür sogar 2022 einen Bayerischen Staatspreis erhalten. Und jetzt ist das mit einem neuen Leitfaden zur Feldlerche alles falsch und wird nicht mehr anerkannt.
Der Artenschutz hat seine Berechtigung, wenn es um seltene extreme Spezialisten geht, da ist sogar der Individuenschutz sinnvoll (Seeadler, Steinkauz …). Aber wie in dem Artikel dargelegt, ist er zum Individuenschutz selbst für häufige Arten degeneriert. Zum Schaden des Naturschutzes.
Und zum angesprochenen ganzheitlichen Denken: der Klimawandel ist weltweit die größte Gefahr für die Biodiversität. Und bei uns ist der größte Bremser beim Ausbau erneuerbarer Energien der Naturschutz. Während die fantastischen Ökosysteme der Korallenriffe weltweit vor dem Absterben stehen, bremst die Naturschutzverwaltung in Bayern den Ausbau der Erneuerbaren, weil es keine einzige Feldlerche weniger geben darf. Wieder ein Treppenwitz der Geschichte.
Was wir derzeit im Naturschutz machen, ist vergleichbar mit einem Arzt, zu dem ein Patient kommt mit Schlaganfall und Fußpilz: Und der Arzt behandelt erst mal den Fußpilz.
Und nun zum Thema Bürokratisierung mit den auch fachlich teils negativen Folgen.
In Bayern gibt es seit 1999 die Eingriffsregelung. Hierzu gab es einen guten Leitfaden, dem eine Matrix aus 2 Kategorien der Eingriffsschwere und 3 Kategorien der Wertigkeit der betroffenen Fläche zugrunde lag. Hieraus ergaben sich Ausgleichsfaktoren von 0,2 bis zu 3,0. Die Anrechnung der Ausgleichsfläche war auch in Faktoren möglich, Regelfall 1,0 bei Aufwertung um eine der 3 Wertstufen. Man kam schnell zum Ziel, die Anwendung war flexibel und konnte auf jede Situation individuell reagieren.
Die Probleme mit der Eingriffsregelung sind auch seit langem bekannt: Teils mehr als die Hälfte der Ausgleichsflächen wird gar nicht hergestellt, von den übrigen ein großer Teil nicht vollständig oder nicht richtig. Abhilfe könnte eine einfache Prüfpflicht alle paar Jahre bringen, eine kurze Begehung, 1 Seite Formblatt v.a. mit Hinweisen zu evtl. notwendigen Maßnahmen würde genügen. Das war der bekannte dringende Handlungsbedarf, zumindest wenn man in der Sache etwas voranbringen wollte.
Doch stattdessen haben zahlreche Experten der bayerischen Naturschutzverwaltung über Jahre an einem neuen System zur Eingriffs-Ausgleichsbewertung gearbeitet, der Kompensationsverordnung. Ein kompliziertes, auf vegetationskundlichen Einheiten beruhendes starres Punktesystem, ein bürokratisches Monster im Vergleich zu der bisherigen, einfachen, zielorientierten und individuell flexiblen Methode.
Drei Erlebnisse mit der Kompensationsverordnung innerhalb von 2 Wochen des letzten Jahres Beispiel 1Wir haben eine schöne große Ausgleichsfläche, Ziel artenreiches Extensivgrünland, Waldrand grenzt an. Vorschlag: 10 m entlang des Waldrands nur alle 2-3 Jahre mähen, jeweils wechselnd die Hälfte der Fläche. Gut für zahlreiche Insekten, Kleingetier etc.
Naturschutzbehörde: Waldrand ist nordexponiert, das ergibt nur eine artenarme Hochstaudenflur, kein artenreiches Extensivgrünland, also weniger Punkte gem. Kompensationsverordnung.
Na gut, dann mähen wir halt bis zum Waldrand hin.
Exkurs: Nordexponiert und Naturschutz:
In Ost-West-orientierten Trockentälern der Fränkischen Alb sind an extrem heißen Tagen die Grillen alle auf dem Nordhang! Wir wissen inzwischen, dass für den massiven Rückgang der Insektenpopulation auch Klimaextreme verantwortlich sind. Was passiert wohl mit vielen Insekten/-larven bei extremer Dürre in monatelang ausgedörrten Wiesen? Da ist ein beschatteter Streifen am Waldrand vielleicht die letzte Überlebensinsel. Das ist ökologisch gedacht und nicht „ökologisch wertvoll ist nur ein südexponierter Saum“.
Beispiel 2:Ein Gewerbetreibender hat neben dem geplanten Gewerbegrundstück von dem Eigentümer auch noch 5.000 qm Wald abkaufen müssen. Alter hiebreifer, 80-100-jähriger Buchen und Edellaubbestand am Hang an einem steilen Kerbtal. Tolle Fläche. Er hat einen Waldbauern als interessierten Käufer, würde die Fläche aber gerne als Ausgleichsfläche verwenden. Wir sagen: da geht nur völliger Nutzungsverzicht als Aufwertung ? Alt- und totholzreicher Naturwald! Gibt wohl kaum was Nachhaltigeres und Ökologischeres. Natur pur, Null Energieaufwand … Naturschutzbehörde: 80-jähriger Laubwald hat schon höchste Punktzahl gem. Kompensationsverordnung, Aufwertung nicht möglich. Unser Argument, Laubbäume werden mit 200-300 Jahren erst richtig wertvoll, zählt leider nicht. Vermutlich wird der Wald verkauft und bald abgeholzt.
Beispiel 3Ein anderer Unternehmer hat seine Grundstücke, darunter einen Kalkscherbenacker vor gut 15 Jahren ins Kulturlandschaftsprogramm gegeben und in Grünland umgewandelt. Wurde inzwischen als geschütztes artenreiches Grünland biotopkartiert. Kein Problem: Rückumwandlungsklausel gem. Naturschutzgesetz bei freiwilligen Naturschutzfördermaßnahmen wurde bestätigt. Wir wollten auf die zulässige Rückumwandlung zu Acker natürlich verzichten und die Fläche so wie sie ist als Ausgleichsfläche der Erweiterung des Gewerbegebiets zuordnen. Naturschutzbehörde: geht nicht, es zählt der aktuelle Zustand der Fläche (? nicht aufwertbar), nicht ein hypothetisch möglicher.
Ergebnis: ein Jahr Verzögerung für den Unternehmer, die Fläche wurde umgebrochen, nun kann sie anerkannt werden mit Neueinsaat.
Und so etwas erleben wir ständig. Die Denke der Kompensationsverordnung, die Natur ließe sich in ein starres Punkteschema pressen, ist das Gegenteil von Ökologie. Früher konnten wir mit Sachverstand gute Lösungen erarbeiten, jetzt wird nur nach Punkten geschaut, ob es Sinn macht oder nicht. Gerade wir Ökologen, die wissen, wie komplex die Natur und wie einzigartig jede einzelne Situation in der Landschaft ist, sollten auf den Sachverstand gut ausgebildeter Planer und Fachleute in Naturschutzbehörden mehr vertrauen als auf ein starres Punktesystem. Inzwischen hören wir auch von Behördenmitarbeitern immer öfter: „es wird nicht geschaut was sinnvoll ist, es wird nur geschaut, was bringt die meisten Punkte“.
Insofern bin ich gespannt, welche Vorschläge Ihre Autoren zur Reform der Naturschutzverwaltung einbringen werden. Der Handlungsbedarf ist enorm. Nicht bei Vorschriften und Verordnungen, sondern beim Umsetzen bekannter Zusammenhänge in die Praxis und bei der wieder dringend nötigen Konzentration auf ganzheitliches ökologisches Denken.
von Guido Bauernschmitt, Am Brücklein 9, 91207 Lauf a.d.PegnitzAnmerkungen zu Teil 1 des Beitrages „Für eine zukunftsfähige Naturschutzverwaltung im 21. Jahrhundert“ in der Ausgabe 5/2024 von Naturschutz und Landschaftsplanung
Eine systematische Analyse von Grundproblemen im Naturschutzhandeln der Naturschutzbehörden ist nach Ablauf eines Viertels des 21. Jahrhunderts ein ehrenwertes Unterfangen. Dass die 15 Autoren aus Forschung und Lehre mit Naturschutzbehörden, wie sie erwähnen, langjährig und umfassend zusammenarbeiten, lässt sich denken. Gleichwohl sind die Innenansichten begrenzt, wenn man nicht selbst in einer solchen Behörde verortet ist. Dieser Umstand muss den Wert des Beitrages nicht schmälern, zumal für eine Problemanalyse und -behandlung der Blick von außen unverzichtbar sein kann. Zudem wird kaum ein Mitarbeiter einer Naturschutzverwaltung die von den Autoren ausgemachten altbekannten Probleme wie Arbeitsüberlastung, bürokratische Hürden, finanzielle Grenzen u.a.m. nicht als hinderlich bewerten. Schwerwiegende andere Ursachen für die Erfolgsschwäche des Verwaltungshandelns im Naturschutz werden allerdings nicht thematisiert.
Ein Beispiel ist die Zurückhaltung, für die Verwirklichung der Naturschutzziele den Anspruch des Artikels 14 des Grundgesetzes ins Feld zu führen. Mit der Durchsetzung der Sozialbindung des Eigentums könnte zumal in Schutzgebieten, ohne in jedem Fall Entschädigungsansprüche auszulösen, die Lage des Naturschutzes deutlich verbessert werden. Dass dies nicht geschieht, wird man kaum den Personen in den Naturschutzbehörden anlasten können, sondern der Mangel hat „System“ und basiert auf „höherer Gewalt“. Der Verweis darauf sollte nicht schon als ein „Verrechtlichen“ oder „konfrontatives Agieren“ kritisiert werden.
Ein anderes Beispiel ist die Lage auf dem Grundstücksmarkt. Die mit Wind- und Solarparks erzielbaren Pachteinnahmen schlagen den Naturschutz aus dem Feld. Die im Beitrag offenbar als alternativlos bewertete Transformation der Energiewirtschaft zerstört eben nicht nur unmittelbar Natur und Landschaft, sondern entzieht dem Naturschutz buchstäblich den Boden, jedenfalls sofern man – anders als vielleicht die Autoren – beispielsweise in „Biodiversitäts-Solarparks“ keinen durchgreifenden Vorteil für die Sache des Naturschutzes zu erkennen vermag. Der voraussichtlich sehr gering dotierte Etat für „Nationale Artenhilfsprogramme“, gespeist aus der „Lizenz zum Töten“ und Mitteln zur Minderung anderer Kollateralschäden der „Transformation“, darf erst gar nicht für einen Flächenkauf genutzt werden, sodass man sich fragt, wo und wie die Mittel überhaupt sinnvoll eingesetzt werden könnten. Zwar wird im Beitrag der Widerspruch zwischen Wirklichkeit und „ambitionierten“ Zielen beklagt; dass etwas mit den Zielen nicht stimmen könnte, schließen die Autoren aber offenbar aus, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
Anstatt in der Art und Weise der „notwendigen Transformation“ zumindest einen Korrekturbedarf zu erkennen, beklagen die Autoren – greifen wir einige der wörtlichen Zuschreibungen heraus – Scheuklappen, mangelnde Kommunikationsfähigkeit, unflexible Haltungen, fehlendes innovatives Verhalten, ein Festhalten an Vorschriften, eine zu enge Auslegung derselben, konfrontatives Agieren und kompromissloses Verfechten – in den Naturschutzbehörden! Dort werde „nicht oder nur selten an den notwendigen großen Schrauben (mit)gedreht“. Dazu rechnen die Autoren beispielsweise die Entwicklung von Agroforstsystemen oder Biodiversitäts-Solarparks. Den Naturschutzbehörden fehle es an Visionen. Der Artenschutz würde übertrieben, sei Spielwiese und Fluchtpunkt; er pervertiere zum Individuenschutz. Wie überhaupt die Autoren eine Fokussierung auf einen aussichtslosen Arten- und Biotopschutz auszumachen meinen. Hier gerät der Beitrag bedauerlicherweise zum Rundumschlag und das gezeichnete Bild zum Zerrbild. Vor dem Diskreditieren des Artenschutzes hätte beispielsweise die Durchsicht der Studie „Verlustursachen beim Rotmilan in Brandenburg im Laufe der letzten drei Jahrzehnte“ (Langgemach et al. 2023, Die Vogelwelt Band 141: 157-177) bewahren können. Oder sind die dramatischen Verluste an Windenergieanlagen bei einer Art, für die Deutschland ausnahmsweise eine internationale Verantwortung trägt, nur Petitessen, weil man an den „notwendigen großen Schrauben“ zu drehen meint?
Ein anderes für den Erfolg des Naturschutzes wichtiges Feld lassen die Autoren gänzlich unbearbeitet: Das Verhältnis von Naturschutzbehörden und -vereinigungen und hier das Potenzial einer Aufgabenteilung, rollenverteilten Zusammenarbeit und überfälligen Strategiediskussion. Hier läuft einiges verkehrt, sollte die finanzielle und politische Unabhängigkeit von Naturschutzvereinigungen infrage stehen und sich diese als die für Politik und Wirtschaft bequemeren Akteure erweisen. Das ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr, der auch Hochschulen nicht erliegen sollten. Wenn beispielsweise staatliche Stellen Gutachten von Dritten der Expertise der eigenen Naturschutzverwaltung vorziehen, muss dies nicht gegen die Naturschutzbehörde sprechen. Den Auftragnehmern sollte klar sein, dass es ums Dienen geht, nicht ums Dienern.
Die Autoren verkennen möglicherweise, dass der Naturschutz eher nicht an falschen oder weniger guten Argumenten scheitert, sondern in der von der Politik kontrollierten Verwaltung aus „übergeordneten Interessen“ anders entschieden wird, in der Hauptsache wegen der Dominanz des Marktes, der Freiheit ohne Verantwortung und des Eigentums ohne Sozialbindung. Das wird künftig noch mehr ohne eine qualifizierte Güterabwägung und dank der Beschleunigungsgesetzgebung zugunsten der „notwendigen Transformation“ ohne eine angemessene Sachverhaltsermittlung und eine darauf aufbauende Folgenabschätzung und -bewältigung geschehen. Eine aktuellere und fundiertere Landschaftsplanung wird diese Misere nur bedingt einhegen können. Welche Gebiete von Natur und Landschaft aus welchen Gründen geschützt gehören (oder es beispielsweise als Landschaftsschutzgebiete sind oder kürzlich noch waren), ist ja nirgends ein Geheimnis. Es zeichnet sich aber ab, dass künftig kaum mehr als die Natura 2000-Gebiete noch verteidigungsfähig sind.
An einer anderen Stelle der Analyse mag man den Autoren zustimmen: In der Naturschutzverwaltung herrsche Unzufriedenheit. Aber war das jemals anders? Und, falls sie heute größer sein sollte als früher, ist dies nicht eine Folge der Naturschutzvergessenheit, mit der im Namen „des Klimaschutzes“ oder „der Rettung des Planenten“, zudem ohne eine kritische Berichterstattung, Naturschutz und Landschaftspflege rechtlich systematisch entkernt werden? Kann es sein, dass in dem Beitrag diese Entwicklung marginalisiert oder sie im Falle des Artenschutzrechts gar den Naturschutzbehörden angelastet oder insgeheim für gut befunden wird? Dann würde es nicht überraschen, wenn der notwendige Praxisbezug in der Naturschutzausbildung fehlen sollte.
Eine vielleicht tröstliche Perspektive bleibt: Die Mehrzahl der im Beitrag genannten Probleme sind keineswegs neu, auch nicht ausschließlich naturschutzspezifisch, sondern sie gelten mit ähnlichen Auswirkungen auch für andere in Rang und Dringlichkeit vergleichbare öffentliche Aufgaben wie beispielsweise das Gesundheitswesen oder die Altenpflege mit denselben im Beitrag genannten Auswirkungen für die dort Beschäftigten, nämlich schlechtes Arbeitsklima, mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten, teilweise nicht adäquate Entlohnung und letztlich Unzufriedenheit der Mitarbeiter. Und hier zeigt sich im Beitrag der Autoren eine bemerkenswerte Parallele: Hier wie dort wird das „herausragende Engagement der Mitarbeitenden“ ausdrücklich anerkannt. Mit einem Unterschied: Anders als den Mitarbeitern im Gesundheitswesen wird den Mitarbeitern in den Naturschutzbehörden eine ungerechtfertigt große Mitverantwortung am Zustandekommen der Probleme zugerechnet.
von Wilhelm Breuer, HannoverEinige Leserzuschriften zur Mai-Ausgabe erwecken den Eindruck, die Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm werde ihr umfassendes Angebot an Workshops, Klausuren, Tagungen oder Fortbildungen zu Fragen des nationalen und internationalen Naturschutzes nicht in gewohnter Form fortführen. Das Gegenteil ist der Fall: Bewährtes bleibt und neue Formate kommen hinzu. Allein 2024 bietet die INA rund 60 Veranstaltungen an – von Klaus-Töpfer-Fellowship über Workshops zur Weiterentwicklung internationaler Konventionen bis hin zu innovativen Tagungen zu Digitalformaten. Das Team der Akademie führt dabei eigene Veranstaltungen durch und unterstützt andere Facheinheiten des Bundesamtes für Naturschutz sowie externe Partner*innen bei der Durchführung.
Eine Auswahl an Fortbildungen:
- Klaus-Töpfer-Fellowship
- Hochschulkurs Agrarmanagement und Biodiversität
- 47th International Postgraduate Course on Environmental Management for developing Countries
- International Climate Protection Fellowship Alexander von Humboldt Foundation
- Fortbildung Biodiversität in der Entwicklungszusammenarbeit: „Biodiversity conservation for human wellbeing“ und „Sustainable biodiversity financing - concepts and solutions”
Internationale Expertentreffen:
- Analysis of user perspectives on the CBD multilateral mechanism for benefit-sharing from the use of Digital Sequence Information (DSI) on genetic resources
- European expert meeting in preparation of SBSTTA-26 of the CBD
- European expert meeting in preparation of IPBES 11
- UNESCO beech WHS-preparation of multi annual strategy
- BioClimSocial Project - Peer exchange workshop on the Social Dimension of Nature-based Solutions (NbS)
Nationale Tagungen & Workshops:
- NaturschutzDigital 2024 - Modellierung im Naturschutz
- 23. Vilmer Sommerakademie - Nebenthema oder zentraler Baustein? Die Rolle des Naturschutzes in der und für die sozial-ökologische Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft
- Tagungsreihe Naturschutz und Landwirtschaft im Dialog: „Biodiversität in der landwirtschaftlichen Berufsausbildung“
- Erleben von Natur und Landschaft als Aufgabe der Landschaftsplanung
- Wildnis im Dialog
Aktuelle Veranstaltungen finden Sie hier: https://www.bfn.de/veranstaltungen-ina
von Bundesamt für NaturschutzLeserzuschrift zu Teil 1 und 2 des Beitrages „Für eine zukunftsfähige Naturschutzverwaltung im 21. Jahrhundert“ in der Ausgabe 5 und 6/2024 von Naturschutz und Landschaftsplanung
Sehr geehrter Herr Prof. Jedicke, liebe Ulrike Pröbstl,
es ist inzwischen zwar schon 1 bzw. gut 2 Monate her, dass ihr Beitrag zum Thema "Naturschutzverwaltung" – Standortbestimmung und Notwendigkeiten für eine zukunftsfähige Naturschutzverwaltung im 21. Jahrhundert - in der Fachzeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung erschienen ist, aber bei mir gehen als Ruheständler inzwischen die Uhren etwas langsamer.
Gestatten Sie mir deswegen trotzdem, dass ich Ihnen eine kurze Rückmeldung zu diesem Fachbeitrag gebe; schließlich kennen und schätzen Ulrike Pröbstl und ich uns inzwischen bereits seit Jahrzehnten, und beide können wir inzwischen auf eine entsprechend lange Berufserfahrung zurückblicken, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Wirkungsbereichen und Blickwinkeln heraus. Es ist mir von daher ein gewisses Bedürfnis, Ihnen kurz mitzuteilen, wie ich die Situation um unseren Berufsstand und dessen gesellschaftspolitischen Wirk- und Einflussmöglichkeiten sowie die dafür politisch-administrativ gesetzten Rahmenbedingungen einschätze.
Zunächst einmal darf ich Ihnen sagen, dass Sie mir quasi sehr aus dem Herzen sprechen und ich ihre Einschätzung und Bewertung, was die Grundprobleme der Naturschutzverwaltung im ersten Beitragsteil angeht, teile und aus meiner knapp 40-jährigen Tätigkeit (1985-2024) an einer oberbayerischen Naturschutzbehörde (am Landratsamt) leider nur bestätigen kann. Wir haben als staatliche Naturschutzverwaltung in den zurückliegenden Jahren zwar nicht Nichts erreicht, aber ganz überwiegend zu wenig, gemessen an dem, was für eine nachhaltige Gesundung unserer Ökosysteme bzw. von Natur und Landschaft in ihrer Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit notwendig wäre. Ich hatte und habe nach wie vor oft den Eindruck, die grundlegenden Zusammenhänge, das hochkomplexe Wirkungsgeschehen mit seinen wechselseitigen Abhängigkeiten als biodiverses Netzwerk und die sich daraus ergebenden dringenden Handlungsnotwendigkeiten sind in unserer Gesellschaft und insbesondere auch bei den politisch Verantwortlichen in der breiten Masse nach wie vor nicht bekannt und im Bewusstsein nicht angekommen. Zumindest ist das mein persönliches Resümee. Wir arbeiteten und tun dies nach wie vor zu oft – wie man so schön sagt – gegen Windmühlen und haben in der staatlichen wie kommunalen Verwaltung nicht die notwendige Unterstützung. Wenn es hart auf hart geht, fehlt es leider zu oft auch am notwendigen konsequenten Handeln und v.a. am entsprechenden Vollzug getroffener Verwaltungsentscheidungen. Da gab und gibt es immer wieder zu viele Befindlichkeiten und "Rücksichtnahmen" auf Patikularinteressen und Lobbyisten.
Die im zweiten Teil des Beitrags aufgezeigten Lösungsansätze und Möglichkeiten, gegenzusteuern um die Situation zumindest mittel- bis längerfristig nachhaltig zu verbessern, finde ich gut und richtig. Sie sollten innerhalb der Naturschutzverwaltung zumindest als überlegenswert ernsthaft und intensiv zeitnah diskutiert werden. Ich teile aber auch ihre Sorgen um den Stellenwert des Naturschutzes (obwohl bspw. in Bayern eine Aufgabe von Verfassungsrang!) und die Reaktionsfähigkeit der Gesellschaft auf die sich rasant ökologisch und klimatisch sich ändernden Rahmenbedingungen. Um so wichtiger erachte ich eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis mit ihren jeweiligen Fachverbänden und berufsständischen Interessensgruppen, aber auch mit den maßgeblichen Naturschutz- und Umweltverbänden. Nur im Schulterschluss ist m.E. da eine entspr. Wirkkraft zu erreichen. Und notwendig ist meiner Ansicht nach zusätzlich unbedingt auch, dass wir uns Verbündete im Bereich der Politik und in der Verwaltung suchen, denen wir vertrauen und auf die wir uns verlassen können, so wie das im Falle der leider vor kurzen erst verstorbenen Alois Glück und Josef Göppel in Bayern der Fall war.
Abschließend möchte ich Sie ermuntern, mit dem Thema – und weiteren wichtigen Belangen - am Ball zu bleiben, die Geschehnisse und die weitere Entwicklung im Bereich Naturschutz, Landschaftsplanung und Ökologie so überzeugend und kompetent wie bisher auch weiterhin fachlich-kritisch zu begleiten, sowie beratend dem in der praktischen Umsetzung in der Verantwortung stehenden Fach- wie Verwaltungspersonal zur Seite zu stehen. Dazu wünsche ich die notwendige Kraft, die erforderliche Begeisterung und Überzeugung für die Sache und die dazu gehörige Ausdauer.
Ich bin froh, NuL über die aktive Dienstzeit hinaus im Ruhestand weiterhin abonniert zu haben, und ich werde die aktuellen Fachthemen mit großem Interesse weiterverfolgen und versuchen, fachlich am Ball zu bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
von Matthias Hett
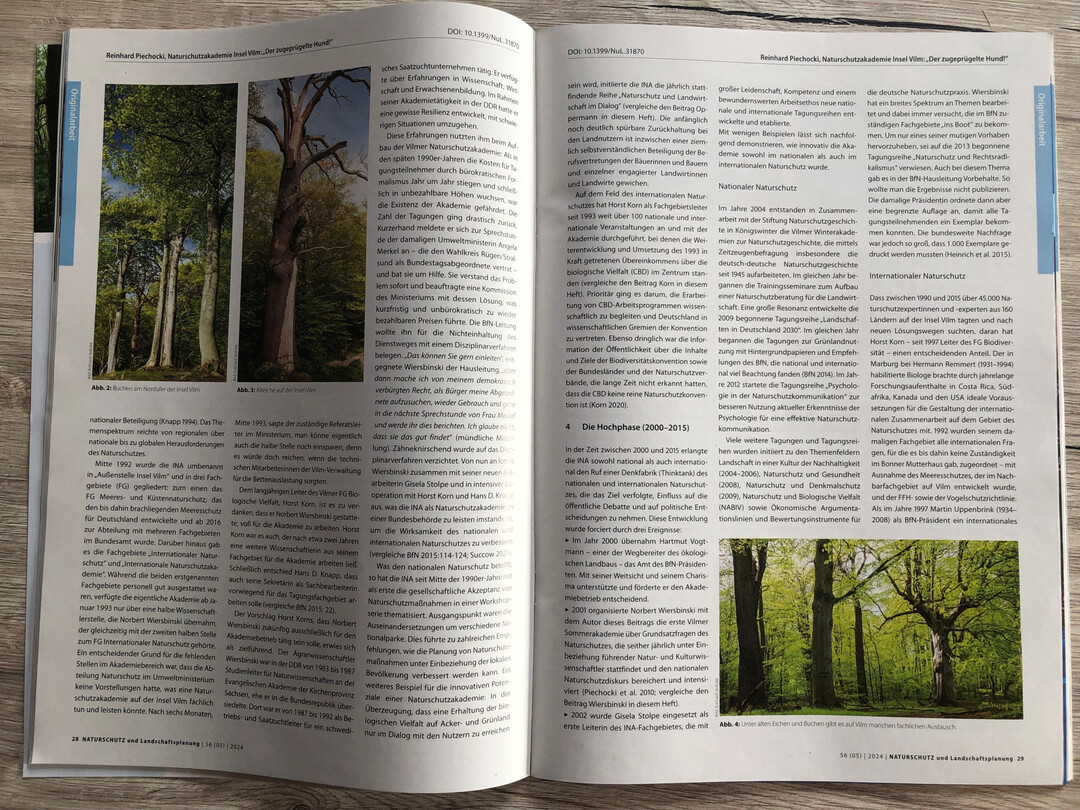

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.