Kenner der Herpetologie
- Veröffentlicht am
Es ist keine Lektüre, die man schnell nebenbei liest: „Amphibien und Reptilien in Bayern“ ist ein umfassendes Grundlagenwerk und umfasst knapp 800 Seiten. Am 14. November wird es im Verlag Eugen Ulmer erscheinen. Die Autoren Eberhard Andrä und Günter Hansbauer haben uns schon einmal einen kleinen Vorgeschmack geliefert. Sie sind Teil eines fünfköpfigen Bearbeiter-Gremiums, zu dem außerdem Otto Aßmann, Thomas Dürst und Dr. Andreas Zahn zählen. Gemeinsam mit ihnen haben 70 weitere Autoren an der Veröffentlichung mitgewirkt, die nun erschienen ist. Herausgeber des Grundlagenwerks sind der Landesverband für Amphibien- und Reptilienschutz in Bayern e.V. (LARS), das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU), der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) und der BUND Naturschutz (BN).
Redaktion: Amphibien und Reptilien haben nun ja recht unterschiedliche Lebensraumansprüche. Woher der Entschluss, beide Artengruppen gemeinsam in einem Buch vorzustellen?
Hansbauer: In der Wissenschaftshistorie hat man die beiden Klassen als Einheit betrachtet, weil man davon ausging, dass Eidechsen und Molche zur gleichen Klasse der Amphibien gehören. Erst später, Mitte des 19. Jahrhunderts, hat man die grundlegenden Unterschiede erkannt und die Reptilien als eigene Klasse definiert. Auch heute werden im Fachbereich der Herpetologie beide Klassen noch zusammen behandelt. Auch die übersichtliche Zahl der heimischen Arten rechtfertigt eine gemeinsame Bearbeitung.
Andrä: Der Landesverband für Amphibien- und Reptilienschutz in Bayern, kurz LARS, der das Atlas-Projekt initiiert hat und federführend für dessen Ausführung ist, hat die beiden Tierklassen deswegen in einem gemeinsamen Projekt behandelt, weil dies der gängigen Praxis entspricht und diese beiden Tiergruppen ja auch unter dem Begriff „Herpetologie“ zusammengefasst werden.
Im Buch wird die Geschichte der Herpetologie in Bayern untersucht. Welche Besonderheiten konnten Sie entdecken?
Andrä: Die Herpetologen, die am Ende der Renaissance und zu Beginn der Barockzeit gelebt haben, haben eine ganz tolle Pionierarbeit geleistet. Sie haben nach den Tieren im Feld gesucht und sie dann beschrieben. Der zweite Aspekt ist der, dass es nicht von ungefähr kommt, dass diese ersten Forschungen auf diesem Gebiet im Raum Nürnberg stattgefunden haben. Das ist geschichtlich bedingt: Nürnberg war freie Reichsstadt, und in den freien Handelsstädten blühte der Handel und Kultur und Kunst wurden gefördert. Das waren Zentren der Forschungen in der Zeit.
Hansbauer: Für mich war das Werk von dem Künstler und Naturforscher Rösel von Rosenhof eine Neuentdeckung. Ich kannte bislang nur seine Arbeiten über Insekten. 1758 hat er ein Werk geschrieben mit dem Titel „Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes“. Darin hat er seine ökologische Feldforschung zu Kröten und Fröschen ausführlich beschrieben und diese mit hervorragenden handkolorierten Kupferstichen dokumentiert. Er war seiner Zeit damit weit voraus. Sein Werk ist eine Sternstunde der Herpetologie.
Sie gehen umfangreich auf die Datenerfassung für Reptilien und Amphibien ein. Wo liegen jeweils die Schwierigkeiten?
Hansbauer: Wir haben beim Bayerischen Landesamt für Umwelt in den 80er-Jahren mit der systematischen Kartierung von Amphibien in Bayern begonnen: Zunächst haben wir vornehmlich die Gewässer kartiert, die in der topografischen Karte 1 : 25.000 enthalten waren. Der erste Kartierdurchgang der über 100.000 Stillgewässer hat knapp 20 Jahre gebraucht. In dieser Intensität können wir die Kartierungen aus Kostengründen allerdings nicht weiterführen. Bei der Wiederholung der Kartierung müssen wir uns weitgehend auf ausgewählte, vornehmlich die gefährdeten Arten beschränken.
Die Beobachtungen und Informationen, die uns Ehrenamtliche melden, sind dazu eine wertvolle Ergänzung. Diese werden aber meist nicht nach standardisierten Methoden erfasst, was die Bewertung zum Beispiel bezüglich der Populationsgröße oder der Bestandsentwicklung erschwert. Daher ist es schwierig, präzise Aussagen über die Entwicklung der häufiger vorkommenden Arten zu machen.
Amphibien werden in erster Linie an den Laichgewässern kartiert. Gerade Kleingewässer wie periodisch auftretende Pfützen sind jedoch schwer aufzufinden, eine vollständige Kartierung ist hier nicht möglich. Noch schwieriger ist es, Reptilien zu erfassen: Ihre Lebensräume sind vielfältiger, sie sind in allen Lebensstadien schwerer zu entdecken. Das heißt, wir brauchen mehr Begehungen pro Fläche und wir können nur Stichproben absuchen. Daher wissen wir nicht genau, wo deren Verbreitungsgrenzen sind und in welcher Dichte die Arten vorkommen. Es gibt noch viele offene Fragen.
Haben Sie unter den in Bayern vorkommenden Arten eine Lieblingsart?
Andrä: Ja, und zwar die Wechselkröte, ein unwahrscheinlich faszinierendes Tier, an sich eine Steppen- und Wüstenart. Ich hatte Gelegenheit, an dieser Art an ihrem höchstgelegenen Standort in Mitteleuropa nördlich der Alpen Langzeit-Forschung zu betreiben. Inzwischen gibt es erste mitochondrische Untersuchungen, die belegen, dass diese Wechselkröten auf dieser Alm genau wie die Wechselkröten in Tirol italienischer Abstimmung sind. Die sind höchstwahrscheinlich über den Brenner nach Österreich und dann von dort auf die Almen marschiert. Also etwas ganz Phänomenales.
Hansbauer: Ich habe sogar zwei Lieblinge. Unter den Reptilien ist das die Kreuzotter, mit der beschäftige ich mich schon sehr lange. Sie hat mich vom ersten Anblick an fasziniert, ich finde sie einfach wunderschön. Meine zweite Lieblingsart ist der Alpensalamander. Ihn kenne ich von Kindesbeinen an, da ich in den bayerischen Alpen aufgewachsen bin. Er ist ein echter Überlebenskünstler, denn er ist nicht auf Gewässer angewiesen und besiedelt Höhen von über 2.000 Metern. Dort überlebt bei uns sonst kein anderes Amphib.
Ein Kapitel widmet sich auch der Gefährdung der Arten. Worin liegt diese begründet?
Andrä: Das ist ein riesiges Kaleidoskop der Gefährdungen. Das Gravierendste sind eigentlich die Landwirtschaft und der Flächenverbrauch. Das Zubetonieren von Flächen. Durch Straßen- und Autobahnbau werden die vorhandenen Lebensräume zerstückelt. Der Lebensraumverlust ist letztlich das Allerschlimmste. Diese Faktoren haben bedingt, dass die meisten der Amphibienarten auf der Roten Liste stehen, und viele von ihnen, darunter auch die Wechselkröte, vom Aussterben bedroht sind.
Hansbauer: Hinzu kommt, dass sich die bestehenden Lebensräume im Vergleich zu früheren Jahren verschlechtert haben. Die Äcker und Grünlandflächen sind für die Amphibien bei der heutigen Bewirtschaftung nicht mehr besiedelbar, weil sie intensiver gedüngt und mit Pestiziden behandelt werden und ungenutzte Raine weitgehend fehlen. Zudem haben Amphibien und Reptilien beim Einsatz moderner Mähmaschinen kaum eine Überlebenschance. Ähnlich ist es mit den Gewässern: Wenn sie intensiv fischereiwirtschaftlich genutzt werden, können sich die meisten Amphibienarten dort nicht mehr reproduzieren. In den für Amphibien und Reptilien lebenswichtigen Auen fehlt die Überflutungsdynamik, an die viele Pionierarten angepasst sind. Die sind heute auf Ersatzstandorte angewiesen.
Sie geben auch einen Überblick über Schutzmöglichkeiten in der Landschaft. Was erscheint Ihnen besonders erfolgversprechend?
Andrä: Die Schutzmöglichkeiten liegen im Bemühen, Vernetzungsstrukturen in der Landschaft zu erstellen. Populationen von Amphibien und Reptilien haben die Tendenz, bei Verinselung durch Inzucht zu zerbrechen. Diese Vernetzungsstrukturen sind unbedingt wichtig, um den Genaustausch zu gewährleisten. Und diese Strukturen müssen geschaffen werden.
Hansbauer: Gezielte Artenhilfsprojekte können helfen, den Rückgang stark gefährdeter Arten einzudämmen. Auch in Kooperationsprojekten von Flächennutzern und Artenschützern können vielversprechende Ansätze zur Zusammenarbeit und zum Erhalt der Lebensräume für Amphibien und Reptilien entstehen. Wichtig ist es, die Landnutzer in der Umsetzung miteinzubeziehen. Sind sie ausreichend informiert und aufgeklärt, dann gelingt es auch in der Praxis, neue Lebensräume zu schaffen oder bestehende zu erhalten.
Andrä: Es gibt verschiedene Schutzprogramme, aber es hapert ganz enorm an der Umsetzung. Ein Problem ist aber auch, dass, wenn es zur Ausführung kommt, die Anlagen, beispielsweise Amphibientunnel, sich selbst überlassen werden. Es gibt hinterher keine Effizienzkontrolle.
Müssen sich für den Erfolg der Schutzbemühungen auch die rechtlichen Grundlagen ändern?
Hansbauer: Bayern hat bei der Novellierung des bayerischen Naturschutzgesetzes im Juli dieses Jahres unter anderem festgelegt, dass Gewässerrandstreifen verpflichtend sind und dass 15 Prozent der Flächen für den Biotopverbund zur Verfügung gestellt werden sollen, und zwar in einem klaren zeitlichen Rahmen. Das ist ein Fortschritt, der auch den Lebensraum für Amphibien und Reptilien verbessern könnte.
Wer soll von diesem Buch profitieren?
Andrä: Wir sind davon ausgegangen, dass wir unbedingt ein Werk für Praktiker schreiben wollen, für Leute, die effektiv mit so etwas zu tun haben. Wir haben absichtlich darauf verzichtet, hier Wissenschaftlichkeit zu dokumentieren. Wir haben das konzipiert für die Sachbearbeiter der Oberen und Unteren Naturschutzbehörden, also die Regierung, und die Landratsämter. Und dann eben auch für interessierte Laien. Wir haben deshalb auch einen Begriffsbestimmungsteil im Buch, in dem Fremdwörter nachgeschlagen werden können. Außerdem haben wir ein Kapitel mit Praxisbeispielen, wie man solche Sachen mustergültig machen kann. Und das ist etwas, das kein anderes Buch dieser Art in Deutschland hat. Das basiert auf den Erfahrungen von Wolfgang Völkl, einem begnadeten Herpetologen. Er hat den Anstoß für diese Praxisbeispiele gegeben.
Sie widmen dieses Buch Wolfgang Völkl, der das Erscheinen leider nicht mehr miterleben durfte. Wie sehr hat er Ihre Arbeit beeinflusst?
Andrä: Wolfgang Völkl war der Spezialist für die Kreuzotter schlechthin, ein unwahrscheinlich dynamischer Mensch. Er war ein enorm guter Kenner der Herpetofauna, vor allem der Reptilien. Er kannte sozusagen jede Kreuzotter in Bayern persönlich. Er hat unsere Arbeit außerordentlich beeinflusst. Er ist sozusagen Spiritus Rector des ganzen Werkes. Ohne ihn wäre das Buch nicht zustande gekommen. Sein Tod war ein enormer Schlag für uns.
Hansbauer: Herr Völkl war die eigentliche Triebfeder für das Projekt. Er hatte die grundlegende Idee, hat alle Partner zusammengebracht und auch selbst etliche Kapitel verfasst. Er war mir ein sehr guter Freund, mit dem ich viele Jahre intensiv zusammengearbeitet habe. Ich habe in dieser Zeit sehr viel von ihm lernen können.
Zehn Jahre Arbeit und fast 800 Seiten – würden Sie so ein Projekt noch einmal angehen?
Andrä: Nein! Das ist ja das Verrückte. Jetzt wüsste ich, wie es geht, und könnte alle Fehler vermeiden, die wir gemacht haben bei der Erstellung dieses Werks. Aber es ist ein irrsinniger Aufwand. Das kann man nur einmal im Leben machen. Wir haben wirklich gute Autoren und haben es geschafft, dass keiner abgesprungen ist. Wir vom Herausgebergremium sind immer drangeblieben und konnten letztlich wirklich kooperativ zusammenarbeiten.
Hansbauer: So ein zeitaufwendiges Projekt reicht ein Mal im Leben. Ich glaube, die Beteiligten sehen das ähnlich. Wir haben an die 80 Text- und Bildautoren in dem Atlas. Sie haben alle sehr gut mitgearbeitet.
Eberhard Andrä ist Quereinsteiger auf dem Gebiet der Herpetologie. Als gelernter Bankkaufmann und Jurist war er lange bei der Bundesbank angestellt. Sein Wissen über Amphibien und Reptilien hat er sich autodidaktisch erarbeitet.
Günter Hansbauer hat in Weihenstephan Landespflege studiert. Heute arbeitet er beim Bayerischen Landesamt für Umwelt und hat sich auf Herpetologie spezialisiert.
Buchhinweis: Andrä et al.: Amphibien und Reptilien in Bayern. 768 Seiten. 49,95 €. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. Erscheint voraussichtlich am 14. November.
Bestellen können Sie das Buch unter dem WebcodeNuL4028 .
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

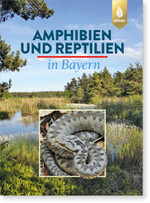
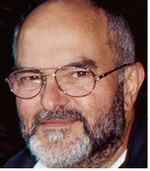

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.