Kulturlandschaften verstehen
Zwei Bücher zur Kulturlandschaft sind praktisch zeitgleich erschienen: Prof. Dr. Peter Poschlod, als Botaniker und Ökologe Inhaber des Lehrstuhls für Ökologie und Naturschutzbiologie an der Universität Regensburg, legt eine „Geschichte der Kulturlandschaft“ vor. Und Dr. Bruno P. Kremer, Wissenschaftsjournalist und Biologiedidaktiker an der Universität Köln, möchte mit dem Titel „Kulturlandschaften lesen“ dazu anleiten, vielfältige Lebensräume zu erkennen und verstehen. Damit wird schon deutlich, dass Inhalt und Ziele beider Bände unterschiedlich sind, wie sie verschiedener kaum sein können.
- Veröffentlicht am
Wie entstand unsere Kulturlandschaft? Peter Poschlod liefert eine beeindruckend detaillierte und minutiös mit Quellen ausgestattete Aufarbeitung der Mechanismen und Prozesse, die zur Entstehung der mitteleuropäischen Kulturlandschaft geführt haben. Fast 1600 Literaturzitate sind schon für sich gesehen ein Schatz für jeden, der noch tiefer in die Materie vordringen möchte. Doch das ist für den „normalen“ Leser zunächst einmal nicht notwendig, bietet das Buch doch einen enormen Fundus an Wissen, der sich durch ein sehr ausführliches Sachregister auch bei der Suche nach spezifischen Inhalten rasch erschließen lässt.
Das Buch ist neben Vorwort (drei Seiten), Einleitung (auf einer Seite) und Epilog (zwei Seiten) lediglich in zwei Hauptkapitel gegliedert: „Die Entstehung der Kulturlandschaft Mitteleuropas – Ursachen und Prozesse“ beschränkt sich auf Ursprünge der Domestikation und Sesshaftwerdung sowie die Sesshaftwerdung in Mitteleuropa. Behandelt wird hier die „Geburtsstunde“ unserer Kulturlandschaft – die Ursachen und Prozesse ihrer weiteren Entwicklung sind im zweiten, den mit Abstand dominierenden Kapitel abgehandelt: Als „Steuerungsfaktoren bei der Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaft Mitteleuropas“ werden (1) das Klima, (2) Krankheiten und Kriege, (3) Aufklärung, technischer Fortschritt und ökonomischer Wandel sowie (4) Geistesströmungen, Erlasse, Verordnungen und Gesetze beschrieben.
Man wünschte sich vielleicht noch ein zusätzliches synoptisches Kapitel, welches die Geschichte der Kulturlandschaft entlang einer Zeitleiste mit den zentralen Landschaftsmerkmalen chronologisch zusammenführt – als Überblick, um ein ganzheitliches Kulturlandschaftsbild in verschiedenen Zeitschnitten und die anthropogen gesteuerte Landschaftsdynamik zu vermitteln.
Mit Recht beklagt Poschlod, dass Naturschutz und Biodiversitätsforschung vielfach „ahistorisch“ vorgingen – ihm gebührt der Verdienst, mit seinem intensiven und interdisziplinär angelegten Quellenstudium und dem als Ergebnis vorgelegten Buch eine neue und leicht erschließbare Basis geschaffen zu haben, das zu ändern. So ist zu hoffen, dass in Leitbild-Diskussionen zur Entwicklung der Kulturlandschaft, gerade im Naturschutz, künftig stärker auf Basis seines Rückblicks fußen: Wo kommen die zu schützenden Arten, Lebensräume und Landschaftsqualitäten her? Aufgrund welcher Faktoren und Prozesse sind sie entstanden und unter welchen Voraussetzungen und aus welchen Gründen wollen/können wir sie erhalten (oder auch nicht)?
Vielfalt als Folge eines langen, über 7000 Jahre währenden stetigen Wandels – dieses folgert Poschlod in seinem Epilog als Unterschied Mitteleuropas zu anderen Kontinenten mit vergleichbaren Klimaten wie Nordamerika. Entsprechend müsste – und da freut sich der Rezensent, weil auch er das bereits vor 17 Jahren gefordert hat – der Prozessschutz nicht nur natürliche Prozesse, sondern auch „die Bewahrung und Entwicklung jener Landnutzungsprozesse einschließen, die zu unserer Arten- und Lebensraumvielfalt geführt haben“, mithin segregativer plus integrativer Prozessschutz. Dabei zeigt er erfreulich deutlich auf die Monotonisierung der Landnutzung und als deren Treiber auf die Agrarpolitik der EU als heute (über)mächtige Gegenspieler, die das Prinzip „Schutz durch Nutzung“ im Keim ersticken.
Der zweite angesprochene Buchtitel „Kulturlandschaften lesen“ von Bruno P. Kremer kann und muss mit Podschlods Werk nicht konkurrieren. Er ist stärker populärwissenschaftlich geschrieben und fokussiert – ganz anders gegliedert – auf typische Lebensräume. Kremer gibt unter der Überschrift „Lebensraum aus zweiter Hand“ auf 18 Seiten eine geraffte Einführung in die Kulturlandschaftsgeschichte, indem er den Landschaftswandel durch die Tätigkeit des Menschen skizziert und u.a. auch die zentrale Frage stellt: Welche Natur schützen wir? Im Mittelpunkt des Buches aber stehen Portraits von 19 Elementen der Kulturlandschaft – indes sehr unterschiedlicher Größenordnung: Bäume im Bild der Siedlungen, dörfliche und städtische Wildkrautfluren, bäuerliche Gärten, Friedhöfe und Parkanlagen, Mauer, Dächer und Ruinen, Dorfteiche und andere Kleingewässer, Streuobstwiesen, Säume und Wegränder, Wiesen und Trockenrasen, Auengrünland und Hochstaudenfluren, Kopfbäume, Dämme, Deiche und Gleisanlagen, Hecken, Raine und Flurgehölze, Heiden und Waldweiden, Brachland und Industrieflächen, Niederwälder und Schlagfluren, Kiesgruben und Steinbrüche, alpine Kulturlandschaft, Kulturlandschaft Küste.
Diese Aufzählung macht deutlich, dass – mit Ausnahme der beiden letzten Abschnitte – weniger Kulturlandschaften insgesamt, sondern stärker einzelne Elemente daraus betrachtet werden. Didaktisch gut werden die Lebensraum-Kapitel jeweils mit einem Biotopfoto, einem Artenfoto und Kurzsteckbrief (als „Ökoprofil“ bezeichnet) eingeleitet. Im Inhalt werden vor allem die Standorte und charakteristische Arten sowie die Nutzungsabhängigkeit beschrieben, mit schönen Fotos und Skizzen illustriert. Das ist nicht falsch, doch ein „Lesen“ der Kulturlandschaft wäre mehr. So wäre der Titel „Lebensräume der Kulturlandschaft“ treffender für den Buchinhalt und ehrlicher gewesen.
Zwei Neuerscheinungen zur Kulturlandschaft also, die außer dem Thema „Kulturlandschaft“ im Titel kaum etwas gemein haben. Poschlods „Geschichte der Kulturlandschaft“ ist ohne Frage eine reiche Fundgrube und ein unentbehrliches Standardwerk für jeden, der sich mit anthropogen beeinflussten Landschaften, Naturschutz-Maßnahmen und Landschaftsplanung in weitestem Sinne beschäftigt. Kremers Buch dagegen liefert eine leicht lesbare und gut gemachte Einführung in verschiedene Strukturen und Lebensräume in Kulturlandschaften – aber zum dringend zu fördernden „Verstehen“ ganzer Kulturlandschaften reicht es allein leider noch nicht. Da hilft das erstgenannte Werk erheblich mehr, auch wenn zugegeben die Zielgruppen etwas unterschiedlich sein mögen.Eckhard Jedicke
Geschichte der Kulturlandschaft. Entstehungsursachen und Steuerungsfaktoren der Entwicklung der Kulturlandschaft, Lebensraum- und Artenvielfalt in Mitteleuropa. Von Peter Poschlod. 320 Seiten mit 199 farbigen Abbildungen und 38 Tabellen. Gebunden. 39,90€. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2015. ISBN 978-3-8001-7983-1.
Kulturlandschaften lesen. Vielfältige Lebensräume erkennen und verstehen. Von Bruno P. Kremer. 223 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen. Gebunden. 29,90€. Haupt Verlag, Bern 2015. ISBN 978-3-258-07938-7.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

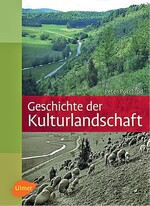
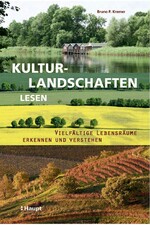
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.