Die Waldschnepfe ist „windkraftsensibel“ und artenschutzrechtlich relevant
Abstracts
In Dorka et al. (2014) haben wir Methoden und Ergebnisse unserer Untersuchung mittels Synchronzählung zum Einfluss eines Windparks im Nordschwarzwald auf die Waldschnepfe (Scolopax rusticola) vorgestellt und sind auf Aspekte des Artenschutzes und der Umwelthaftung eingegangen. Schmal (2015, in dieser Ausgabe) diskutiert unsere Untersuchung und unsere Schlussfolgerungen. Sie kritisiert verschiedene Aspekte, stellt einige Fragen und führt alternative Erklärungsversuche für den hochsignifikanten Rückgang der Balzaktivität bzw. der Dichte von Männchen, die wir aufgezeigt haben, an. In unserer vorliegenden Entgegnung diskutieren wir dies im Detail und weisen die Kritik zurück. Auch ist keiner der alternativen Erklärungsversuche plausibel. Die Schlussfolgerung Schmals, dass die artenschutzrechtlichen Verbote des §44 BNatSchG durch Bau und Betrieb von Windenergieanlagen regelmäßig nicht betroffen seien, halten wir (für Gebiete mit Vorkommen der Art) weder fachlich noch rechtlich für haltbar. Die Waldschnepfe ist weiterhin als windkraftsensible Art einzustufen und entsprechend bei der Planung und Bewertung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen, insbesondere im artenschutzrechtlichen Kontext, wie wir in unserer Publikation 2014 ausgeführt haben.
Woodcocks are sensitive to Wind Power plants, and their harming can break legislation on species protection – Reply to Schmal (2015) in the context of the publication by Dorka et al. (2014)
In Dorka et al. (2014) we presented methods and results from our investigation by synchronized census of the impact of a wind farm in the northern black forest on woodcock (Scolopax rusticola). The study addressed aspects of species protection and environmental liability. Schmal (2015, in this journal) criticizes several aspects, poses some questions and presents alternative attempts to explain the highly significant decrease in aerial display activities resp. abundance of males. The reply presented discusses the responses in detail and rejects the criticism. None of the alternative explanation attempts appears plausible. The conclusion drawn by Schmal that the installation and operation of wind turbines regularly does not break law according to Article 44 of the German Federal Nature Conservation Act, cannot be accepted from our point of view (concerning areas with presence of this species), neither professionally nor legally. The woodcock still has to be classified as species sensitive to wind energy plants and requires consideration in the planning and evaluation process of wind energy projects, particularly in the legal context of species protection.
- Veröffentlicht am

1 Ausgangssituation und Anlass des Beitrags
In unserer Publikation „Windkraft über Wald – kritisch für die Waldschnepfenbalz? Erkenntnisse aus einer Fallstudie in Baden-Württemberg (Nordschwarzwald)“ (Dorka et al. 2014) haben wir mittels Synchronzählung balzfliegender Waldschnepfen (Scolopax rusticola) die Auswirkungen eines Windparks auf diese Art untersucht. Dieses erfolgte durch einen Vorher-Nachher-Ansatz und eine zusätzliche Referenz.
An den 15 Zählstandorten nahm die Flugbalzaktivität zwischen 2006 und 2008 um 88 % ab. Die Unterschiede in der Anzahl überfliegender Waldschnepfen zwischen 2006 (vor Bau der Windenergieanlagen – WEA) und 2007 bzw. zwischen 2006 und 2008 sind hoch signifikant (Kruskal-Wallis-Test: p=0,01), während der Unterschied zwischen 2007 und 2008 nicht signifikant ist (p>0,05). Die Anzahl männlicher Waldschnepfen im Untersuchungsgebiet vor Bau der WEA wird auf Basis der Synchronzählungen auf ca. 30 Individuen geschätzt. Nach Bau der WEA nutzten 2007 und 2008 noch ca. 3–4 Individuen das Untersuchungsgebiet. Das entspricht einer Abnahme der Abundanz von ca. 10,0 auf 1,2 `/100ha. Letzteres ist der nach Literaturrecherche bislang niedrigste bekannt gewordene Siedlungsdichtewert dieser Art aus Untersuchungen, die methodisch vergleichbar sind.
Aspekte des Artenschutzes und der Umwelthaftung werden angesprochen. Die negativen Auswirkungen des lokalen Windkraftprojekts betreffen die Art bereits im Prozentbereich (0,5 bis 1,3 %) des landesweiten Bestands in Baden-Württemberg. Die Waldschnepfe ist demnach als windkraftsensible Art einzustufen und entsprechend bei der Planung und Beurteilung von WEA zu berücksichtigen, auch und gerade im Kontext artenschutzrechtlicher Aspekte.
Im vorstehenden Beitrag „Zur Empfindlichkeit von Waldschnepfen gegenüber Windenergieanlagen – ein Beitrag zur aktuellen Diskussion“ versucht die Autorin Gudrun Schmal (2015) eine Argumentationskette aufzubauen, die zeigen soll, dass es sich bei der Waldschnepfe nicht um eine windkraftsensible Art handelt. Eigene Untersuchungen legt sie zu dieser Frage nicht vor, sondern sie bezieht sich in ihrer Argumentation auf eine Neuinterpretation unserer Daten bzw. stützt sich auf unterschiedlichste (Literatur-)Quellen. Hierzu wird nachfolgend Stellung genommen.
2 Alternativerklärungen zu den Gründen des Rückgangs der Balzaktivität?
2.1 Überblick
Schmal leitet ihren Beitrag damit ein, dass unsere Publikation Anlass für rege Diskussionen in Fachkreisen gegeben hätte. Hierzu möchten wir vorab anmerken, dass uns solche nicht erreicht haben, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aber erreicht hätten. Ob und wo „rege Diskussionen“ in Folge unserer Publikation stattgefunden haben, darf daher offen bleiben. Ansonsten kann zunächst festgehalten werden, dass der in unserem Fall nachgewiesene hoch signifikante Rückgang der Balzaktivität der Waldschnepfe um 88 % nach Errichtung der WEA von Schmal nicht – jedenfalls nicht direkt – bestritten wird. Allerdings wird der kausale Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Balzaktivität und der Errichtung bzw. des Betriebs der WEA abgelehnt. Stattdessen werden seitens Schmal zwei Alternativerklärungen angeboten, die den Rückgang der Balzaktivität um 88 % innerhalb eines Jahres auf Sukzessionsprozesse der Windwurfflächen (Dichtschluss der Vegetation) bzw. auf die scheinbar ungünstigen Habitatbedingungen im direkten Umfeld der WEA nach der Bauphase (vegetationsfreie Rohbodenstandorte) zurückführen; zudem wird die Möglichkeit baubedingter Störungen als Ursache für den reduzierten Bestand 2007 angesprochen.
2.2 Einfluss von Sukzessionsprozessen
Die erste Alternativerklärung begründet Schmal mit der Formulierung, „das Luftbild von 2009 (GoogleEarth) weist einen geschlossenen Nadelholzjungwuchs auf. Möglicherweise war er im Jahr 2006 noch so lückig, dass er als Bruthabitat für Waldschnepfen geeignet war, diese Eignung aber im Verlauf der folgenden Jahre verloren hat“.
Hierzu ist anzumerken, dass im Untersuchungsgebiet aufgrund der Höhenlage (770 bis 860 m ü. NN) und der dadurch bedingten verkürzten Vegetationszeit sowie aus edaphischen Gründen (nährstoffarme und saure Böden auf Buntsandstein mit Neigung zur Staunässe) die Sukzessionsprozesse äußerst langsam ablaufen. Die Annahme, dass sich unter diesen Standortsbedingungen ein 2006 dokumentiertes Waldschnepfen-Optimalhabitat innerhalb nur eines Jahres (2007 als erstes Jahr mit nachgewiesenem hoch signifikantem Rückgang der Balzaktivität) durch Sukzessionsprozesse in ein völlig oder weitestgehend ungeeignetes Habitat wandelt, ist abwegig. Ein Blick auf das besagte Luftbild von 2009 zeigt, dass die Aussage einer geschlossenen Nadelholzverjüngung auf gesamter Fläche auch nicht zutrifft. Vielmehr sind z.B. im Süd- und Westteil der wohl von Schmal primär gemeinten Windwurffläche ausgedehnte offene Bereiche mit einer Schlagflurvegetation auszumachen, die dem Idealbild eines Bruthabitats der Waldschnepfe entsprechen. Auch innerhalb des gesamten Untersuchungsgebiets haben im genannten Untersuchungszeitraum 2006 bis 2008 keine strukturellen Veränderungen des Waldbestands selbst stattgefunden, die einen weitgehenden sukzessionsbedingten Verlust der Eignung als Waldschnepfen-Balzlebensraum plausibel machen könnten.
Um den Einfluss anderer Faktoren kontrollieren zu können, haben wir in unserem Untersuchungsdesign bewusst Referenzstandorte integriert, die weitab von WEA lagen, standörtlich und bestandesstrukturell aber ähnliche Bedingungen wie unser Untersuchungsgebiet aufweisen. Auch in diesen waren Sturmwurfflächen mit einer gleichen Entstehungsgeschichte integriert. Wären Sukzessionsprozesse ursächlich für den beobachteten Rückgang der Balzaktivität, hätte auch an der Referenz ein solcher dokumentiert werden müssen. Dies ist aber nicht der Fall, denn hier blieb die Überflugfrequenz in den drei Beobachtungsjahren konstant.
Der Wechsel der Referenzstandorte zwischen den Jahren ist übrigens nicht darauf zurückzuführen, dass – wie unterstellt – jeweils optimale Waldschnepfen-Habitate untersucht worden wären. Vielmehr wurden die Referenzstandorte im Rahmen eines seit Jahren durchgeführten Eulenmonitorings bearbeitet und kamen dort zu liegen, wo im jeweiligen Jahr Brutplätze bzw. Reviere des im Raum verbreiteten Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum) entdeckt werden konnten. In Bezug auf die Waldschnepfe entspricht die Wahl der Referenzstandorte damit einer Zufallsstichprobe.
Das hohe Habitatangebot für die Waldschnepfe im Schwarzwald ist u.a. auf das Sturmereignis „Lothar“ (Dezember 1999) zurückzuführen, bei dem auch die großen Wurfflächen im Untersuchungsgebiet entstanden sind. Diese Sturmwurfflächen befinden sich alle in einem ähnlichen Sukzessionsstadium und müssten entsprechend dem alternativen Erklärungsversuch von Schmal zwischenzeitlich für die Waldschnepfe ungeeignet sein. Folgt man dieser Annahme, hätten im Schwarzwald oder jedenfalls in wesentlichen Teilen dieses Raums großflächig Bestandseinbrüche der Waldschnepfe in der Größenordnung von ca. 80 bis 90 % beobachtet werden müssen. Auf eine solche Entwicklung deutet aber nichts hin. Vielmehr sind die Waldschnepfenbestände abseits von WEA nach Beobachtung mit den lokalen Verhältnissen vertrauter Ornithologen in den betrachteten Jahren als stabil einzuschätzen. Auf Basis der nach wie vor geeigneten Habitatstruktur im Untersuchungsgebiet und der abseits von WEA gelegenen stabilen Bestandssituation der Waldschnepfe im Schwarzwald trotz gleicher Sukzessionsprozesse ist damit die Hypothese, dass der Rückgang der Waldschnepfe in unserer Untersuchung auf die Vegetationsentwicklung zurückzuführen sein könnte, eindeutig widerlegt.
2.3 Einfluss der baubedingt vegetationsfreien Flächen um die WEA-Mastfüße
Als zweite Alternativerklärung wird von Schmal angeführt, dass die weitgehend vegetationsfreien Flächen um die Mastfüße während und nach dem Bau keinerlei Attraktion für die Waldschnepfenweibchen boten, woraus ein Einfluss auf das Balzverhalten der männlichen Vögel zu erwarten wäre. Dies ist ausschließlich als Spekulation zu bewerten, sie wird von Schmal nicht belegt und ist auch äußerst zweifelhaft.
Die weitgehend vegetationsfreien Flächen um die Mastfüße haben insgesamt eine zu geringe Ausdehnung, um – selbst soweit sie im Einzelfall einen konkreten vorherigen Eiablageplatz eines Waldschnepfenweibchens betroffen haben sollten – direkt eine wesentliche Änderung im grundsätzlichen Angebot potenzieller Brutstandorte für weibliche Waldschnepfen im Untersuchungsgebiet hervorzurufen (s.a. die Ausführungen zur Frage des direkten Habitatverlusts bei Dorka et al. 2014). Die Balzflüge der Waldschnepfe erfolgen zudem strukturgebunden und orientieren sich dabei in der Regel an Waldinnenrändern. Unter heutigen Bedingungen erfolgen die Balzflüge häufig entlang des Forstwegenetzes (Lanz 2008), wobei auch regelmäßig breite und geschotterte Forststraßen oder befestigte Holzlager- oder Waldparkplätze in die Flugrouten eingebunden werden. Solche unterscheiden sich strukturell nicht von den Flächen um die Mastfüße in den Jahren 2007 bzw. 2008 (mit Ausnahme der in jenen aufragenden Masten nach Errichtung von WEA).
Die Annahme einer relevanten Auswirkung der vegetationsfreien Rohbodenflächen um die Mastfüße auf die Balzflüge, und insbesondere ihre ursächliche Bedeutung für den festgestellten Rückgang der Balzaktivität, ist daher als unplausibel abzulehnen.
2.4 Baubedingte Störungen 2007
Schmal führt im Weiteren an, dass die stark reduzierten Balzflüge des Jahres 2007 möglicherweise damit zusammenhängen könnten, dass zur Zeit der Erfassung in jenem Jahr die Bauarbeiten im Windpark noch nicht abgeschlossen waren. Tatsächlich ist ein Einfluss baubedingter Störungen für 2007 nicht völlig auszuschließen, wenngleich das diesbezüglich realistische Störungspotenzial (Intensität, zeitliche und räumliche Differenzierung innerhalb des Untersuchungsgebiets) aus unserer Sicht als eher nachrangig einzustufen ist.
Die Zählergebnisse zwischen 2007 und 2008 unterschieden sich aber statistisch abgesichert nicht. Obwohl 2008 keine Baumaßnahmen mehr stattgefunden haben, erwies sich der Bestand in jenem Jahr auf dem gleichen niedrigen Niveau wie 2007. Damit ist der Rückgang allein durch baubedingte Störungen nicht plausibel zu erklären, schon gar nicht im registrierten Ausmaß. Vielmehr zeigen die Ergebnisse deutlich, dass andere anlage- oder betriebsbedingte Faktoren wirken müssen.
2.5 Zwischenfazit
Keine der von Schmal angeführten alternativen Erklärungsversuche zur Abnahme der Balzaktivität der Waldschnepfe ist plausibel. Auch unter Anwendung des Ockhamschen Prinzips (s. Forster & Sober 1994) verbleibt im vorliegenden Fall weiterhin als einfachster und zugleich passendster Erklärungsansatz, dass die hoch signifikante Abnahme der Balzaktivität der Waldschnepfe auf die Errichtung und den Betrieb der WEA im Untersuchungsgebiet zurückzuführen ist. Die Art ist daher unter Bezug auf Dorka et al. (2014) auch weiterhin als windkraftsensibel einzustufen.
3 Diverse Detailfragen
In unserer Publikation diskutieren wir ausführlich die Ursachen des Rückgangs der Flugbalzaktivität im Kontext von direktem Habitatverlust, Tötung und Störung im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der WEA und bewerten dies im Kontext von Artenschutz und Umwelthaftung. Den Ausführungen vermochte Schmal in weiten Teilen nicht zu folgen und zweifelt verschiedene Aspekte unserer Ausführungen an. Zudem nimmt sie selbst Aussagen in ihrem Beitrag vor, die hinterfragt werden müssen. Wir gehen nachfolgend detaillierter hierauf ein.
3.1 Störungsanfälligkeit der Waldschnepfe
3.1.1 Störungen durch Licht, Lärm und Personen
Zur Störungsempfindlichkeit zitiert Schmal aus Glutz von Blotzheim (1986) über das Verhalten balzfliegender Waldschnepfen gegenüber Beobachtern: „Geringfügige Bewegungen, leises Sprechen und das Aufleuchten eines Elektroblitzes führen weder zu Flugänderungen noch zu Unterbrechung der Balzstrophe“. Darauf aufbauend nimmt sie an, dass daher von WEA ausgehende Lichtemissionen das Verhalten von Waldschnepfen nicht beeinflussen. Der Zusammenhang zwischen dem Störreiz, der von einem Beobachter ausgeht, und dem Störreiz einer andersartigen nächtlichen Befeuerung eines hoch im Wald aufragenden Bauwerks erschließt sich uns nicht. Zudem wird dem interessierten Leser auch ein jedenfalls im Kontext des obigen Zitats nicht unbedeutender Teil des zitierten Werkes zur Störungsempfindlichkeit der Waldschnepfe gegenüber dem Menschen vorenthalten, denn an das obige Zitat schließt sich an: „Erst hastige Bewegungen in geringer Entfernung des Vogels oder lautes Rufen veranlasst die Schnepfe, augenblicklich ihre Flugrichtung zu ändern…“ (Glutz von Blotzheim 1986: 165).
In unserer Publikation diskutieren wir ausführlich die Möglichkeit der Maskierung von Waldschnepfenrufen durch Lärmemissionen der WEA und kommen zu dem Schluss, dass entscheidende Elemente der akustischen Kommunikation der Waldschnepfe im Einflussbereich von WEA nachhaltig gestört werden. Schmal bestreitet dies und versucht, die Waldschnepfe als lärmunempfindliche Art darzustellen. Nach unserer Erkenntnis ist vor allem von einer Maskierung des bei 2kHz geäußerten „Quorren“ auszugehen. Dem wird von Schmal nichts entgegengesetzt, sondern vielmehr ebenfalls darauf hingewiesen, dass dies „ohnehin nur auf geringe Entfernung hörbar (20–50 m)“ ist, was ja unserer Argumentation entspricht. Dass im Singflug auch ein leicht wetzender Flügelschlag eine Rolle im Balzgeschehen spielt, wird von Schmal mit dem Hinweis „Belege dafür finden sich in der Literatur nicht“ abgelehnt. Dies ist unzutreffend, denn in Bergmann et al. (2008) findet sich im Waldschnepfenkapitel auf S. 208 unter Instrumentallaute genau diese Angabe. Dieses Standardwerk zu Lautäußerungen von Vögeln wird in unserer Publikation auch zitiert.
Als Hauptargument für eine Lärmunempfindlichkeit der Waldschnepfe wird seitens Schmal eine im Textblock selbst nicht als mündliche Mitteilung gekennzeichnete Beobachtung des Jagdausübungsberechtigten Schlüter aufgeführt: „Regelmäßig balzen Waldschnepfen auch im Nahbereich von Autobahnen, z.B. in 400 m Entfernung zur A7 nördlich des Kreuzes Hannover-Ost“. Solche anekdotischen Mitteilungen von Beobachtungen können nicht als Beleg für eine Lärmtoleranz der Waldschnepfe gewertet werden. Es sind damit z.B. keine Informationen darüber verbunden, ob und in welchem Ausmaß sich der Bestand der Art betriebsbedingt gegenüber der Situation ohne Autobahn verändert hat. Die Störungsempfindlichkeit einer Art kann sich innerhalb eines belasteten Raums durchaus in – auch sehr starken – Siedlungsdichte-Abnahmen manifestieren, obwohl z.B. einzelne Individuen den Raum weiterhin nutzen. Im Übrigen vermag sich zumindest die konkret angeführte Beobachtung aufgrund des zitierten Entfernungsbereichs auch gut in die bisherige Bewertung der Waldschnepfe als Art mit mittlerer Lärmempfindlichkeit bezüglich straßenbedingten Lärms nach der „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ (Garniel & Mierwald 2010) einzuordnen. Für die Waldschnepfe werden dort eine Effektdistanz (größte erkennbare Reichweite des negativen Einflusses von Straßen bzw. Eisenbahnen nach Definition jener Arbeit) von 300 m und ein kritischer Schallpegel von 58dB(A)tags angegeben.
Unabhängig davon, dass bei der Paarfindung der Waldschnepfe zusätzlich auch optische Signale eine Rolle spielen, ist auch danach eine Störung aufgrund von Lärmemissionen durch WEA weiterhin plausibel.
3.1.2 Störungen durch Bauwerke
Neben der akustischen Störwirkung diskutieren wir in unserer Publikation eine anlage- oder betriebsbedingte Barriere- und Scheuchwirkung für die Flugbalz der Waldschnepfe. Hier wirft uns Schmal vor, „die starke Barriere- und Abweiswirkung der WEA wurde u.a. aufgrund einer falsch zitierten Flughöhe abgeleitet“. Dieser Vorwurf bezieht sich auf folgenden Abschnitt unserer Publikation: „Neben der akustischen Störwirkung kann sich zudem eine anlagen- oder betriebsbedingte Barriere- und Scheuchwirkung für die Waldschnepfe ergeben. Der Balzflug der Männchen richtet sich entlang von Waldinnenrändern (z.B. Wege, Sturmwurfflächen, Wildwiesen) aus. Diese strukturgebunden Balzflüge finden zu Beginn der Aktivitätsphase auch in größerer Höhe, im Einflussbereich der im Gebiet installierten WEA-Rotoren (60–100 m), statt. Gegen Aktivitätsende verringert sich allerdings die Flughöhe bis knapp über dem Wipfelbereich der überflogenen Bestände (Nemetschek 1977). Während der Balzflüge sind sowohl Verfolgungsflüge von Männchen, als auch Synchronflüge von Paaren zu beobachten. Überfliegende Männchen werden zudem von am Boden sitzenden Weibchen zur Paarung aufgefordert. Einer Störung der Flugbalz wäre daher essenzieller Einfluss auf die Paarfindung und damit die Reproduktion von Waldschnepfenpopulationen beizumessen.“
Hierzu schreibt Schmal: „Dorka et al. (2014) stellen dar, dass die Balzflüge zu Beginn der Aktivitätsphase auch im Einflussbereich der Rotoren in 60 bis 100 m Höhe stattfänden, sich die Flughöhe erst gegen Aktivitätsende der überflogenen Bestände reduziere. Die als Beleg für diese Aussage zitierte Arbeit von Nemetschek (1977) stellt dar, […] die u.a. auch der Darstellung von Glutz von Blotzheim zugrunde lag, der Flughöhen von 20 m zu Beginn der Abendbalz nennt und keine Hinweise auf größere Höhen gibt.“
Aus dem oben zitierten Teil unserer Publikation geht klar hervor, dass sich die Aussagen zur Flughöhe von 60–100 m auf unsere eigenen Beobachtungen im Gebiet beziehen und keinesfalls eine falsche Zitierung darstellen. Denn Nemetschek hat nie in Simmersfeld beobachtet und kann folglich auch nicht im Einflussbereich der dortigen WEA fliegende Waldschnepfen beobachtet haben. Durch das Satzzeichen „Punkt“ ist dies klar von der auch unseren Beobachtungen entsprechenden Aussage Nemetscheks (1977: 74) getrennt, der feststellt: „Mit fortschreitender Abnahme der Lichtintensität wurde die Flughöhe bis zur Wipfelhöhe reduziert“. Die bei Nemetschek (1977) angegebenen Flughöhen von max. 27m wurden in einem Erlenbruchwald ermittelt. Die mittlere Bestandshöhe wird in jener Arbeit nicht erwähnt, lässt sich aber aus folgender Aussage ableiten: „Mit fortschreitender Abnahme der Lichtintensität wurde die Flughöhe bis zur Wipfelhöhe reduziert (Abb. 4). Die ` flogen dann in 1–3m Höhe knapp über den Wipfeln, zum Teil auch zwischen den Baumkronen.“ In Abb. 4 jener Arbeit wird die Mindestflughöhe mit ca. 11±4m angegeben. Es kann also von einer mittleren Bestandshöhe von ca. 10 m ausgegangen werden. Damit fanden die höchsten Überflüge in Nemetscheks Beobachtungsgebiet in ca. 2,5-facher mittlerer Bestandshöhe statt.
Die Waldschnepfe orientiert ihre Flughöhe während der Balz an der Bestandshöhe. Die Behauptung von Schmal, dieses sei davon unabhängig, ist unzutreffend. Eine Übertragung und Generalisierung der Flughöhen-Messungen von Nemetschek (1977) auf alle standörtlichen Ausprägungen und bestandestrukturellen Gegebenheiten vielfältigster Waldbestände ist nicht möglich und wurde von diesem auch nie unterstellt. In unserem Untersuchungsgebiet variiert die mittlere Bestandshöhe der Altbestände je nach Standortverhältnissen und Baumartenzusammensetzung zwischen ca. 30 und 40 m. Selbst in der späten Abenddämmerung, wenn die Waldschnepfen tief fliegen, sanken die Flughöhen daher kaum unter 30 m ab. In der frühen Abenddämmerung konnten hingegen häufig Waldschnepfen in doppelter bis dreifacher Bestandshöhe, also in 60–100 m Höhe, beobachtet werden.
Zusammenfassend könnte uns in diesem Zusammenhang daher also allenfalls eine knappe Darstellung vorgeworden werden.
Schmal führt ferner aus, dass eine grundsätzliche Meidung von Strukturen, die durch Bauwerke geprägt sind, nicht gegeben zu sein scheine, da Berichte existieren würden, die belegen, dass Balzflüge von Schnepfen sich sogar in Dörfer erstrecken. Als Beleg hierfür finden sich bei ihr zwei Zitate.
Zum einen handelt es sich dabei um das 1836 erschienene Werk „Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas“, Teil 8, von Johann Friedrich Naumann. Bei einer Durchsicht des Waldschnepfenkapitels (S.359–401) konnten wir keinen Hinweis auf über Ortschaften balzende Waldschnepfen finden, stattdessen wird das Habitat dort folgendermaßen charakterisiert: „Wie schon aus dem Namen hervorleuchtet, ist unsere Schnepfe eine Bewohnerin der Wälder und waldigen Gegenden. Sie macht fast keinen Unterschied in den Holzarten, ist im reinen Laubwalde, wie im gemischten, oder selbst im reinen Nadelwalde anzutreffen, verweilt jedoch im alten Hochwalde nie lange; er dient ihr nur als Notbehelf in der Zugzeit, wie dann auch wol buschreiche Gärten, selbst in Dörfern oder Städten, oder Dornhecken im freien Felde, oder gar bloße Feldraine ihr zuweilen eine kurze Zuflucht gönnen. … Kaum ist ein anderer Waldvogel so sehr an Wald und Bäume gebunden als sie, …“ (Naumann 1836: 377ff.). Zu den Balzplätzen findet sich: „Die Orte, an oder über welchen sie dies sonderbare Spiel treiben, sind kleine freie Plätze, schmale Thalwiesen, breite Wege, offene grüne Waldschluchten oder andere Oeffnungen zwischen höherem und dichtern Holze“ (Naumann 1836: 382). Demnach beschreibt Naumann Dörfer und Städte – im Übrigen aus dem Zeitraum vor Mitte des 19. Jh. – lediglich als ungünstiges Rasthabitat („Notbehelf“) während der Zugzeit. Hieraus wiederum kann nicht abgeleitet werden, dass Bauwerke, insbesondere WEA im Wald, nicht von Waldschnepfen während der Balz gemieden werden. Die Zitierung Naumanns im genannten Kontext ist insoweit falsch.
Als Beleg für Balzbeobachtungen über Siedlungen zitiert Schmal zudem „aktuelle Berichte“ mit Hinweis auf mündliche Informationen von J. Schlüter. Hier stellt sich die Frage, welche Bedeutung einer wohl eher anekdotenhaften Beobachtung balzender Waldschnepfen über einer Siedlung beizumessen ist und unter welchen Rahmenbedingungen diese erfolgte. Ein solches Zitat vermag keinesfalls eine Toleranz der Waldschnepfe während der Balz gegenüber WEA im Wald zu belegen oder auch nur plausibel zu machen.
3.2 Reichweite von Störwirkungen
Wie weit die Störwirkung räumlich wirkt, wurde von uns nicht untersucht, was wir in unserer Publikation auf S. 75 auch klarstellen. Hierzu wäre ein anderes Untersuchungsdesign notwendig gewesen, welches sich z.B. an die Ansätze von Garniel & Mierwald (2010) zur Ermittlung der Effektdistanzen von Straßen anlehnt. Einen Hinweis auf den Meideabstand geben aber unsere Zählergebnisse von einem WEA-Standort am Rande einer großen Sturmwurffläche. Hierzu führen wir aus: „Im Jahr 2006 wurde hier das Überflugmaximum mit 18 Überflügen registriert. Im Jahr darauf konnte nur noch ein Balzflug, in 2008 aber wieder acht Überflüge beobachtet werden. Während im Jahr 2006 noch die gesamte Sturmwurffläche zur Balz genutzt wurde, konzentrierten sich die Beobachtungen in den Jahren 2007/2008 auf einen von der WEA >300 m entfernt liegenden Bereich.“ (Dorka et al. 2014: 75).
Schmal findet dies nicht plausibel, denn „die besagte Windwurffläche [ist] an keiner Stelle mehr als 300 m von einer der insgesamt vier in der Umgebung der WEA entfernt […] (Kontrolle über Luftbilder von GoogleEarth)“, die „Lautäußerungen von Waldschnepfen seien lediglich …bis zu 300 m weit hörbar“ und schließlich seien „Sichtbeobachtungen auf Entfernungen von über 300 m […] bei dem weniger als taubengroßen Vogel in der Dämmerung und an Waldstandorten eher unwahrscheinlich“.
Es ist zutreffend, dass die gesamte Windwurffläche im 300-m-Bereich von WEA liegt. Dies trifft aber nicht für alle vom Beobachtungspunkt einseh- und hörbaren Bereiche zu. Die Hörweite der Schnepfenrufe ist neben der Lautstärke der Rufe auch von der Vegetationsstruktur, dem Relief, den Witterungsverhältnissen und dem Hörvermögen des Beobachters abhängig. Wissenschaftliche Publikationen, in denen die Hörweite von Waldschnepfenrufen in Abhängigkeit dieser Variablen untersucht wurde, sind uns nicht bekannt. Der Verweis von Schmal auf bis 300 m weit hörbare Aggressionslaute in Glutz von Blotzheim (1986) beruht dem Zitat nach offenbar auf einer anekdotischen Beobachtung und nicht auf einer systematischen Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Das zweite von Schmal aufgeführte Zitat zur Hörentfernung stammt aus einem Internetforum. Als wäre es allgemeingültig und auf wissenschaftlicher Basis beruhend, wird dargestellt: „Das Quorren ist jedoch ohnehin nur auf geringe Entfernung hörbar (20–50 m) (vgl. Brauneis 2014a).“ Tatsächlich übermittelt Jörg Brauneis in seinem Forumsbeitrag, der hier zitiert wurde, die Beobachtung eines Abends: „Bei einer durch den bedeckten Himmel früh einsetzenden Abenddämmerung ab 18:44 Uhr (Sonnenuntergang in Eschwege 18:24 Uhr) ein ganz toller Schnepfenstrich. Bis zu drei laut streichende Schnepfen waren gleichzeitig über der ca. 30 Hektar großen auf einer Kyrill-Windwurffläche begründeten Douglasienkultur zu sehen! Das Puitzen war trotz des in den Baumkronen arbeitenden Windes gut zu hören, das Quorren nur, wenn die Schnepfe in geringer Entfernung (20–50 m) vorbeistrich. Nach wenigen Minuten war das ganze Schauspiel dann leider schon wieder vorüber.“
Aus diesen beiden Angaben universelle Hörgrenzen für die Waldschnepfe ableiten zu wollen, ist nicht zulässig. Unserer Erfahrung nach trägt das „Puitzen“ der Waldschnepfe weit. Im Waldesinnern sind Hörweiten unter günstigen Bedingungen von 200–300 m nicht überschätzt, in Freiflächensituationen verdoppeln sich diese Werte. Auch die Behauptung, dass taubengroße Vögel auf 300 m nicht mehr sichtbar wären, ist unzutreffend. Die höher fliegenden dunklen Vögel kontrastieren gegenüber dem helleren Horizont gut und sind, insbesondere wenn ein lichtstarkes Fernglas genutzt wird, auch auf größere Entfernung leicht auszumachen. Limitierend ist hier eher die Übersichtlichkeit von Zählpunkten im Wald. Am diskutierten Beispiel war diese wegen der Lage am Rande einer großen Sturmwurffläche, aber auch wegen der nach West abfallenden Exposition über mehrere hundert Meter gegeben. Die von Schmal vermutete Überschätzung der Erfassungsradien ist daher unzutreffend.
Der auf Basis unserer Beobachtung vorläufig abgeschätzte Meidebereich zu WEA von 300 m stimmt auch mit der für Wirkungen des Straßenverkehrs ermittelten Effektdistanz von 300 m gut überein (s. Garniel & Mierwald 2010). Dennoch konnten wir auch am besagten Standort noch eine deutliche Abnahme der Balzflüge von 56 % gegenüber der vorherigen Situation feststellen, weshalb ein weiter reichender Meidebereich nicht ausgeschlossen werden kann.
Zu dieser Fragestellung besteht Forschungsbedarf, wie auch von uns ausdrücklich angesprochen. Anlass dafür, dass dieser von uns als vorläufig anzunehmend (s. Dorka et al. 2014, Abschnitt 4.3) genannte Meidebereich unplausibel sein sollte, gibt es nach den vorliegenden Daten jedoch nicht.
3.3 Siedlungsdichte der Waldschnepfe
Die von uns im Untersuchungsgebiet Simmersfeld ermittelte Siedlungsdichte wird von Schmal angezweifelt. Zunächst wird uns vorgeworfen, dass wir nicht dargestellt hätten, wie diese ermittelt wurde. Dann wird unterstellt, wir hätten „pauschal 4,3 Überflüge/100ha einem Männchen zugerechnet, obwohl Mulhauser & Zimmermann (2010) festgestellt haben, dass in einem Gebiet zwar eine lineare Korrelation zwischen Kontakten (Überflügen) und der Anzahl Männchen besteht, es aber nicht möglich ist, eine allgemeingültige Formel für das Verhältnis beider Größen herzuleiten.“ Diese Unterstellung ist falsch, da wir in unserer Publikation unter Auswertung und Diskussion/Bewertung (S. 71) darstellen: „die Auswertung erfolgt in Anlehnung an Münch & Westermann (2002; s. dort)“. In der zitierten Publikation ist ausführlich dargelegt, wie die Siedlungsdichte der Waldschnepfe auf Basis von Synchronzählungen zu ermitteln ist. Das gleiche Vorgehen wurde auch von Gaedicke & Wahl (2007) bei einer Untersuchung im Umfeld von Münster angewandt und ist auch dort beschrieben. Daneben ist uns lediglich noch eine weitere Arbeit zur Bestimmung der Siedlungsdichte der Waldschnepfe mit dem Ansatz der Synchronzählung bekannt (Andris & Westermann 2002).
Der von uns ermittelte Siedlungsdichtewert von 10,0`/100ha erscheint Schmal dann als „stark überhöht“ und der nachgewiesene Bestandsrückgang auf 1,2`/100ha nach Errichtung des Windparks „entbehrt jeder populationsökologischen Grundlage“. Als vermeintlicher Beweis werden die Siedlungsdichtewerte der oben genannten Untersuchungen unserem gegenübergestellt. Diese liegen am Oberrhein bei 4,8`/100ha (Münch & Westermann 2002) bzw. großflächig bei 2,4`/100ha (Andris & Westermann 2002). Für den waldreichen Süden der Stadt Münster, bezogen auf einen gesamten TK-Quadranten (d.h. Viertel eines Kartenblatts der Topographischen Karte TK 1:25000), gibt Schmal 0,7 bis 1,7`/100ha mit Bezugnahme auf Gaedicke & Wahl (2007) an. Letzterer Wert bezieht sich aber auch auf Flächen, die als Waldschnepfenhabitat völlig ungeeignet sind (Siedlungen, Agrarlandschaft).
Für das TK 4111 geben Gaedicke & Wahl (2007) einen Schnepfenbestand von 41–97` an. Nach den Bodenbedeckungsdaten für Deutschland aus dem CORINE-Projekt (Stand 2006, UBA & DLR-DFD 2009) beträgt die Waldfläche innerhalb jenes TK 2452ha. Daraus errechnet sich eine Siedlungsdichte von 1,7–4,0`/ 100ha. Es ist dabei nicht plausibel anzunehmen, dass die Siedlungsdichte der Waldschnepfe auf der gesamten Waldfläche von knapp zweieinhalbtausend Hektar homogen ist, vielmehr ist in Optimalhabitaten mit einer deutlich höheren bzw. in Pessimalhabitaten mit einer deutlich geringeren Siedlungsdichte der Art zu rechnen.
Dieser enge Zusammenhang zwischen abnehmender Siedlungsdichte und Probeflächengröße ist für eine Vielzahl von Vogelarten belegt (z.B. Vowinkel & Anthes 2012: 82; Straub 2013: 68). Aussagen zur Siedlungsdichte finden sich in der gesamten Publikation von Gaedicke & Wahl (2007) nicht, denn Ziel deren Untersuchung war auch nicht die exakte Erfassung des Waldschnepfenbestands, sondern eine Abschätzung der Häufigkeitsklasse für die ADEBAR-Kartierung. Hierzu findet sich auf S. 39 ihrer Publikation folgende Ausführung: „Ziel der Kartierung für ADEBAR ist es, mit möglichst geringem Aufwand zu einer zuverlässigen Einschätzung der Brutbestände in den vorgegeben Größenklassen auf einem Viertel einer TK 25 zu kommen. … Es ist also ausreichend, so lange zu kartieren, bis man sich beispielsweise sicher ist, dass es mehr als 7 und weniger als 21 balzende Männchen sind. Dann kann der Bestand mit 8–20 angegeben werden. Wie viele es genau sind, ist in diesem Zusammenhang unbedeutend.“ Aus den aufgeführten Gründen können die o.g. Arbeiten und der von Schmal mit Bezug auf Gaedicke & Wahl (2007) genannte Dichtewert nicht als Hinweis oder gar Beleg dafür interpretiert werden, dass der von uns ermittelte Dichtewert der Ausgangssituation überhöht sei.
Neben diesen publizierten Siedlungsdichtewerten, die mit einer nachvollziehbaren Methode ermittelt wurden, verweist Schmal auf zwei weitere Angaben. Zum einen auf ein „Plädoyer für den Fichtenwald“ aus einem Internetforum (im Text von Schmal als Brauneis 2014b zitiert), indem für die Schutzwürdigkeit von Fichtenwäldern und gegen den Ausbau der Windenergienutzung in diesen, u.a. mit Verweis auf eine hohe Waldschnepfendichte von „fünf Balzrevieren pro 100ha“, an die Hessische Gesellschaft für Ornithologie appelliert wird. Ob diese Angabe auf einer Schätzung oder gezielten Erfassung beruht und für welche Räume, kann von uns nicht nachvollzogen werden; die Zitierung in diesem Zusammenhang halten wir für wenig sinnvoll. Als weiteren Wert zitiert Schmal „… während der Brutvogelatlas Hessen für Probeflächen in dortigen Vogelschutzgebieten, also den geeignetsten Gebieten für die Art, 4 Paare/100ha benennt (HGON 2010: 189).“
Davon abgesehen, dass für die Waldschnepfe aktuell keine Methode publiziert ist, mit der die Paarzahl bestimmt werden kann, wird hier von Schmal im Zitat eine wesentliche Auslassung vorgenommen. Das korrekte Zitat lautet nämlich: „Hochrechnungen aus Probeflächenuntersuchungen in den europäischen Vogelschutzgebieten ermöglichen zudem Bestandsangaben für größere Flächen. Dort konnten auf Probeflächen im Durchschnitt 4 Paare/100 Hektar ermittelt werden.“ (HGON 2010:188ff). Wesentlich ist die Aussage, dass es sich um einen durchschnittlichen Wert handelt. Auch hier gilt der bereits oben erwähnte negative Zusammenhang zwischen Probeflächengröße und Siedlungsdichte. Da es sich um einen durchschnittlichen Wert handelt, impliziert dies, dass auf einem Teil der Probeflächen höhere Werte ermittelt wurden. Mit welcher Methode dies geschehen ist, kann hier nicht nachvollzogen werden. Jedenfalls ist auch dieses Zitat nicht als Beleg oder Hinweis auf eine angeblich überhöhte Siedlungsdichte in unserer Arbeit geeignet.
Damit verbleiben an publizierten Siedlungsdichtewerten, die mit einer der unsrigen vergleichbaren Methode ermittelt wurden, die Angaben von Andris & Westermann (2002) und Münch & Westermann (2002). Aufgrund der engen Korrelation zwischen der Anzahl an Überflügen und der Anzahl anwesender Männchen (Ferrand 1987, Muhlhauser & Zimmermann 2010) erlaubt der Vergleich der mittleren Anzahl an Überflügen je Zählpunkt und der ermittelten Siedlungsdichte eine Abschätzung der Plausibilität unserer Ergebnisse. Die geringste Siedlungsdichte wurde in der südbadischen Oberrheinebene mit 2,4`/100ha und 3,9 Überflügen je Zählpunkt ermittelt (Andris & Westermann 2002). Im Rheintal geben Münch & Westermann (2002) bei 7,6 Überflügen je Zählpunkt eine Siedlungsdichte von 4,8`/100ha an. In Simmersfeld konnten wir vor Errichtung der WEA bei 11,1 Überflügen je Zählpunkt eine Siedlungsdichte von 10,0`/100ha feststellen. Nach Errichtung der WEA ermittelten wir bei 1,2 Überflügen je Zählpunkt eine Siedlungsdichte von 1,2 `/100ha. Ein Anstieg der Siedlungsdichte mit der Anzahl an Überflügen entspricht damit der Erwartung. Der Schwarzwald stellt zudem ein Schwerpunktvorkommen der Art in Baden-Württemberg dar (s.u.). Unsere Ergebnisse sind daher durchaus plausibel.
Eine verlässliche Abschätzung des Verhältnisses zur maximal möglichen Siedlungsdichte der Waldschnepfe ist aufgrund der wenigen Angaben in der Literatur derzeit nicht möglich. Das Maximum an einem Zählpunkt nach unserer Kenntnis bislang festgestellter Überflüge stammt aus dem Ural und beträgt 64 (Blokhin & Fokin 2006) und auf den Azoren konnte eine mittlere Anzahl von 41,5 Überflügen je Zählpunkt dokumentiert werden (Machado et al. 2006). Auf Basis dieser Angaben ist davon auszugehen, dass bei der Waldschnepfe noch weit höhere Siedlungsdichten als 10,0 `/100ha möglich sind. In Hagemeijer & Blair (1997: 293) wird angegeben, die besten Waldschnepfenhabitate in Großbritannien könnten eine Siedlungsdichte von bis zu 12 „Paaren“/100ha Waldfläche erreichen. Leider finden sich auch hier keine Angaben, worauf dieser Wert konkret zurückgeht. In England wurden aber in einem 171ha großen Waldgebiet zwischen 1978 und 1981 jährlich zur Brutzeit zwischen 14 und 23 Männchen gefangen, markiert und teilweise telemetriert (Hirons 1983). Dies entspricht einer Siedlungsdichte von 8,2–13,5 `/100ha. Der von uns ermittelte Siedlungsdichtewert vor Realisierung von WEA liegt demnach jedenfalls in einem erwartbaren Bereich für hochwertige Waldschnepfenhabitate.
Das weitere Argument von Schmal, dass die „Nadelholzbestände des Schwarzwaldes nicht gerade dem Optimalhabitat entsprechen“ und daher die von uns ermittelte Siedlungsdichte nicht plausibel sei verwundert, denn: „Das Hauptverbreitungsgebiet der Waldschnepfe in Baden-Württemberg liegt im Schwarzwald oberhalb von 500 m NN bis in die höchsten Lagen. Hier brüten zwei Drittel des gesamten Brutbestandes“ (Hölzinger & Boschert 2001). Dies zeigt auch die von uns dargestellte Verbreitungskarte (Dorka et al. 2014: 77), aus der auch zu entnehmen ist, dass unser Untersuchungsgebiet Simmersfeld im Kernbereich der Waldschnepfenverbreitung in Baden-Württemberg liegt. An 244 Zählpunkten konnte für den Nordschwarzwald eine durchschnittliche Anzahl von 6,2 Überflügen ermittelt werden (Dorka in Hölzinger & Boschert 2001). In Frankreich gelten Zählpunkte mit =5 Beobachtungen/Abenddämmerung als Standorte mit einer hohen Abundanz (Ferrand et al. 2008).
3.4 Umweltkapazität und „Ausweichen“ von Individuen
Schmal erwartet, dass aufgrund der „gegenwärtigen Bestandszahlen und dem enormen Jagddruck in den Durchzugs- und Überwinterungsgebieten“ die „Kapazität der Umwelt“ durch die Waldschnepfe nicht ausgeschöpft wäre, und vermutet daher, „dass kleinräumigen Verlusten geeigneter Brutbiotope, wie sie ein Windpark potenziell verursachen könnte, ausgewichen werden kann, ohne dass dies einen Einfluss auf den Brutbestand der Population hat. Diese These zu be- oder widerlegen wäre gem. Art. 10 (1) Vogelschutzrichtlinie dann eine Forschungsaufgabe der Mitgliedstaaten und nicht des Betreibers eines Windparks“.
Abgesehen davon, dass sich bei der Ausdehnung von Windparks ggf. nicht mehr die Frage nur „kleinräumiger Verluste“ stellt, ist diesen Überlegungen aus mehreren Gründen entgegen zu treten.
Das Überwinterungsgebiet der baden-württembergischen Waldschnepfen dürfte vom westlichen Frankreich bis zur Atlantikküste und südwärts bis in den Norden der Iberischen Halbinsel reichen (Hölzinger & Boschert 2001). Für Frankreich ist belegt, dass durch den dortigen hohen Jagddruck die Überlebensraten im Winter so stark reduziert sind, dass ein langfristiger Erhalt der Population momentan nicht gewährleistet ist (Duriez et al. 2005, Tavecchia et al. 2002). Allerdings stammen die in Frankreich überwinternden Waldschnepfen nicht ausschließlich aus Südwest
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

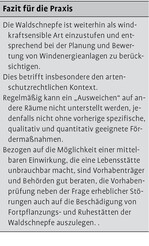
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.