Kurzumtriebsplantagen im Spannungsfeld erneuerbarer Energien
Abstracts
Vor dem Hintergrund der aktuellen Umwälzungen im Energiesektor (Erweiterung des Anteils erneuerbarer Energien) wird anhand einer Literaturrecherche ein Vergleich potenzieller Umweltwirkungen unterschiedlicher erneuerbarer Energieträger durchgeführt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Dendromasseproduktion durch Kurzumtriebsplantagen (KUP). Die bestehenden Ökobilanzen zum Anbau und zur Verwendung von KUP-Holz zeigen, dass durch den Einsatz von Dendromasse aus KUP bei Betrachtung des gesamten Wirtschaftszyklus Minderungspotenziale für ausgewählte Wirkungskategorien wie Treibhausgasemission oder des kumulierten Energieaufwandes bestehen. Jedoch muss hier auf einen kritischen und differenzierten Umgang mit den ermittelten Potenzialen hingewiesen werden. Allein ein Einsatz von Düngemitteln in KUP hebt die positiven Effekte von KUP fast vollständig auf. Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Anbaus von KUP wurden mit Hilfe einer SWOT-Analyse herausgearbeitet. Die Ergebnisse belegen, dass eine mögliche positive Bilanz von der Erfüllung von Natur- und Umweltschutzbelangen abhängt.
Short Rotation Coppice in the Context of Renewable Energy Production – Comparison of potential environmental effects on the basis of literature research
In the light of the current shifts in the energy sector (extension of the share of renewable energy) the study compared the potential environmental effects of different sources of renewable energy by literature research. The review mainly focuses on the production of dendromass by short-rotation coppice (SRC) on agricultural land. The life cycle assessments show significant reduction potentials for selected impact categories such as greenhouse gas emission or accumulated energy expenditure when using SRC wood from short rotation coppice. However, it must be pointed out that the analysis of the potentials has to be completed by a critical and differentiated assessment. For example the use of fertilizers may almost fully offset the described positive effects of SRC.
A SWOT analysis worked out strengths, weaknesses, opportunities and threats of the cultivation of short rotation coppice. The results show that a possible positive balance of SRC depends aspects of on nature and environmental protection.
- Veröffentlicht am

1 Einführung
Die energetische Nutzung von Biomasse ist derzeit eine der wichtigsten tragenden Säulen der erneuerbaren Energien, deren weiterer Ausbau in Deutschland im Fokus aktueller zum Teil kontrovers geführter öffentlicher wie wissenschaftlicher Diskussion steht (u.a. Ammermann 2013, DNT 2012, Schulze & Körner 2012, Spandau & Luberstetter 2012, von Haaren et al. 2013). Biomasse hat trotz geringerer Flächeneffizienz den Vorteil, dass sie sich relativ leicht in großen Mengen und mit hoher Energiedichte speichern lässt. Sie hat damit einen wichtigen „Kapazitätskredit“ (vgl. Leopoldina 2012). „Der Kapazitätskredit eines Brennstoffs ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass der Brennstoff zuverlässig den fluktuierenden Bedarf an Energie abdecken kann. So kann Stromerzeugung aus Bioenergie zur Netzstabilität beitragen, was in einem Energiesystem, in dem die Anteile an fluktuierenden erneuerbaren Energien größer werden, immer wichtiger wird“ (Leopoldina 2012). Auf der anderen Seite führt die massive Erweiterung des Biomasseanbaus zu Schäden an Natur, Landschaft und Ökosystemfunktionen (Bastian & Lupp 2013).
Wurden in Deutschland im Jahr 2000 noch 359400 ha mit Energiepflanzen angebaut, waren es 2012 bereits 2124500 ha (FNR 2012), was in dem zwölfjährigen Zeitraum eine Verfünffachung der Anbaufläche entspricht. Nitsch et al. (2011) berichten, dass mit einem weiteren Anstieg des Biomasseanbaus gerechnet werden muss, der womöglich erst im Jahr 2030 bei einem Flächenumfang von 4200000 ha stagnieren wird. „Für Kurzumtriebsplantagen, also zum Anbau von Pflanzen für Festbrennstoffe, werden 0,9 Mio. ha „reserviert“ (Nitsch et al. 2011).
Die aktuellen Auswirkungen der bereits erfolgten Erweiterung des Biomasseanbaus bestehen in der flächigen Ausbreitung von verengten Fruchtfolgen bis hin zu mehrjährigem Anbau von nur einer Feldfrucht, z.B. acht Jahre Mais auf derselben Fläche (M. Flade, mdl. Mitt. 2014), im zunehmenden Umbruch von Grünland und der Intensivnutzung von Brachflächen. Damit verbunden ist zugleich ein erhöhter Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln (BfN 2010). Daraus resultierende Beeinträchtigungen der Biodiversität zeigen sich in dem Verlust von Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten des Agrarraumes, wobei die Avifauna, beispielsweise Bodenbrüter wie Feldlerche (Alauda arvensis; Flade 2012) und Rebhuhn (Perdix perdix; Gottschalk & Beeke 2012), sowie Wildkräuter, Insekten und andere Wirbellose (Willms et al. 2009) besonders betroffen sind. Weiterhin fallen Verbundstrukturen, z.B. Ackerraine und andere Flurelemente, der Ausweitung des Biomasseanbaus zum Opfer. Wanderkorridore und Trittsteinbiotope gehen dadurch verloren – wodurch Arten die genetische Isolation ihrer Populationen droht. Schutzgebiete innerhalb und in Nachbarschaft zu intensiven Agrarlandschaften verlieren ohne wirksame Vernetzung ihre Funktion als Kerngebiete des Biotopverbunds (Mannsfeld et al. 2012).
Die Anlage von Gehölz-Kurzumtriebsplantagen (KUP) auf Intensiv-Ackerstandorten mit geringen Konfliktpotenzialen für Natur und Landschaft wird seit einigen Jahren als eine Alternative zu anbauintensiven Energiepflanzen diskutiert.
Unter KUP werden mehrjährige landwirtschaftliche Dauerkulturen mit Anpflanzungen schnellwüchsiger ausschlagfähiger Gehölze verstanden, die in kurzen Zyklen von zwei bis sieben Jahren (energetische Verwertung) oder zehn bis 20 Jahren (stoffliche Verwertung) geerntet werden. Es sind in der Regel Monokulturen aus einheimischen oder gebietsfremden Arten oder Hybriden, meist allochthonen Herkünften oder ausgewählten Klonen, welche die Wuchsleistungen von klassischen Hochwaldbeständen weit übertreffen (Schmidt & Gerold 2008, Thomasius 1980, Wilhelm 2013).
Trotz vielfacher Vorteile, die durch die Holznutzung von KUP als Energieträger bestehen, sind KUP immer noch ein sozio-kulturell nicht verankertes und politisch wenig unterstütztes Nischenprodukt aus unterschiedlichster individueller Motivation (AgroForNet 2013, 2014; vgl. auch Anders & Fischer 2013). In diesem Spannungsfeld entstand die vorgelegte Arbeit.
Ziel und Inhalt unseres Beitrags ist es, die Umweltauswirkungen von KUP an Hand recherchierter aktueller Ökobilanzdaten mit anderen Formen der regenerativen Energieerzeugung zu vergleichen. Es wird der Frage nachgegangen, welche Rolle KUP in dem weiten Feld der „Erneuerbaren Energien“ in Gegenüberstellung mit dem „Strommix Deutschland“ spielt, d.h. dem deutschen Energieträgermix. Dieser gibt die Höhe und durchschnittliche Zusammensetzung der Primärenergieformen zur Deckung des gesamten Energiebedarfes wieder. Die Kennzeichnung erfolgt gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz. Der Energieträgermix Deutschland wird vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) erhoben und ist in der jährlichen (auch privaten) Stromrechnung nachzulesen. Danach setzt sich der Energieträgermix für 2010 wie folgt zusammen: Kernkraft 24,5 %, Kohle 42,5 %, Erdgas 11,7 %, sonstige fossile Energieträger 3,3 % und erneuerbare Energien 14,9 % (BDEW 2011).
Die sich daran anschließende SWOT-Analyse dient nicht nur dem Herausarbeiten von positiven und negativen Aspekten des Anbaus von KUP-Holz zur energetischen Verwertung. Sie leistet auch einen Beitrag zur naturschutzfachlichen Ziel- und Positionsbestimmung.
2 Verwendete Grundkonzepte und Verfahren
2.1 Ökobilanzen
Die Ökobilanz ist ein systemanalytisches Verfahren zur Erfassung und Beurteilung umweltrelevanter Sachverhalte. Ursprünglich vor allem zur Bewertung von Produkten entwickelt, wird sie heute auch bei Prozessen, Dienstleistungen und Verhaltensweisen angewendet (UBA 2014). Bei der Ökobilanz handelt es sich derzeit um die „einzige international genormte Methode zur Analyse der Umweltaspekte und potenziellen Wirkungen von Produktsystemen“ (Klöpffer & Grahl 2009).
2.2 SWOT-Analyse
Mit Hilfe der aus der Betriebswirtschaftslehre entlehnten Methode der SWOT-Analyse werden hier am Fallbeispiel „erneuerbare Energien“ Stärken (Strength), Schwächen (Weeks), Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) bei der Erzeugung von Energie mittels Dendromasse aus KUP identifiziert und in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst.
Die Ergebnisse der SWOT-Analyse dienen einer als dringend notwendig erachteten Positionsbestimmung im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung der Energieproduktion mittels KUP-Holz. Die Durchführung der SWOT-Analyse erfolgte auf Grundlage der Untersuchungen zu Ökobilanzen (Abschnitt 3), eigener Forschungsarbeiten, Studien, Fach- und Positionspapieren (z.B. Bastian et al. 2010, DBU 2010, Hildebrandt & Ammermann 2012, NABU 2008) sowie den Ergebnissen der Status- und Abschlusskolloquien zum AgroForNet-Projekt am 06./07. Februar 2013 und 21. Mai 2014. AgroForNet ist das Projekt „Nachhaltige Entwicklung ländlicher Regionen durch die Vernetzung von Produzenten und Verwertern von Dendromasse für die energetische Nutzung“, welches vom BMBF im Rahmen des Förderschwerpunkts „Nachhaltiges Landmanagement – Modul B“, FKZ 033L024, gefördert wurde.
3 KUP im Vergleich mit anderen Energieträgern: Ergebnisse der Analyse ausgewählter Wirkungskategorien
Die Stellung von KUP in dem weiten Feld der „Erneuerbaren Energien“ und in Gegenüberstellung zum „Strommix Deutschland“ wurde mit Hilfe ausgewählter Ergebnisse von Ökobilanzen ermittelt. Dazu sind folgende Wirkungskategorien verglichen worden: kumulierter Energieaufwand (KEA), Treibhausgasemissionen (THG) und Versauerungspotenzial. Die dargestellten Ergebnisse stammen, wenn nicht anders angegeben, aus der (Ende 2013 aktualisierten) Probas-Datenbank (UBA 2014) und aus den drei bis 2013 durchgeführten Ökobilanzen zu KUP: Rödl (2008) sowie Rödl & Schweinle (2010), Steinfeld (2008), Burger (2010).
kumulierter Energieaufwand
Der KEA ist ein wichtiger Kennwert für die ökologische Bewertung von Produkten und Dienstleistungen (VDI 4600). Der KEA stellt den Primärenergieverbrauch bei der Herstellung von für uns nutzbarer Energie dar. So ermöglicht er eine energetische Beurteilung und einen Vergleich zwischen Alternativen. Die Methode des KEA ist weltweit anwendbar. Jedoch kann der Energieverbrauch, der durch die eindimensionale Kennzahl dargestellt wird, kein umfassendes Bild aller Umweltwirkungen bieten.
Die Ergebnisse zeigen, dass KUP wie auch die anderen hier ausgewerteten „Erneuerbaren Energien“ im Vergleich zum „Strommix Deutschland“ ein um ein Vielfaches geringeren KEA besitzt (Abb. 2). Dieser in der Öffentlichkeit wenig diskutierte Sachverhalt zeigt auch bei vorsichtiger Interpretation den Vorteil von KUP wie auch der anderen hier betrachteten Erneuerbaren Energien: Erheblich geringerer Ressourcenverbrauch gegenüber dem „Strommix Deutschland“.
Treibhausgasemissionen
Es besteht international ein wissenschaftlicher Konsens, dass der weltweite Temperaturanstieg auf 2°C begrenzt werden muss, um unerwünschte Klimaauswirkungen zu verhindern (KOM 2010). Hinsichtlich dieses Ziels hat der Europäische Rat im Kontext ähnlicher Maßnahmen anderer Industriestaaten eine Verringerung der Treibhausgasemissionen in der EU bis 2050 um 80–95 % gegenüber den Werten von 1990 gefordert (KOM 2010). Der EU-Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft zeigt, dass alle Sektoren und Treibhausgase, auch die fluorierten Treibhausgase (F-Gase), deren Treibhauspotenzial bis zu 23000-mal höher sein kann als das von CO2, einen Beitrag leisten müssen, damit dieses Ziel möglichst kostengünstig erreicht wird (KOM 2010).
Durch den Einsatz „Erneuerbarer Energien“ können offensichtlich die Treibhausgasemissionen erheblich gesenkt werden (Abb. 3). Deutlich wird aber auch, dass Düngung die Treibhausgasemissionen bei KUP und Biogas enorm ansteigen lässt, jedoch liegen die Werte immer noch um ca. 50 % niedriger als beim „Strommix Deutschland“.
Versauerungspotenzial
Versauerungspotenzial ist das mögliche Ergebnis der Aggregation von versauernd wirkenden Luftschadstoffen, ausgedrückt in massebezogenen SO2-Äquivalenten. Es gehört derzeit zu den wichtigsten Umweltindikatoren (UBA 2014).
Im Zusammenhang mit der Versauerung werden durch KUP und Biomasse keine Einsparpotenziale festgestellt. Bei der Bioenergieerzeugung unter Einsatz von Stickstoffdüngung kommt es zu einer leicht höheren Freisetzung versauernder Emissionen als beim „Strommix Deutschland“. Im Falle von Biogasanlagen kommen außerdem versauernde Emissionen aus der Lagerung der Substrate, aus der Biogaserzeugung selbst und aus der Verbrennung unerwünschter Nebenprodukte bei der Stromerzeugung hinzu, wodurch ein vergleichsweise hohes Versauerungspotenzial bei der Biogaserzeugung bewirkt wird.
4 Anbau von KUP-Holz zur energetischen Verwertung – Ergebnisse der SWOT-Analyse zur Positionsbestimmung
Die Stärken landwirtschaftlicher Dendromasseerzeugung (Tab. 1) für die energetische Verwertung mittels KUP liegen darin, dass sie als alternative Energiequelle einen Beitrag zur Substitution fossiler Energieträger und zum Klimaschutz leisten kann. Als Stärken wurden dann vor allem Natur- und Umweltschutzaspekte identifiziert: Stabilisierung des Nährstoffhaushalts, Verminderung von Erosion und der im Vergleich zu intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen nachgewiesene höhere Artenreichtum.
Die Hauptursache der identifizierten Schwächen ist die fehlende Akzeptanz bei den Landwirten, die in erster Linie aus den gegenwärtigen wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen resultieren. Sie sind keine Konsequenz aus Naturschutz- und landschaftsökologischen Sachverhalten. Notwendig wären beispielsweise eine verbindliche Beschreibung der guten fachlichen Praxis und die Vereinfachung der daran gebundenen Förderinstrumente. Verbindliche europäische Nachhaltigkeitskriterien und nationale Nachhaltigkeitsstandards würden einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Akzeptanz leisten.
Die Chancen der Produktion von KUP-Holz für die energetische Verwendung ergeben sich langfristig durch die voraussichtlich steigende Nachfrage nach Energieholz sowie den Aufbau regionaler Energiekreisläufe. Hinzu kommen Chancen, die in der Strukturanreicherung ausgeräumter Landschaften und den vielfältigen Möglichkeiten zur naturschutzfachlichen und landschaftsökologischen Optimierung und Aufwertung liegen und damit rückkoppelnd die Stärken stärken sowie Risiken vermeiden.
Risiken können durch eine Vielzahl von Maßnahmen gemieden werden. Dazu gehören die Verwendung geeigneter standortsgerechter, einheimischer Gehölze und bevorzugt kleinflächiger oder streifenweiser Anbau. Bei großflächigem Anbau werden versetzte Erntetermine und eine Vielzahl von Maßnahmen zur Strukturanreicherung empfohlen. (ausführlich in Denner et al. 2013). Auf naturschutzfachlich wertvollen Flächen der Offenlandschaft ist die Anlage von KUP zu unterlassen.
Ergebnis
Insgesamt belegen die Ergebnisse der SWOT-Analyse (Tab. 1) sowohl vielfältige Synergien als auch Risiken zwischen Naturschutz und der Erzeugung von Energie mittels Dendromasse aus KUP. Sie belegen aber auch deutlich, dass eine mögliche positive Bilanz von KUP sich überwiegend über Natur- und Umweltschutzaspekte entscheidet.
5 Diskussion
Naturschutz befindet sich heute im Spannungsfeld hoher öffentlicher Wertschätzung auf der einen Seite und erheblicher Konflikte bei der Integration und Umsetzung von Naturschutzzielen und -projekten auf der anderen Seite. Dies ist, wie unsere Recherche ergab, auch im Zusammenhang mit der Beurteilung der Erzeugung von Energie mittels Dendromasse aus KUP nicht anders. KUP produzieren in mehreren Rotationen das Naturgut Dendromasse und leisten als alternative erneuerbare Energiequelle einen Beitrag zur Substitution fossiler Energieträger und zum Klimaschutz (Feldwisch 2011). Jedoch gibt es bisher keine Untersuchungen zu Erfassung und Bewertung der Umweltauswirkungen von KUP im Rahmen von Ökobilanzen, die auch naturschutzfachliche Aspekte umfassend berücksichtigen.
Möglicherweise sind in dem Entwurf der EU-Kommission deshalb KUP und KUP-Hackschnitzel zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte (COM 2013) nicht aufgeführt und auch im Anhang 1, in dem die Methoden zur Berechnung von Treibhausgasbilanzen umfangreich vorgestellt werden, nicht berücksichtigt. Ziel der COM (2013) ist es, für die Entwicklung von europaweiten verbindlichen Nachhaltigkeitskriterien Hinweise zu geben, die nicht nur das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarktes sicherstellen, sondern auch, dass die hauptsächlich in der EU konsumierte feste und gasförmige Biomasse dazu dient, signifikant Treibhausgase zu reduzieren, Rohstoffe nicht auf geschützten Flächen zu produzieren und forstliche Biomasseressourcen nachhaltig in Übereinstimmung mit internationalen Prinzipien und Kriterien zu bewirtschaften.
Die hier vorgestellten Ergebnisse von Ökobilanzen der Energiebereitstellung von Dendromasse aus KUP und anderer ausgewählter erneuerbarer Energien im Vergleich zum aktuellen „Strommix Deutschland“ belegen, dass durch den Einsatz von Dendromasse aus KUP bei Betrachtung des gesamten Wirtschaftszyklus erhebliche Minderungspotenziale für ausgewählte Wirkungskategorien wie THG-Emissionen oder KEA bestehen.
Jedoch muss hier auf einen kritischen und differenzierten Umgang mit den ermittelten Potenzialen hingewiesen werden! Während Größen wie der Verbrauch abiotischer Energieressourcen relativ einfach ermittelt und in Zahlenwerten ausgedrückt werden können, ist die Darstellung komplexer ökologischer Zusammenhänge deutlich schwieriger. Das gilt insbesondere für Indikatoren wie Biodiversität, Landschaftsverbrauch, Landschaftswandel und Landschaftsbild (vgl. Tab. 1). Zudem kann allein der Einsatz von Düngemitteln in KUP die beschriebenen positiven Effekte im Vergleich zu Biogas weitestgehend aufheben. Vor diesem Hintergrund muss auch auf die Gefahr verkürzter Betrachtungen der Umweltauswirkungen regenerativer Energien gewarnt werden. Durch die selektive Betrachtung von Treibhausgasbilanzen bzw. Emissionseinsparungen gegenüber konventionellen Energieträgern sind in jüngster Vergangenheit durch Beschönigung und werbewirksame Aufbereitung Begriffe wie CO2-neutral (Bode & Lüdeke 2007), klimaneutral (Platz 2 bei der Wahl des „Unworts des Jahres 2007“) oder emissionsfrei entstanden. Diese Bewertung wäre bei einer vollständigen Betrachtung aller Umweltauswirkungen bei der Energieerzeugung bzw. korrekter Umwandlung in eine für uns nutzbare Energie durch geeignete Technologien ausgeschlossen.
Ergebnisse der SWOT-Analyse belegen sowohl vielfältige Synergien als auch Risiken zwischen Naturschutz und der Erzeugung von Energie mittels Dendromasse aus KUP. Sie unterstreichen nachdrücklich, dass eine mögliche positive Bilanz von KUP sich überwiegend über Natur- und Umweltschutzaspekte entscheidet. Zur Positionsbestimmung gehört ebenso der hohe Kapazitätskredit der mittels KUP erzeugter Dendromasse, aber auch die relativ hohe Flächeninanspruchnahme und den damit verbundenen Problemen. Eine deutliche Ausweitung ohne Berücksichtigung von Natur- und Umweltschutzbelangen wäre risikobehaftet, sei es durch die verstärkte Nutzungskonkurrenz, das verringerte Habitatangebot für Offenlandarten, die Gefährdung von Arten und Biotopen auf zuvor extensiv bewirtschafteten Flächen oder die Monotonisierung des Landschaftsbildes (vgl. Denner et al. 2013).
Naturschutz hat hier die seltene Chance, zum Treiber der Entwicklung und Etablierung naturverträglicher Formen erneuerbarer Energien zu werden.
Literatur
Ammermann, K. (2013): Die Energiewende: Eckpunkte, Tendenzen und Herausforderungen. In: TU Dresden, Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung, Hrsg., Dresdner Planergespräche „Reparieren-Steuern-Gestalten? Eingriffsregelung in der Energiewende“, Tagungsbericht zur wissenschaftlichen Arbeitstagung am 22. Juni 2012, Dresden, 11-23.
Anders, K., Fischer, L. (2013): Holzwege in eine neue Landschaft? Perspektiven für holzige Biomasse aus der Sicht von Akteuren. Oderaue Aufland, 267S.
Bastian, O., Lupp, G. (2013): Auswirkungen des Energiepflanzenanbaus auf Natur und Landschaft. In: Fleischer, B., Syrbe, R.-U., Red., Nachhaltige Nutzung von Energiepflanzen für eine regionale Entwicklung im Landkreis Görlitz – ein Handlungsleitfaden, Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, 20-26.
–, Neruda, M., Filipova, L., Machova, I., Leibenath, M. (2010): Natura 2000 Sites as an Asset for Rural Development; The German-Czech Ore Mountains Green Network Project. Journal of Landscape Ecology 3 (2), 41-58.
Bode, S., Lüdeke, F. (2007): CO2-neutrales Unternehmen – was ist das? Umweltwirtschaftsforum 15 (4), 265-273.
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW, 2011): Datenerhebung 2010-Bundesmix 2010. http://bdew.de/internet.nsf/id/1E7BD75876AE0D08C1257823003ED8C4/$file/2011-10-06 %20Bundesmix%202010%20Stromkennzeichnung.pdf (09.04.2014).
BfN (Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., 2010): Bioenergie und Naturschutz. Synergien fördern, Risiken vermeiden. Bonn, 32S.
Burger, F.J. (2010): Bewirtschaftung und Ökobilanzierung von Kurzumtriebsplantagen. Diss. TU München, 166S.
COM (European Commission, 2013): Proposal for a Directive of the European Parliament and the council on sustainability criteria for solid and gaseous biomass used in electricity and/or heating and cooling and biomethane injection into the natural gas network. http://www.endseurope.com/docs/130819a.pdf (19.02.2014).
DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Hrsg., 2010): Handlungsempfehlungen für die naturverträgliche Produktion von Energieholz in der Landwirtschaft. Ergebnisse aus dem Projekt NOVALIS. Osnabrück, 74S.
Denner, M., Wilhelm, E.-G., Gericke, H.-J. (2013): Naturschutz und Biomasseanbau unter besonderer Berücksichtigung von Kurzumtriebsplantagen. UVP-report 27 (1+2), 106-112.
DNT (Deutscher Naturschutztag, 2012): Abschlusserklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 31. Deutschen Naturschutztages 2012 in Erfurt. 10S.
Feldwisch, N. (2011): Umweltgerechter Anbau von Energiepflanzen. In: Abschlussbericht des Verbundvorhabens „Rahmenbedingungen und Strategien für einen an Umweltaspekten ausgerichteten Anbau der für Sachsen relevanten Energiepflanzen“, http://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/15109 (09.04.2014).
Flade, M. (2012): Von der Energiewende zum Biodiversitäts-Desaster – zur Lage des Vogelschutzes in Deutschland. Vogelwelt 133, 149-158.
FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, 2012): Anbau nachewachsender Rohstoffe in Deutschland. http://www.nachwachsenderohstoffe.de/fileadmin/fnr/Presse/Anbau_Grafik_Kurve _2012_1.jpg (19.02.2013).
Gottschalk, E., Beeke, W. (2012): Leitfaden für ein Rebhuhnschutzprojekt. Abteilung Naturschutzbiologie der Universität Göttingen, unveröff. Mskr.
IINAS (Internationales Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und strategien, 2014): http://www.iinas.org/gemis-download-de.html (05.03.2014).
Hildebrandt, C., Ammermann, K. (Bearb., 2012): Energieholzanbau auf landwirtschaftlichen Flächen. Auswirkungen von Kurzumtriebsplantagen auf Naturhaushalt, Landschaftsbild und biologische Vielfalt. Anbauanforderungen und Empfehlungen des BfN. Bonn-Bad Godesberg, 18S.
KOM (Europäische Kommission, 2010): Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über Nachhaltigkeitskriterien für die Nutzung fester und gasförmiger Biomasse bei der Stromerzeugung, Heizung und Kühlung. Amt für Amtliche Veröff. der Europ. Gemeinschaften, Luxemburg, 22S.
Klöpffer, W., Grahl, B. (2009): Ökobilanz (LCA): Ein Leitfaden für Ausbildung und Beruf. Wiley, Weinheim, 440S.
Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften (Hrsg., 2012): Bioenergie: Möglichkeiten und Grenzen. Halle (Saale), 16S.
Mannsfeld, K., Slobodda, S., Wehner, W. (2012): Erneuerbare Energien. Grenzen der Energiewende für den Landschaftsschutz. Herausgegeben durch den Landesverein Sächsischer Heimatschutz unter Federführung des Fachbereiches Naturschutz/Landschaftsgestaltung, Dresden, 11S.
Nitsch, J., Pregger, T., Scholz, Y., Naegler, T., Sterner, M., Gerhardt, N., Oehsen, A. von, Pape, C., Saint-Drenan, Y.E., Wenzel, B. (2011): Leitstudie 2010. http://www.fvee.de/fileadmin/politik/bmu_leitstudie2010.pdf (09.04. 2013).
NABU (Naturschutzbund Deutschland, 2008): Energieholzproduktion in der Landwirtschaft. Chancen und Risiken aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes. Berlin.
Rödl, A. (2008): Ökobilanzierung der Holzproduktion im Kurzumtrieb. http://literatur.vti.bund.de/digbib_extern/bitv/dk040790.pdf (03. 04.2013).
–, Schweinle, M. (2010): Ökobilanz des Anbaus von Kurzumtriebsplantagen sowie der energetischen Verwendung des Holzes. In: Bemmann, A., Knust, C., Hrsg., AGROWOOD – Kurzumtriebsplantagen in Deutschland und europäische Perspektiven, Weißensee, Berlin, 189-207.
Schmidt, P.A., Gerold, D. (2008): Kurzumtriebsplantagen – Ergänzung oder Widerspruch zur nachhaltigen Waldwirtschaft? Schweiz. Z. Forstwesen 159 (6), 152-157.
Schulze, E.-D., Körner, C. (2012): Nettoprimärproduktion und Bioenergie. In: Nationale Akademie der Wissenschaften: Bioenergy – Chances and Limits, Halle (Saale), 90-101.
Spandau, L., Luberstetter, S. (2012): Ein Jahr nach der Energiewende – zur Zukunft der Energieversorgung in Deutschland. Benediktbeurer Gespräche der Allianz Umweltstiftung 16, 105S.
Steinfeld, M. (2008): Ökologische Bewertung des Zukunftsrohstoffs Dendromasse. In: Murach D., Knur, L., Schultze, M., DENDROM – Zukunftsrohstoff Dendromasse, Kessel, Remagen-Oberwinter, 371-386.
Thomasius, H. (1980): Baumplantagen zur Holzproduktion aus ökologischer und waldbaulicher Sicht. In: Probleme und methodische Fragen der Plantagenwirtschaft mit forstlichen Baumarten, Wissenschaftliche Tagung der Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft der DDR, Bezirk Dresden, 13-24.
UBA (Umweltbundesamt 2014): Zum ProBas-Projekt. http://www.probas.umweltbundesamt.de (05.03.2014).
von Haaren, C., Palmes, C., Boll, T., Rode, M., Reich, M., Niederstadt, F., Albert, C. (2013): Erneuerbare Energien – Zielkonflikt zwischen Natur- und Umweltschutz. Jb. Natursch. Landschaftspl. 59, 18-33.
Wilhelm, E.G. (2013): Chancen und Grenzen von Kurzumtriebsplantagen als Kompensationsmaßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht. In: TU Dresden, Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung, Hrsg., Dresdner Planergespräche „Reparieren-Steuern-Gestalten? Eingriffsregelung in der Energiewende“, Tagungsbericht zur wissenschaftlichen Arbeitstagung am 22. Juni 2012, Dresden, 91-101.
Willms, M., Glemnitz, M., Hufnagel, J. (2009): Entwicklung und Vergleich von optimierten Anbausystemen für die landwirtschaftliche Produktion von Energiepflanzen unter den verschiedenen Standortbedingungen Deutschlands (EVA). Schlussbericht zu Teilprojekt II: „Ökologische Folgewirkungen des Energiepflanzenanbaus“ an die FNR (FKZ: 22002405). Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Institut für Landnutzungssysteme, 155S.
Anschriften der Verfasser(innen): Dr. Eckehard-Gunter Wilhelm, Philipp Mähler und Franziska Nych, Professur für Biodiversität und Naturschutz, Pienner Straße 7, D-01737 Tharandt, E-Mail wilhelm@forst.tu-dresden.de bzw. philipp.maehler@freenet.de bzw. franziska.nych@forst.tu-dresden.de; Dr. habil. Susanne Winter, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Fachbereich für Wald und Umwelt, Fachgebiet Angewandte Ökologie und Zoologie, Alfred-Möller Straße1, D-16225 Eberswalde.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

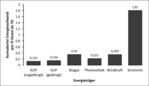



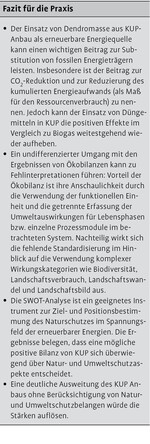
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.