Ein neues Nationalparkprogramm für Deutschland
Abstracts
Nationalparke erlangen vor dem Hintergrund des globalen Artenschwunds als Instrument zur Umsetzung der Ziele der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ herausragende Bedeutung. Große nutzungsfreie Schutzflächen sind als Rückzugs-, Reproduktions- und Ausbreitungszentren für Tier- und Pflanzenpopulationen und damit zur Sicherung der Artenvielfalt unverzichtbar. Zudem wären sie auch ein geeignetes Element zum Aufbau eines nationalen Wald-Verbundsystems. Dieser Aspekt wurde in bisherigen Konzepten noch zu wenig berücksichtigt. Da Deutschland von Natur aus mit hohen Flächenanteilen hauptsächlich Buchen- und Buchenmischwälder beherbergen würde, wäre allein aus Repräsentativitätsgründen eine verstärkte Ausweisung von Buchenwald-Nationalparken geboten. Zurzeit weisen aber nur drei von 15 Nationalparken in Deutschland überdurchschnittlich hohe Buchenwald-Anteile auf. Im Rahmen einer Studie von Greenpeace werden Vorschläge für weitere zehn Großschutzgebiete im potenziellen Buchenwaldareal vorgestellt, die eine Suchraumfläche von insgesamt rund 146500ha umfassen. Davon wurde ein Vorschlag in Baden-Württemberg (Schwarzwald) zwischenzeitlich umgesetzt. Ergänzend werden weitere 107000ha für kleinere Schutzflächen im Rahmen eines anzustrebenden Verbundsystems von Buchenwäldern vorgeschlagen. Mit diesen Flächenanteilen könnte ein wesentlicher, fachlich fundierter Beitrag zur Erfüllung des 5- %-Ziels der Biodiversitätsstrategie geleistet werden.
New Programme for National Parks in Germany – Integral part of a network system of beech forests
Against the background of global species decline national parks have an outstanding importance as instrument to implement the aims of the “National Strategy on Biological Diversity”. Large protection areas without use are indispensable as areas for retreat, reproduction and dispersal of plant and animal populations, and hence are preconditions for the safeguarding of biodiversity. At the same time they could serve as suitable elements for the establishment of national network system of forests. This aspect has not been given sufficient consideration so far in existing concepts. Since Germany by nature would largely be covered by beech or mixed beech forests the increased designation of beech forest national parks would be appropriate. At present, however, only three out of 14 national parks in Germany hold shares of beech forests above average. A research project of Greenpeace proposed ten additional large protection areas in the potential area of beech forests covering a search area of altogether about 146 to 500 ha. One of these proposals has meanwhile been realised (Black Forest). Additionally the study suggests 107,000 ha of smaller protection areas in the context of a network system of beech forests. These area shares could help to provide a significant and substantiated contribution to the fulfilment of the five percent target of the National Strategy on Biological Diversity.
- Veröffentlicht am
1 Einleitung
Nationalparke stellen international und auf nationaler Ebene vielleicht das wichtigste Naturschutzinstrument dar, das in letzter Zeit aufgrund der aktuell laufenden Nationalpark-Debatten in einigen Bundesländern und vor dem Hintergrund der Umsetzung der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Für das darin verfolgte Ziel, 5 % der Wälder und generell 2 % der Gesamtfläche Deutschlands als „Wildnisflächen“ aus der Nutzung zu nehmen, sind Nationalparke als Umsetzungsinstrument hervorragend geeignet.
Allerdings ist die bisherige Ausweisungspraxis unbefriedigend. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz sind lediglich 0,54 % der Landfläche Deutschlands als Nationalparke geschützt (davon nur 50 % als tatsächlich nutzungsfreie Kernzonen). Inklusive der Nationalpark-Kernzonen sind nur 0,7 % der deutschen Landfläche als Wildnis-Gebiete ausgewiesen und damit quantitativ noch meilenweit von dem 2- %-Ziel der Biodiversitätsstrategie entfernt. Im Waldbereich sind momentan nach neuesten Studien lediglich 1,9 % (=213145ha) als Flächen für die natürliche Waldentwicklung gesichert ( http://www.nw-fva.de/nwe5 ), wobei von diesen nutzungsfreien Waldflächen nur rund 84000 ha unter Nationalparkschutz stehen.
Auch ist das bisherige Vorgehen bei der Verwirklichung von Nationalparkprojekten je nach Engagement der einzelnen Bundesländer meist eher dem „politischen“ Zufall überlassen und weitgehend von ehrenamtlich arbeitenden Initiativen geprägt, die häufig vor Ort in jahrelang andauernde Kontroversen verstrickt sind (siehe Panek 2006 am Beispiel „Kellerwald-Edersee“). Bisherige konzeptionell begründete „Nationalparkprogramme“ (siehe Bibelriether et al. 1997, Diepolder 1997, Erz & Henke 1977) wurden über ihren fachlichen Ansatz hinaus auf administrativer Ebene nicht weiterentwickelt.
Bei der Ausweisung von Nationalparken kaum beachtet wurden bislang außerdem Aspekte eines regionalen und überregionalen Biotopverbunds. Große nutzungsfreie Schutzgebiete sind in derartigen Verbundsystemen von überragender zentraler Bedeutung, da sie vor allem für Tierpopulationen aufgrund der ökologischen Flächenkapazitäten überlebenswichtige Rückzugs-, Reproduktions- und Ausbreitungszentren darstellen und damit letztlich auch ein unverzichtbares Grundgerüst zur Erhaltung der Artenvielfalt in Deutschland bilden. Bei zukünftigen Überlegungen sollten Nationalparke daher vorrangig als eine Art „Grund-Infrastruktur“ für den nationalen Erhalt der Biotop- und Artenvielfalt betrachtet werden. Große nutzungsfreie Wälder führen darüber hinaus vor dem Hintergrund des Klimawandels zu einer deutlichen Erhöhung der holzgebundenen Kohlenstoffvorräte (Kaiser 2011).
Da Deutschland von Natur aus zu über 90 % mit Wald und zu mehr als 65 % mit Buchenwäldern bestockt wäre, läge es aus Repräsentativitätsgründen nahe, eine entsprechend hohe Zahl an Buchenwald-Nationalparken einzurichten. In einer 2011 von Greenpeace veröffentlichten Studie wurden hierzu Schutzvorschläge erarbeitet (Panek 2011). Der nachfolgende Beitrag konzentriert sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse dieser Studie als Grundlage eines neuen, verbundbezogenen Nationalparkprogramms.
2 Grundzüge eines Nationalparkprogramms
Die Grundforderung nach einem einheitlichen, „programmatischen“ Nationalpark-Schutzsystem für Deutschland wurde schon in den 1970er Jahren von Erz & Henke (1977) erhoben. Konkretere Vorstellungen, wie ein solches System aussehen könnte, wurden danach im Rahmen einer Studie des Bundesamtes für Naturschutz veröffentlicht (Bibelriether et al. 1997).
Nationalparke sollten demnach großräumig die charakteristischen Natur-Landschaftstypen eines Landes möglichst vollständig repräsentieren. Nach Diepolder & Wimmer (1994) und Diepolder (1997) ist Deutschland durch drei naturräumlich unterschiedliche Großlandschaften charakterisiert:
durch das eiszeitlich geprägte Norddeutschland einschließlich der Meeres- und Küstenbereiche an Nord- und Ostsee;
durch den Gürtel der deutschen Mittelgebirge sowie
durch das ebenfalls glazial geprägte, alpine Süddeutschland.
Daraus wiederum lassen sich sechs naturräumliche Großeinheiten (Meere/Küsten, Norddeutsches Tiefland, westliche und östliche Mittelgebirge einschließlich Harz und Schwarzwald, süddeutsches Schichtstufenland, Alpenvorland und Alpen) ableiten, die ihrerseits 20 großräumige, repräsentative Landschaftselemente (Ökosysteme) beherbergen.
Derzeit besitzt Deutschland 15 Nationalparke. Im bisherigen System sehr gut repräsentiert sind die Meeres- und Küstenlandschaften in den drei Wattenmeer-Nationalparken an der Nordsee sowie durch die Nationalparke „Vorpommersche Boddenlandschaft“ und „Jasmund“ (Kreidefelsküste) an der Ostsee. Allerdings fordert Greenpeace in der „Ausschließlichen Wirtschaftszone“ (AWZ) einen bewirtschaftungsfreien Schutzflächenanteil von mindestens 40 %. Die bestehenden Meeresküsten-Nationalparke decken bei weitem nicht diesen Flächenanteil ab. Für alle Nationalparke generell gilt, dass nach den internationalen Standards mindestens 75 % der Schutzflächen als nutzungsfreie Naturzone eingerichtet werden sollten, was derzeit nur vier von 15 bestehenden Nationalparken umgesetzt haben.
In den anderen repräsentativen Großlandschaftsbereichen ist das bestehende Nationalparksystem zum Teil noch sehr lückenhaft, insbesondere in den südlichen Teilen der Mittelgebirge und im Alpenvorland. Der große alpine Bereich wird durch den einzigen Hochgebirgs-Nationalpark bei Berchtesgaden abgedeckt.
Von den 20 repräsentativen Landschaftselementen, die die deutschen Großlandschaften charakterisieren, sind insgesamt neun als Buchen- und Buchenmischwälder beschrieben (siehe Diepolder 1997). Dieser hohe Anteil verwundert nicht, da buchen-betonte Waldtypen von der Küste bis ins Hochgebirge potenziell-natürlich nahezu flächendeckend vorkommen würden. Buchen- und Buchenmischwälder bedeckten ursprünglich etwa 66 % der Landfläche Deutschlands; die heute noch übrig gebliebenen Reste konzentrieren sich vor allem im Gürtel der Mittelgebirge, wo die Rotbuche auch heute noch ihre optimalen Wuchsbedingungen vorfindet und weniger stark dezimiert wurde als im Tiefland.
Für immerhin 18 der 28 im Bereich der Territorialfläche Deutschlands potenziell vorkommenden Buchenwaldgesellschaften trägt unser Land europaweit die größte Schutzverantwortung, weil die Areale dieser Waldgesellschaften zu mindestens 50 % in Deutschland liegen (vgl. Bohn et al. 2003, Panek 2008).
Rotbuchenwälder spielen somit im anzustrebenden Nationalparksystem Deutschlands eine zentrale, herausragende Rolle, da sie innerhalb des Systems ein dominantes, prägendes Landschaftselement darstellen und somit ein spezifisches, nationales Naturerbe unseres Landes repräsentieren. Für dessen Schutz steht Deutschland weltweit in der Pflicht, nicht zuletzt auch aufgrund der im Jahr 2011 erfolgten Anerkennung von fünf ausgewählten, deutschen Buchenwald-Schutzgebieten als serielle UNESCO-Weltnaturerbestätten.
3 Schutz-Defizite
Rotbuchenwälder (Abb. 1) dokumentieren ein außergewöhnliches Beispiel für den seit dem Pleistozän in Gang befindlichen Ausbreitungsprozess dieses für Europa typischen Laubwald-Ökosystems. Von Natur aus würden sich 25 % des Weltareals der Rotbuchenwälder (das insgesamt 90 Mio. ha umfasst) in Deutschland befinden. Tatsächlich umfasst der heutige deutsche Buchenwaldbestand nur noch rund 1,6 Mio. ha (=7 % des ursprünglichen deutschen Areals). Nach Schätzungen des Bundesamtes für Naturschutz liegt der Anteil streng geschützter (nutzungsfreier) Buchenbestände bei lediglich rund 50000ha (=0,5 % der deutschen Waldfläche).
Von den 15 bestehenden Nationalparken enthalten zurzeit lediglich die folgenden acht Schutzgebiete bedeutende Buchenwald-Anteile, insgesamt rund 23500ha nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz:
Nationalpark Jasmund/Rügen (Mecklenburg-Vorpommern),
Müritz-Nationalpark/Teilfläche „Serrahn“ (Mecklenburg-Vorpommern),
Nationalpark Harz (Niedersachsen/Sachsen-Anhalt),
Nationalpark Hainich (Thüringen),
Nationalpark Kellerwald-Edersee (Hessen),
Nationalpark Eifel (Nordrhein-Westfalen),
Nationalpark Schwarzwald (Baden-Württemberg),
Nationalpark Bayerischer Wald (Bayern).
Von diesen wiederum sind allerhöchstens drei – Jasmund, Hainich und Kellerwald-Edersee – als „echte“ Buchenwald-Nationalparke (mit Buchen-Anteilen von über 50 %) anzusprechen.
Buchen- und Buchenmischwälder sind im bislang bestehenden deutschen Nationalparksystem also immer noch unterrepräsentiert. Deutliche Lücken sind im Bereich des Nordwestdeutschen Tieflands, in den südlichen Teilen des Mittelgebirgsgürtels (Schichtstufenland) und im Alpenvorland erkennbar. Größere Schutzgebietsausweisungen sind im nordwestlichen Tiefland und im Alpenvorland nicht mehr realisierbar, weil dort geeignete, ausreichend große Waldflächen weitestgehend erloschen sind.
Neben den Buchenwäldern weist das deutsche Nationalparksystem noch Defizite im Bereich der Moore und Stromtal-Auenwälder auf. Moore stellen vor allem im Norddeutschen Tiefland und im Voralpenland charakteristische Landschaftselemente dar. Potenziale zur Einrichtung von Moor-Nationalparken sind nur noch begrenzt vorhanden, z.B. in Nordwestdeutschland und im bayerischen Voralpengebiet (siehe Jeschke 2003).
Der einzige Auen-Nationalpark Deutschlands befindet sich bislang im „Unteren Odertal“ (mit Kernzonenanteilen von weit unter 50 %). Größere, möglicherweise nationalpark-geeignete Auen-Flächen liegen u.a. noch im Peenetal (Mecklenburg-Vorpommern) und im Taubergießen-Gebiet am Oberrhein.
Im Randalpenbereich wäre die Einrichtung eines zweiten Hochgebirgs-Nationalparks wünschenswert.
4 Das „Nationalprogramm“ als Bestandteil eines Verbundsystems von Buchenwäldern
Zur Füllung der aufgezeigten Lücken sind in Deutschland vor allem im Waldbereich noch relativ gute Flächenpotenziale vorhanden (siehe Fritz 1984, Heiss 1992, Panek 1999), die durch aktuelle Untersuchungen belegt werden (Walz et al. 2013). Danach existieren in Deutschland noch etwa 140 unfragmentierte Waldgebiete mit einer Mindestgröße von 5000ha. Mit einem für Greenpeace erstellten Gutachten (Panek 2011) wurde erstmalig der Versuch unternommen, einen konzeptionellen Verbund-Ansatz auch zur Umsetzung des 5- %-Ziels der „Nationalen Biodiversitätsstrategie“ zu entwickeln. Dabei geht es um den planvollen Aufbau eines Flächen-Systems, bestehend aus großen (>5000ha), mittelgroßen und kleinen Verbundelementen, die in ihrem jeweiligen Umfeld im Idealfall in eine den Prozessschutz fördernde Waldbewirtschaftung eingebettet sein sollten. Ausgangspunkt sind die besonders waldreichen Regionen Deutschlands, die innerhalb des Rotbuchen-Verbreitungsareals liegen und hinsichtlich ihrer Potenziale geeignet sind, das Grundgerüst eines nationalen, den Bestand sichernden Buchenwald-Verbunds zu bilden.
Bei den notwendigen Analyse- und Bewertungsschritten wurde auf die Ergebnisse bereits vorhandener Studien zurückgegriffen. Dabei bildete ein abgeschlossenes F+E-Vorhaben des Bundesumweltministeriums mit dem Titel „Verbreitung und Gefährdung schutzwürdiger Landschaften als Grundlage für die Entwicklung eines bundesweiten Biotopverbundsystems“ (Gharadjedaghi et al. 2004) die zentrale Grundlage. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse einer Untersuchung über großflächige, unzerschnittene Waldgebiete (Heiss 1992) sowie einer bundesweiten Erfassung der „historisch alten Waldstandorte“ (Glaser & Hauke 2004) für das Gutachten ausgewertet. Für die Bundesländer Niedersachsen und Hessen hat Panek (2012, 2013) im Auftrag von Greenpeace Vorschläge für die Umsetzung der Ziele der „Nationalen Biodiversitätsstrategie“ in größerer Detailschärfe heruntergebrochen.
Auf der Grundlage einer „Kulissen-Analyse“ wurden für den Aufbau eines Buchenwald-Verbundsystems abschließend insgesamt 75 national bedeutende Handlungsräume identifiziert, die eine Gesamtfläche von 4,5Mio.ha (=12,3 % der Bundesfläche) umfassen. In diesen Handlungsräumen beträgt der Anteil der Laubwälder (überwiegend Buchenwälder und andere Laubwaldtypen) nach Auswertung der CORINE-Land-Cover-Daten rund 816000ha. Zusammengenommen resultiert daraus ein Potenzial für große nutzungsfreie Schutzgebiete in der Größenordnung von rund 253500ha (Tab. 1 und 2).
Aufgrund der historischen Waldverluste vor allem im norddeutschen Raum sowie in Teilen Ostmitteldeutschlands und des süddeutschen Voralpenraumes ist ein vollkommen kohärenter Buchenwald-Verbund nicht mehr herstellbar. Auch sind zahlreiche, ehemals buchenwaldreiche Regionen durch den vor 200 Jahren massiv einsetzenden Nadelholzanbau degradiert. Für diese Defiziträume, in denen potenziell Rotbuchenwälder in hohen Flächenanteilen vorkommen würden, müssen separate Entwicklungskonzepte mit dem Schwerpunktziel des Waldumbaus erarbeitet werden.
5 Prioritäre Handlungsräume und „Schlüsselgebiete“
Für das Grundgerüst eines nationalen Verbundsystems von Waldgebieten spielen große nutzungsfreie Waldflächen als Kern- bzw. Schlüsselgebiete eine herausgehobene zentrale Rolle.
Wegen ihrer geschlossenen, waldgeprägten Flächenkomplexe sind dabei vor allem folgende Waldlandschaftseinheiten in Deutschland prioritär bedeutsam: Harz, Solling, Thüringer Wald, Rothaargebirge, Taunus, Spessart, Pfälzer Wald (Vogesen), Steigerwald, Schwarzwald, Bayerischer Wald (Böhmerwald), Bayerische Alpen. Insgesamt können 34 Waldlandschaftsräume als prioritäre Handlungsräume identifiziert werden, in denen die Ausweisung größerer Schutzgebiete aufgrund des Flächenpotenzials möglich wäre.
14 der genannten 34 prioritären Waldlandschaftsräume sind aktuell bereits mit hochwertigen, waldrelevanten Schutzgebietskulissen (Nationalparke, Biosphärenreservats-Kernzonen) ausgestattet. In vier dieser Regionen könnten die Kulissen zusätzlich erweitert werden (Müritz-Schorfheide, Niedersächsischer Harz, Pfälzer Wald und Bayerische Alpen) – im Bereich Müritz (Neustrelitzer Kleinseenland) gegebenenfalls durch Neuausweisung von großen nutzungsfreien Schutzflächen im Gebiet „Stechlinsee“ (Nationalparkvorschlag), im niedersächsischen Harz durch Erweiterung des bestehenden Nationalparks, im Pfälzer Wald durch die Erweiterung der bestehenden Kernzonen im dortigen Biosphärenreservat oder besser durch die Neuausweisung einer Nationalparkfläche, im bayerischen Alpenraum durch die Neuausweisung eines zweiten Alpen-Nationalparks (vorzugsweise im Teilgebiet „Ammergebirge“; siehe Fesq-martin 2013).
In insgesamt zehn Handlungsräumen wird aus fachlicher Sicht jeweils die Ausweisung eines neuen Wald-Nationalparks oder eines anderen großflächigen Schutzgebiets („Schlüsselgebiet“ mit über 5000ha Flächengröße) angeregt (siehe dazu Tab. 1).
Nach der gültigen IUCN-Definition dienen Nationalparke dem großräumigen Schutz natürlicher, ökologischer Prozesse, die in kleineren Schutzgebieten oder in Kulturlandschaften fehlen bzw. nicht ablaufen können (Europarc 2008). Das Schutzgebiet sollte so groß sein, dass die ökologischen Funktionen und Prozesse langfristig (und möglichst vollständig) aufrechterhalten werden können. Nach Auffassung der Autoren sollte dabei eine Netto-Mindestfläche (nutzungsfreie Naturzone) von 5000ha nicht unterschritten werden. Für die Ausweisung großflächig ungenutzter Schutzflächen im Wald kämen auch die Schutzkategorien Biosphärenreservat (mit Kernzonen) und Naturschutzgebiet in Frage.
Die in Tab. 1 näher vorgestellten Nationalpark-Suchräume bzw. Suchräume für andere „Schlüsselgebiete“ (> 5000 ha Größe) ergeben insgesamt eine Fläche von 146500ha und bilden damit 1,3 % der deutschen Waldfläche ab.
In 16 national bedeutenden Handlungsräumen sollten laut Greenpeace-Studie weitere Wälder in Naturschutzgebieten mit nutzungsfreien Kernzonen zwischen 1000 und 5000ha Größe als zusätzliches, stützendes Verbund-Element bzw. als Ergänzung zu den Nationalpark-„Schlüsselgebieten“ unter Schutz gestellt werden (Tab. 2). Diese Suchräume für ergänzende Naturschutzgebiete mit großen nutzungsfreien Kernzonen ergeben eine Gesamtfläche von rund 107000ha und bilden damit knapp 1 % der deutschen Waldfläche ab.
Ergänzend zur Tab. 2 wurden im Auftrag von Greenpeace e.V. für alle Naturräume in den Bundesländern Niedersachsen und Hessen repräsentativ weitere Suchräume für große ungenutzte Waldschutzgebiete ermittelt (Panek 2012, 2013). In Niedersachsen wurden insgesamt 32 Gebiete vorgeschlagen, wovon sich 25 Waldgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 40000 ha überwiegend bzw. anteilig im staatlichen Besitz befinden. In Hessen konnten insgesamt 21 geeignete Gebiete (=32290ha) im Staatswald als potenzielle Schutzgebiete identifizierten werden. Eine ähnliche Studie für Bayern ist in Arbeit.
Die im Rahmen des Greenpeace-Gutachtens (Panek 2011) ermittelten und in den Tab. 1 und 2 dargestellten Suchräume ergeben insgesamt eine Waldfläche von 253500ha =2,3 % der Wald-Gesamtfläche Deutschlands. Ihre Lage ist Abb. 2 zu entnehmen.
Zur Vervollständigung des Buchenwald-Verbundsystems müssten darüber hinaus verstärkt (als mittelgroße und kleinflächige Elemente) noch weitere Naturwaldreservate in einer Größenordnung von weiteren 1 bis 2 % der Gesamtwaldfläche bundesweit (vorzugsweise in den vorgeschlagenen Handlungsräumen) ausgewiesen werden (vgl. Scherzinger 1996).
6 Administrative Voraussetzungen und Instrumente zur Vervollständigung des bestehenden Nationalparksystems
Aufbau, Einrichtung und Umsetzung eines nationalen Schutz- und Verbundsystems für Buchenwälder bedürfen einer übergeordneten fachlichen Koordinierung auf Bundesebene und setzen eine Abstimmung der notwendigen Arbeits- und Verfahrensschritte voraus. Eine koordinierende Stelle könnte das Bundesamt für Naturschutz sein. Als Anreiz für die Umsetzung eines erweiterten Grundgerüsts von Nationalpark-„Schlüsselgebieten“ wäre die Einführung eines entsprechend zielgerichteten Bundesförderprogramms sinnvoll. Begleitend sollten finanzielle Anreize für prozessschutz-orientierte Waldbewirtschaftungskonzepte sowie für den Waldumbau geschaffen (und gegebenenfalls mit bereits bestehenden Förderprogrammen koordiniert) werden.
Im Bedarfsfall sollten vor jeder Nationalpark-Ausweisung intensive Informations- und Moderationsphasen nach dem Beispiel des Bundeslands Rheinland-Pfalz vorgeschaltet werden (Egidi 2015 in diesem Heft; Sommer 2014). Die Ausweisung großer Flächen für die natürliche Entwicklung birgt erfahrungsgemäß großes Konfliktpotenzial.
Die Verwaltung von Nationalparken sollte hauptsächlich aus naturschutzfachlich ausgebildetem und entsprechend qualifiziertem Personal bestehen. Die bisherige Praxis, Wald-Nationalparke mit fachfremden Kräften aus der Forstverwaltung auszustatten, sollte der Vergangenheit angehören.
Literatur
Bibelriether, H., Diepolder, U., Wimmer, B. (1997): Studie über bestehende und potenzielle Nationalparke in Deutschland. Angew. Landschaftsökol. 10, Bonn-Bad Godesberg.
Bohn, U., Gollub, G., Hettwer, C., Weber, H., Neuhäuslova, Z., Schlüter, H., (2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas – Erläuterungstext. Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Bonn-Bad Godesberg.
Diepolder, U. (1997): Zustand der deutschen Nationalparke im Hinblick auf die Anforderungen der IUCN. Diss. Techn. Univ. München.
–, Wimmer, B. (1994): Studie über bestehende und mögliche Nationalparke in Deutschland. Forschungsvorhaben (unveröff. Mskr.).
Egidi, H. (2015): Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald – partizipativer Auswahlprozess und naturschutzfachliche Qualität des ersten Nationalparks in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (1), 12-20.
Erz, W., Henke, H. (1977): Zur Möglichkeit von Nationalparken in der Bundesrepublik Deutschland. Natur und Landschaft 52 (1), 3-9.
Europarc (Hrsg., 2008): Richtlinien für die Anwendung der IUCN-Managementkategorien für Schutzgebiete. Deutsche Übersetzung, Berlin.
Fesq-martin, M. (2013): Ein Nationalpark für den König. Nationalpark 160, 24-27.
Fritz, B. (1984): Erhebung und Darstellung unzerschnittener, relativ großflächiger Wälder in der Bundesrepublik Deutschland. Natur und Landschaft 59 (7/8), 284-286.
Gharradjedaghi, B., Heimann, R., Lenz, K., Martin, C., Pieper, V., Schulz, A., Varhazadeh, A., Finck, P. Riecken, U. (2004): Verbreitung und Gefährdung schutzwürdiger Landschaften in Deutschland. Natur und Landschaft 79 (2), 71-81.
Glaser, F., Hauke, U. (2004): Historisch alte Waldstandorte und Hutewälder in Deutschland – Ergebnisse bundesweiter Auswertungen. Angew. Landschaftsökol. 61, Bonn-Bad Godesberg.
Greenpeace (Hrsg., 2013): Naturerbe Spessart ist in Gefahr – Greenpeace-Dokumentation der Holzeinschläge im Winter 2012/13 in den BaySF-Forstbetrieben Rothenbuch und Heigenbrücken. Hamburg.
Heinrich, C. (1996): Waldnaturschutzgebiete – Urwälder von morgen. Konzeption zum Schutz und zur Entwicklung naturbelassener Laubwaldökosysteme in großflächigen Waldschutzgebieten im Bundesland Hessen. NABU/BUND Hessen, Hrsg., Wetzlar.
Heiss, G. (1992): Erfassung und Bewertung großflächiger Waldgebiete zum Aufbau eines Schutzgebietesystems in der Bundesrepublik Deutschland. Forstl. Forschungsber. 120, München.
Jeschke, L. (2003): Filze, Möser und Dosen – ein Plädoyer für Moornationalparke in Deutschland. Nationalpark 122, 9-12.
Kaiser, M. (2011). Die Wälder Deutschlands im Klimaschutz – eine neue Strategie mit großer Wirkung. Greenpeace e.V., Hrsg., Hamburg.
Oppermann, V. (2010): Potenzielle neue Nationalparke – Suchraum. Greenpeace-Gruppe München (unveröff. Mskr.).
Panek, N. (1999): Nationalpark-Zukunft in Deutschland – einige kritische Anmerkungen und Thesen. Natur und Landschaft 74 (8), 266-272.
– (2006): Urwald-Ängste – der beschwerliche Weg zum Nationalpark Kellerwald. Selbstverlag, Korbach.
– (2008): Rotbuchenwälder in Deutschland – Beitrag zur Umsetzung einer Schutzstrategie. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (5), 140-146.
– (2011): Deutschlands internationale Verantwortung: Rotbuchenwälder im Verbund schützen. Gutachten im Auftrag von Greenpeace e.V., Hamburg.
– (2012): Eignung von öffentlichen Wäldern in Niedersachsen als Bausteine für den bundesweiten Schutz alter Buchenwälder. Gutachten im Auftrag von Greenpeace e.V., Hamburg.
– (2013): Eignung von öffentlichen Wäldern in Hessen für ein Verbundsystem nutzungsfreier Buchenwälder. Gutachten im Auftrag von Greenpeace e.V., Hamburg.
Schenck, C. (2013): Wildnis ohne uns für uns – wie wild sind Nationalparks wirklich? Nationalpark 160, 12-17.
Scherfose, V., Riecken, U., Jessel, B. (2013): Weitere Nationalparke für Deutschland?! Argumente und Hintergründe mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die Ausweisung von Nationalparken in Deutschland. Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Bonn-Bad Godesberg.
Scherzinger, W. (1996): Naturschutz im Wald – Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung. Ulmer, Stuttgart.
Schumacher, H., Job, H. (2013): Nationalparks in Deutschland – Analyse und Prognose. Natur und Landschaft 88 (7), 309-314.
Sommer, U. (2014): Hürdenlauf mit Aussicht auf den Sieg. Nationalpark 165, 21-23.
Walz, U., Krüger, T., Schumacher, U. (2013): Fragmentierung von Wäldern in Deutschland – neue Indikatoren zur Flächennutzung. Natur und Landschaft 88 (3), 118-127.
Anschriften der Verfasser: Norbert Panek, Agenda zum Schutz deutscher Buchenwälder, An der Steinfurt 13, D-34497 Korbach, E-Mail norbertpanek@gmx.de; Martin Kaiser, Greenpeace e.V., Hongkongstraße 10, D-20457 Hamburg, E-Mail martin.kaiser@greenpeace.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen





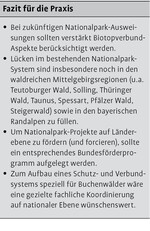
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.