Die Anlage künstlicher Kleingewässer
Abstracts
Die gängige Praxis der Anlage künstlicher, abflussloser Kleingewässer aus Naturschutzgründen wird von den Autoren kritisch beleuchtet. Dazu wird zwischen Argumenten für und wider in Bezug auf Landschaftstyp, lokalen Standort, Grundwasserverfügbarkeit, Bodenschutz und Sinnhaftigkeit abgewogen.
Grundsätzlich wird herausgestellt, dass die Anlage künstlicher Kleingewässer aufgrund des erheblichen Verlustes von Kleingewässern im 20. Jahrhundert sinnvoll ist. Sie sollte jedoch nur in solchen Räumen erfolgen, in denen aufgrund der natur- bzw. kulturräumlichen Ausstattung bereits Kleingewässer vorhanden sind oder waren. Tabustandorte sind aber auch dort Moore, vermoorte Senken und Archivböden.
Establishment of Artificial Ponds – Effects concerning the protection of nature, landscape and soil
The current method of creating small artificial ponds without outlet as a tool of nature conservation in Germany has been critically evaluated. The study balances reasons in favor and against this practice and relates them to the type of landscape, location, availability of ground water, soil protection and its relevance for conservation. The results allow the conclusion that it generally makes sense to create artificial ponds due to the considerable loss of small natural water bodies during the 20th century. However, they should only be constructed in areas, where such water bodies occur naturally or historically. Unsuitable locations are fens, peaty depressions and other soils worth of protection.
- Veröffentlicht am

1 Einführung und Problemstellung
Seit gut 25 Jahren ist die Anlage künstlicher, naturnaher Kleingewässer (Abb. 1) zur Schaffung neuer Feuchtbiotope und als Ausgleichsmaßnahme in Deutschland gängige Praxis. Viele dieser Maßnahmen sind die Antwort auf einen extremen Schwund von Kleingewässern seit Ende des 19. Jahrhundert, der in einigen Teilen Deutschland 80 % und mehr beträgt (Drews & Ziemek 1995), in anderen Regionen aber irrelevant ist, da dort nie Kleingewässer existierten. Ziel ist dabei die naturschutzrelevante Aufwertung unterschiedlicher Flächen, die sowohl weiterhin beweidet werden können, einer forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegen oder ganz aus der Nutzung herausgenommen werden oder es bereits sind. Auch in Parks und auf Flächen mit überwiegender Freizeitnutzung werden derartige Maßnahmen durchgeführt. Dabei sind regionale Unterschiede in den unterschiedlichen Bundesländern zu beobachten, die sowohl naturräumlich als auch naturschutzfachlich und politisch begründet sind.
In der Regel hat die Gewässeranlage den Schutz bestehender Amphibien- und Reptilien- oder z.T. auch Vogelvorkommen zum Ziel oder dient deren Wiederansiedelung (vgl. Heydemann 1987). Denn Kleingewässer gelten in Mitteleuropa als Lebensraum für rund 1000 Tier- und 200 Pflanzenarten (Drews & Ziemek 1995). Häufig finden sich Rote-Liste-Arten im Umfeld (Grell et al. 1998). Das Gewässer dient damit vornehmlich als Laichgewässer, seine Ränder auch als Brutgebiet. Kleingewässer gelten darüber hinaus als besonders artenreich (European Pond Conservation Network 2010, Heitkamp 2006). Häufig sind solche Maßnahmen eine Möglichkeit, bestimmte Arten zu schützen, regional zu erhalten oder wiederanzusiedeln und daher grundsätzlich zu begrüßen. Dennoch handelt es sich auch hierbei um einen anthropogenen Eingriff in Natur und Landschaft, der nicht rückgängig gemacht werden kann und daher nie ohne weitere Vorüberlegung und nur unter ganzheitlichen Gesichtspunkten erfolgen sollte. Daher gilt nach wie vor der Grundsatz, dass natürlich entstandene Gewässerstandorte Vorrang vor der Neuanlage haben (Wildermuth 1982). Pauschalen Aussagen wie „Jedem Dorf seinen Weiher“ oder „Mit dem Bagger soll die Natur zurückkommen“, wie kürzlich die „ZEIT“ titelte, sollte daher äußerst kritisch begegnet werden (DIE ZEIT 28/ 2014: 32).
Oft steht die Neuanlage von Kleingewässern im Kontext mehrerer unterschiedlicher, meist öffentlicher oder öffentlich kontrollierter Naturschutzmaßnahmen auf der betreffenden Fläche (z.B. Schneeweiß 2009: Projekt zum Bestandsschutz von Rotbauchunke und Laubfrosch in Brandenburg). So können zusätzlich im Umfeld z.B. auch noch Erdwälle, Knicks, Lesesteinhaufen, Sandflächen, Totholzhaufen oder Abbruchkanten angelegt werden. Damit einhergehen kann die Wiedervernässung von Moorstandorten, die Unterbrechung bestehender Drainagesysteme, die Einsaat bestimmter Flächenteile mit Regiosaatgut, außerdem Baum- und Heckenpflanzungen, gezielte Maßnahmen zur Ausmagerung, Entbuschung, Beweidung, Mahd oder zur Ansiedlung einer bestimmten Ufervegetation. Außerdem werden Kleingewässer auch häufig im Siedlungsbereich auf Privatgrund angelegt, die jedoch nicht Gegenstand dieses Aufsatzes sind.
Die neu zu schaffenden Gewässer werden meist per Bagger, seltener von Hand ausgehoben. Nur örtlich finden Vorerkundungen zum Untergrund und zur Tiefe des Grundwasserspiegels statt. Die Größe beträgt fast immer einige Zehner bis Hunderter von Quadratmetern, meist jedoch nicht viel mehr als 200m². Das Gewässer sollte zudem im Zentrum 1 bis 1,5m tief sein. Dazu kommt eine entsprechende Ufergestaltung, wie Abflachung oder künstliche Versteilung, deren Umsetzung jedoch stark substratabhängig ist. Ziel kann sowohl die Schaffung von dauerhaften als auch von nur periodisch Wasser führenden Gewässern sein.
Die Anlage von Kleingewässern ist im Vergleich zu anderen naturschutzrelevanten Baumaßnahmen verhältnismäßig kostengünstig. Die Finanzierung erfolgt häufig aus naturschutzrechtlichen Kompensationsmitteln. Weiterhin kommen Stiftungsgelder, seltener öffentliche Mittel oder Spenden zur Finanzierung infrage.
Ein weiterer Vorteil ist der sich relativ schnell einstellende Erfolg. Andere Naturschutzmaßnahmen, wie z.B. die Wiederaufforstung oder die Anlage von Streuobstwiesen, sind deutlich langwieriger. So benötigt ein hochstämmiger Laubwald bis zu 300 Jahre zum Abschluss aller Sukzessionsvorgänge (vgl. Remmert 1991): „Ein 150 Jahre alter Buchenbestand ist durch eine Buchenneupflanzung auch in 150 Jahren nicht zu ersetzen“ (Kaule 1991: 443). Häufig ist zu beobachten, dass sich bereits im Folgejahr nach der Gewässeranlage neue Amphibienvorkommen eingestellt haben und sich eine ufertypische Sukzessionsvegetation ausbildet.
Nicht überall wird die derartige Umgestaltung neuer oder bestehender Naturschutzflächen in der Bevölkerung, bei Naturschützern, Land- und Forstwirten sowie Fachleuten unvoreingenommen begrüßt. Häufige Kritikpunkte sind eine fehlende ganzheitliche und landschaftsspezifische Sichtweise, der Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen, der Landschaftseingriff allgemein, die Zerstörung schützenswerter Archivböden im pedologischen und archäologischen Kontext, die vermeintlich falsche Standortwahl, das Ausmaß der Veränderungen, die Sinnhaftigkeit und im Siedlungsbereich ggf. Emissionen, die von den Gewässern ausgehen können (Tiergeräusche, Gerüche) und mögliche Stechmücken-Populationen.
Der vorliegende Beitrag will daher das zugrunde liegende Konfliktpotenzial beleuchten und Empfehlungen zur Standortwahl und zur Sinnhaftigkeit der Neuanlage von Kleingewässern vermitteln. Ausdrücklich soll jedoch kein Standpunkt zum Für und Wider solcher Maßnahmen ausgesprochen werden. Dargestellt wird ausschließlich die Situation in Deutschland. Schwerpunkte sind auch nicht die juristische Situation (vgl. hierzu u.a. Riedel & Lange 2002: 18ff.) und die Biotopanforderungen bestimmter Einzelarten.
2 Anforderungen an künstliche Kleingewässer
Zielvorgabe ist in der Regel die Schaffung einer Hohlform, die dauerhaft mit Wasser gefüllt ist und auch vor allem in trockenen Frühjahren nicht gänzlich trocken fällt. Denn ansonsten kann es bei einigen Arten zum Verlust von Laich oder Larven bzw. zum Entzug der Nahrungsgrundlage kommen. Für andere Arten wiederum kann ein hochsommerliches Austrocknen des Gewässers wegen der dadurch gewährleisteten Fischfreiheit sogar von Vorteil sein bzw. wirkt sich zumindest nicht nachteilig aus, da die Larven bereits metamorphosiert sind.
Voraussetzung ist also zumeist, dass für die anzulegende Hohlform ein Standort gewählt wird, an dem nicht weit unter der Oberfläche der lokale Mindest-Grundwasserspiegel unterhalb des Grundwasserschwankungsbereichs erreicht wird (bei Gley-Böden durch die Anordnung des Go- und des Gr-Horizonts erkennbar; vgl. Ad-hoc AG Boden 2005). Möglich ist auch der Anschnitt des lokalen Hangwasserleiters, so dass eine dauerhafte Wasserfläche gewährleistet ist. Dazu kann ggf. auch die Nutzung vorhandener Drainageleitungen von Vorteil sein.
Zur Verringerung der Verdunstung im Sommer kann die Bepflanzung der Ufer mit Gehölzen beitragen, ist aber nicht zwingend erforderlich und den Anforderungen entsprechend abzuwägen. Oftmals jedoch ist eine Aufheizung des Wassers im zeitigen Frühjahr und im Sommer gerade deswegen erwünscht, weil eine solche Situation von wechselwarmen Organismen bevorzugt wird. In einem solchen Fall muss jedoch die Tiefe des Gewässers entsprechend gering sein.
In diesem Zusammenhang stellt sich außerdem die Frage nach der Situation im Winter und ob das Gewässer während langer Kälteperioden komplett durchfrieren darf oder nicht. So benötigt z.B. die Kreuzkröte (Bufo calamita) sich rasch erwärmende, flache Gewässer mit flachen Ufern und leichtem, möglichst sandigem Substrat. Eine dauerhafte Wasserfläche ist für diese Art nicht zwingend erforderlich (vgl. Beebee et al. 1990). Zudem sind möglichst vegetationsfreie, unbeschattete Trockenbiotope, wie Schutthaufen oder Binnendünen im Umfeld von Vorteil, so dass auch zukünftige Pflege- und Entbuschungsmaßnahmen erforderlich sind.
Die Ufergestaltung soll meist unregelmäßig und vielfältig erfolgen. Besonders wenn tiefere Gewässer oder Abschnitte mit Steilufern gewünscht sind (z.B. für die Uferschwalbe Riparia riparia), ist vorher zu prüfen, ob das anstehende Gestein auch standfest ist oder ob vorhandene Fest- oder Lockergesteinsabbruchkanten (z.B. aus dem Bergbau, an Prallhängen oder an der Kliffküste) mit einbezogen werden können. Lockergesteine sind in der Regel nicht dauerhaft standfest. Erhöhte Vorsicht ist zudem beim Vorhandensein von Ton- oder Mergelschichten geboten, da diese in erheblichem Maße das Rutschungsrisiko fördern. Besonders instabil ist auch Auelehm. Eine Ausnahme bildet nicht entkalkter Löss, der in der Regel standfest ist, jedoch zur Erosion oder zur unterirdischen Ausspülung (Subrosion oder Piping) neigt. Aus Gründen der Sicherheit und ggf. wegen der Anwesenheit von Weide- oder Wildtieren ist vorher zu prüfen, ob eine Umzäunung oder anderweitige Abgrenzung notwendig ist. Eine Beweidung kann sich sehr unterschiedlich auf Kleingewässer auswirken. Mal kommt es zu starken Trittschäden durch das Vieh. In anderen Fällen bleiben auch Gewässer, die sich inmitten von (großen) Weideflächen befinden, davon unberührt (Grell et al. 1998).
Aus praktischer Sicht stellen sich vor der Anlage also zunächst folgende Fragen:
(1) Welche Arten sollen gefördert werden und welche Voraussetzungen müssen dazu erfüllt werden?
(2) Wie ist der Untergrund beschaffen (sind z.B. steile Böschungen möglich)?
(3) Wie tief liegt der Grund- bzw. Hangwasserspiegel?
Daraus folgen weitere Fragen:
(4) Wie groß und wie tief soll das Gewässer werden?
(5) Wie sollen die Ufer beschaffen sein?
(6) Was geschieht mit dem Aushub?
(7) Sind Bepflanzungen, zukünftige Pflegemaßnahmen o.Ä. notwendig?
(8) Welche weiteren Gestaltungselemente sind möglich?
3 Natürliche Vorkommen von stehenden Gewässern in Deutschland
Die Anlage von Kleingewässern macht grundsätzlich nur dann Sinn, wenn es in dem betreffenden Naturraum bereits ähnliche Wasserflächen gibt oder gab und wenn die Anlage in Bezug zu den vorhandenen Ökosystemen schlüssig erscheint. Berücksichtigt werden muss dabei jedoch immer, ob es sich bei den vorhandenen Gewässern um Elemente der Natur- oder der Kulturlandschaft handelt, d.h. ob die landschaftsprägenden Gewässer überwiegend natürlich oder künstlich sind oder waren. Im Grundsatz wird zwischen perennierenden (dauerhaft Wasser führenden) Gewässern ohne lichtlose Tiefe (natürliche Weiher und künstliche Teiche) sowie periodisch trocken fallenden Tümpeln unterschieden (Drews & Ziemek 1995).
In Bezug auf die Sinnhaftigkeit bei der Anlage von künstlichen Kleingewässern stellt sich die viel diskutierte Frage nach dem generellen Natur-Kultur-Verständnis und danach, welchen Zustand von Landschaft bzw. „Natur“ man durch „Naturschutz“ überhaupt wieder herstellen will, bzw. welchem man sich annähern will (vgl. Zierhofer 2007). Dabei muss in erster Linie beachtet werden, dass ursprüngliche „Naturlandschaften“ in Bezug auf Artenzahl und Biodiversität keinesfalls zu bevorzugen sind. Infrage kommende „Landschaftstypen“ gibt es viele, wie etwa die präneolithische Waldlandschaft, die bäuerliche und vorindustrielle Kulturlandschaft, wie sie bis ins 19. Jahrhundert existierte, oder aber eine Synthese aus vor allem im 20. Jahrhundert geschaffenen künstlichen Landschaftselementen und natürlichen bzw. historischen Elementen, d.h. eine völlig neue Art von Landschaft.
Die meisten Teile Deutschlands und Mitteleuropas sind von Natur aus arm oder nahezu frei von stehenden Gewässern. Dies gilt für Teiche, Tümpel und erst recht für richtige Seen. Eine Ausnahme bilden stehende oder langsam fließende Altarm- oder Altwasserstrukturen an den Unterläufen von Flüssen oder Bächen, generell an Tieflandsflüssen oder am Oberrhein. Dabei wird zwischen anastomosierenden und mäandrierenden Flussläufen unterschieden (Zepp 2004: 144ff.). Erstere neigen dazu, ihren Lauf ständig in Form vieler kleinerer Rinnen und/oder Hauptarme während starker Abflussereignisse zu verändern. Dadurch entstehen ständig neue, zwar noch mit Wasser gefüllte aber nicht mehr durchflossene Altarme. Bei frei mäandrierenden Flussläufen kommt es bei Extremereignissen oder über längere Zeitspannen zum Durchbrechen bestehender Mäander des Hauptarms bzw. zu deren Neubildung. Auch dabei entstehen meist größere stehende Gewässer. In beiden Fällen kommt es zur sukzessiven Verlandung und zum Durchlaufen mehrerer Sukzessionsstadien der Vegetation, die nach erneuten Laufveränderungen stets von neuem beginnen. So entstandene Kleingewässer bilden hervorragende Lebensbedingungen für unterschiedliche Arten. Diese sind jedoch seit dem 18. Jahrhundert verstärkt durch die Begradigung, Regulierung und den Ausbau von Flüssen und Bächen (Beispiel Oberrhein oder die Flüsse im Voralpenland; vgl. Dambeck 2005) verschwunden. Es erscheint daher besonders sinnvoll, in solchen Bereichen eine wirklich natürliche Auendynamik mit freien Mäandern bzw. anastomosierenden Systemen wieder herzustellen, anstatt künstlich im Umfeld von Flüssen Kleingewässer anzulegen.
Eine Rechtfertigung zur Anlage solcher Kleingewässer liegt jedoch vor, wenn eine Umgestaltung des Fließgewässers selbst nicht möglich ist. Dies trifft selbst dann zu, wenn früher keine Altwasserstrukturen vorhanden waren, was jedoch oft nur anhand intensiver fluvialmorphologischer oder archivalischer Untersuchungen zu verifizieren ist.
Natürliche Seen und Teiche kommen außerhalb von Auen fast ausschließlich in der während der letzten Kaltzeit vereisten Jungmoränenlandschaft vor (Kaule 1991: 73, vgl. Liedtke 1981); dort allerdings auch nur im Bereich der Grund- und Endmoräne, nicht jedoch auf dem Sander. Genetisch können sie auf ganz unterschiedliche Weise begründet sein. Oft fehlt jedoch die Grundlagenforschung im individuellen Fall. Es handelt sich bei größeren Seen in der Regel um vom Eis ausgeschürfte Zungenbecken (z.B. den Chiemsee) oder unter dem Eis durch Schmelzwasser entstandene Rinnenseen. Kleinere, oft abflusslose Seen und z.T. nur wenige Meter breite Teiche entstanden meist aus liegen gebliebenen Toteisblöcken in der Niedertaulandschaft (sog. Sölle; Zepp 2004: 201). Dies betrifft im Norden das östliche Hügelland in Schleswig-Holstein, große Teile Mecklenburgs und Brandenburgs, Vorpommerns und Berlins. Im Süden sind nur das südliche Alpenvorland in Bayern und Baden-Württemberg sowie der deutsche Alpenanteil relevant. In der Altmoränenlandschaft (v.a. in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt) sind stehende Gewässer dagegen äußerst selten (ausgenommen Tieflandsseen wie der Dümmer und das Steinhuder Meer mit besonderer geomorphologischer Geschichte).
Auch in den Mittelgebirgen kommen natürliche Kleingewässer und erst recht Seen nur in Ausnahmefällen vor. Gletscherseen, entstanden im Bereich ehemaliger Kare, kommen nur vereinzelt im Nord- und Südschwarzwald und im Bayerischen Wald vor (z.B. die Arberseen). Selten sind rein natürliche Wasserflächen in Mooren, wie im Emsland oder auf den Höhen der Mittelgebirge. Häufiger sind dort (historische) Torfstiche. Eine weitere Ausnahme bilden die Eifelmaare und wassergefüllte Kraterseen in Rheinland-Pfalz sowie stark schüttende, z.T. künstlich aufgestaute Karst-Quelltöpfe in Süddeutschland (z.B. der Blautopf). An der Ostseeküste kommen z.T. durch Strandhaken ganz oder teilweise abgeschnürte Strandseen, Noore oder kleine Haffs vor, die in der Vergangenheit oft verkleinert oder trocken gelegt wurden. Selten existieren quasi-natürliche Tümpel auch in der Marsch an der Nordseeküste und auf den Inseln, wie die durch Deichbrüche ausgekolkten Wehlen (z.B. der Schloppteich auf Langeoog).
Dennoch existierten auch bereits vor der Industrialisierung landschaftsprägende Stillwasserflächen, die als typisch für die jeweilige Kulturlandschaft bezeichnet werden können. In erster Linie betrifft dies Mergel-, Ton-, Ziegelei- und (seltener) Kiesgruben (v.a. im Jung- und Altmoränenland), außerdem die Hinterlassenschaften der Harzer Wasserkunst, wie sie auch vereinzelt in anderen Mittelgebirgen vorkommen (z.B. der Herthasee im Niederwesterwald). Weiterhin bestanden in den Mittelgebirgen häufig periodisch wassergefüllte Stauwehre zum Mühlenbetrieb, zur Flößerei und zur Wiesenbewässerung (z.B. im Pfälzerwald oder im Spessart), außerdem Fischweiher (wie in der Oberpfalz oder im Hohen Westerwald). Zudem existieren künstlich angelegte Dorf-, Tränke-, Enten- oder Feuerlöschteiche (vgl. Riedel 1985), wie z.T. in Angerdörfern östlich von Elbe und Saale oder die Hülben auf der Albhochfläche.
Erst seit der Industrialisierung kam es in großem Stil zur Anlage großer künstlicher Hohlformen als Folge des Bergbaus. Am häufigsten sind Kiesgruben (am Oberrhein, an der Weser, im Jungmoränenland u.a.), außerdem Braunkohletagebaue (im Rheinland, in Mitteldeutschland und in der Lausitz). Besonders letztere befinden sich in einer Landschaft, die bis vor gut 100 Jahren überhaupt nicht über stehende Wasserflächen verfügte, was jedoch nicht heißt, dass die dadurch neu entstandenen Bedingungen nicht erhaltenswert wären. Man sollte sich jedoch auch immer darüber im Klaren sein, dass der heutige Feuchtgebietscharakter weiter Landschaften schlicht und einfach und vor noch gar nicht allzu langer Zeit durch den Menschen geschaffen wurde. Dort heute verbreitete Amphibien waren u.U. auch vorher dort schon heimisch, aber eben an Fließgewässer und ihre oben beschriebenen Strukturen gebunden.
In den Mittelgebirgen entstanden vor allem direkt nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt kleine, private, meist nicht kommerziell betriebene Fischteichanlagen in kleinen Bachtälern (Abb. 2). Deren Betrieb war eng mit der Freizeitnutzung der Besitzer, z.T. auch mit der hauseigenen Landwirtschaft verknüpft. Hier ist grundsätzlich die Möglichkeit einer Umnutzung derartiger Gewässer im Sinne des Naturschutzes mit oder ohne Durchfluss, aber ohne Fischbesatz zu prüfen. Denn der (häufig amtlich angeordnete) Rückbau solcher Anlagen, noch dazu aus Naturschutzgründen, stellt einen erheblichen Landschaftseingriff dar, da sich in der Regel bestimmte Populationen von Tieren und Pflanzen seit Jahrzehnten auf das durch den Menschen veränderte Umfeld eines künstlichen, fast stehenden Gewässers eingestellt haben. Natürlich sind auch Auswirkungen solcher Gewässer auf die unterseits gelegenen Fließgewässer möglich (z.B. eine erhöhte sommerliche Erwärmung des Wassers, eventuelle Nährstoffeinträge und eine verminderte Sauerststoffkonzentration).
Es sollte aber im Einzelfall abgewogen werden, welche Veränderung schwerer wiegt und ob nicht weitere Gegenmaßnahmen möglich sind (Beschattung des Teichs, wenn er sich nicht ohnehin schon im Wald oder zwischen Bäumen befindet oder die Verhinderung von Fischbesatz). Auch die häufig angeführte Begründung, solche Anlagen würden ein eventuelles Migrationsverhalten des Makrozoobenthos durch Einlaufbauwerke, nicht ausreichenden parallelen Wasserabfluss bei sehr kleinen Gerinnen o.Ä. verhindern, ist häufig aus der Luft gegriffen, da eine aktive Längsmigration ohne Drifteinwirkung, insbesondere gegen die Fließrichtung, in kleinen Fließgewässern nicht verifizierbar ist (vgl. Halle 2009). Jedoch kann auch bei solchen Bedenken durch einen flacheren Einlauf Abhilfe geschaffen werden.
4 Landschafts-, Boden- und Denkmalschutz
Die anthropogene Nutzungsgeschichte der Böden in Deutschland reicht in den Altsiedelräumen mindestens bis ins Neolithikum zurück. Die Folgen waren teils erhebliche Bodenerosionsprozesse und die Zerschluchtung von Hängen. Dabei kam es häufig zur Bildung von Hangkolluvien, gesteigerter Auensedimentation und der Verfüllung von Hohlformen und stehenden Gewässern (z.B. Leopold & Völkel 2006, Stolz et al. 2012). Die Bodengenese im Holozän ist daher nicht nur stark durch den Menschen mitgeprägt worden. Derartige Profile sind auch als schützenswerte Geoarchive anzusehen.
In Bezug auf Flora und Fauna brachte gerade die Neolithische Revolution und die dadurch ausgelöste dauerhafte Sukzession einen starken Anstieg von Artenzahl und Biodiversität mit sich. Anthropogene Eingriffe in die Landschaft sind daher lange nicht immer mit Verlust gleichzusetzen. Besonders seit der Frühen Neuzeit und verstärkt seit der Industrialisierung und den 1950-er Jahren nahm jedoch die Bodenzerstörung durch Bergbau, Entsorgung von Abfällen und Überbauung durch Siedlungs- und Verkehrsflächen in erheblichem Maße zu. Dem Boden als Schutzgut kommt daher gerade heute eine große Bedeutung zu (z.B. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 2012; BBodSchG).
Daher gilt es genau abzuwägen, ob und inwiefern der Zweck einer Baumaßnahme und damit auch der Anlage von Kleingewässern im Sinne des Naturschutzes einen solchen Eingriff rechtfertigt und wenn ja, an welcher Stelle der geringste Schaden entsteht. Denn bei der Schaffung künstlicher Hohlformen gehen nicht nur Böden verloren, die sich zumindest teilweise in einer seit dem Ende der letzten Kaltzeit vor rund 11500 Jahren ungestörten Entwicklung befinden. Durch die Ablagerung des Aushubs und die Veränderung von Naturschutzflächen durch künstliche Aufschüttung werden ebenfalls natürliche Bodenprozesse, wie etwa Infiltrationsfähigkeit und Nährstoffbindung, außer Kraft gesetzt. Noch schwerer wiegt der systematische Abtrag des Oberbodens zur beschleunigten Ausmagerung. Dazu kommen teils irreversible Schäden während der Bauarbeiten durch Verdichtung, Abschälung und Verschlämmung. Besonders in Regionen mit geringem Waldanteil (z.B. in Schleswig-Holstein, Rheinhessen oder der Mitteldeutschen Tieflandsbucht) sind ungestörte Bodendecken äußerst selten. Die Schaffung neuer Hohlformen, z.B. auf einer ohnehin schon anthropogen stark beeinflussten ehemaligen Ackerfläche, bedeutet immer auch einen neuen Eingriff, was den Verantwortlichen stets bewusst sein sollte.
Eine besondere Bedeutung kommt sogenannten schützenswerten Archivböden zu (LABO 2011). Diese lassen sich in natürliche, quasinatürliche und als Sonderfall archäologisch relevante Profile unterscheiden. Gemeint sind z.B. Böden mit außergewöhnlichen Funktionen, wie z.B. als Kohlenstoffsenke in vermoorten oder stark vernässten Bereichen, vorwiegend im Norddeutschen Tiefland und in Höhenlagen. Besonders die oft dauerhaft vernässten Tiefenbereiche abflussloser Senken, wie sie z.B. im Jungmoränenland oder auch in Karstgebieten vorkommen, sind wertvolle Geoarchive (einmal eingebrachtes Sediment kommt nicht wieder heraus), anhand derer mittels pollenanalytischer und sedimentologischer Untersuchungen die Rekonstruktion vergangener Umweltbedingungen und Klimazyklen möglich ist (vgl. z.B. Rickert 2006). Besorgniserregend ist es daher, dass gerade solche Standorte als besonders geeignet zur Anlage künstlicher Kleingewässer empfohlen werden (z.B. vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern o.J.).
Archivöden gelten darüber hinaus als besonders schützenswert, wenn sie möglichst ungestörte Beispiele einer natürlichen und/oder außergewöhnlichen Bodenentwicklung darstellen (z.B. noch ungestörte Parabraunerden, Podsole mit Ortstein, die in Deutschland seltenen Schwarzerden sowie grundsätzlich Böden mit periglazialen Frostmustern, Eiskeilen oder Verwürgungen, Paläoböden im Löss und anderen Deckschichten, Tephrabänder, Tertiärreste, schwarze Auenböden u.a.). Keinesfalls aber darf der Bodenschutz wissentlich vernachlässigt werden, da die Böden in Mitteleuropa ohnehin bereits als stark gestört gelten.
Aus archäologischer Sicht wird das großflächige Auskoffern von Bodenmaterial ebenfalls örtlich kritisch gesehen, obwohl die zuständigen Denkmalämter regulär von den Vorhaben unterrichtet werden. Für die Begleitung der häufig nur wenige Stunden dauernden Arbeiten im Gelände fehlt dort oft das Personal. So kommt es nur zur Prüfung der vorhandenen Unterlagen und Fundkarten, wobei bislang unbekannte archäologische Befunde unberücksichtigt bleiben und ggf. zerstört werden.
Eine zusätzliche Bedeutung kommt dem einheitlichen Gesamteindruck gewachsener Natur- und Kulturräume sowie der Landschaftsästhetik zu. Auch aus diesen Gründen erscheint die Anlage von Kleingewässern und künstlichen Aufschüttungen in Landschaften, die durch weite, ununterbrochene Flächen geprägt werden (z.B. Sanderflächen) wenig sinnhaft.
5 Klimaschutz und Kohlenstoffsenken
Besonders fatal in Bezug auf den Klimaschutz ist die Anlage von Kleingewässern auf Feuchtstandorten, z.B. in Senken und auf vermoorten Auen, wenn dazu Torfe, Mudden und andere humose Sedimente ausgegraben werden müssen. Der dort eingelagerte Kohlenstoff wird regulär nicht abgebaut, d.h. atmosphärisch verfügbar, da sich das Sediment das ganze Jahr über im Einzugsbereich des Grundwassers, bzw. durch Kapillarkräfte bedingt kurz darüber, oder in direkter Nähe zu Oberflächengewässern befindet. Entnimmt man es und schüttet es auf Halde, beginnt sofort der mikrobielle Abbau und damit die Ausgasung der klimaschädlichen Gase Kohlendioxid und Methan in die Atmosphäre. Zudem sind von den ursprünglich in Mitteleuropa vorkommenden Moorflächen heute nur noch weniger als 5 % vorhanden (von den Hochmooren nur noch rund 1 %; Joosten 2012), so dass eine zusätzliche Zerstörung unter dem Stichwort Naturschutz daher kontraproduktiv ist.
Leider ist es in einigen Regionen nach wie vor gängige Praxis, gerade solche Bereiche für die Anlage von Kleingewässern heranzuziehen, da hier durch den Grundwassereinfluss mit einer dauerhaft vorhandenen Wasserfläche zu rechnen ist, was an angrenzenden Hängen nicht zwingend der Fall ist. So werden in den Jungmoränenlandschaften die häufig vorhandenen abflusslosen Senken (Abb. 3) als Standort gewählt. Dabei handelt es sich meist um verlandete Sölle, wie Untersuchungen an betreffenden Sedimentfüllungen beweisen (Stolz 2012). Gräbt man solche alten Soll-Standorte auf, folgt, wenn es sich um einen ehemaligen Ackerstandort handelt, zunächst eine kolluviale Schicht, gefolgt von Torf oder geschichtetem humosem Feuchtsediment (Abb. 4), unter dem meist Stillwassersediment ansteht. Dieses stammt aus einem Kleingewässer, das dort im Spätglazial bis Mittelholozän existierte.
Ganz anders sieht es aus, wenn die natürlichen Kleingewässer noch bis in die jüngste Zeit existierten und z.B. im Zuge von Flurbereinigungsmaßnahmen künstlich verfüllt wurden, was häufig erst nach dem Zweiten Weltkrieg geschah. Bei Voruntersuchungen in solchen Senken offenbaren sich schnell entsprechende Altlasten, wie Abfall oder Bauschutt. Deswegen erscheint die Reaktivierung der früheren Kleingewässer an diesen letztgenannten, gestörten Standorten mehr sinnvoll, wenn gewährleistet ist, dass eventuell vorhandene Altlasten rückstandsfrei entfernt werden können oder aber die Wasserqualität eines dort anzulegenden Kleingewässers nicht beeinflussen. Die massenhafte Verfüllung solcher Sölle war vor allem in Schleswig-Holstein während der Frühphase des sogenannten Programms Nord (1953-1988; vgl. Riedel 1985) und noch stärker bei der Kollektivierung zu DDR-Zeiten in Mecklenburg (Komplexmelioration) gängige Praxis. Besonders dort, wo die Landschaft zudem weitläufig ausgeräumt ist, ist das Wiederaufbaggern von Kleingewässern sinnvoll.
6 Haltbarkeit und Wiederverlandung von Kleingewässern
Bei der Anlage von Kleingewässern müssen nicht nur zukünftig notwendige Pflegemaßnahmen vorab geklärt und festgelegt sein. Einkalkulieren sollte man auch stets die ungefähre Bestandsdauer eines Gewässers. Gerade an eutrophen Standorten und bei dichtem Röhricht-Bewuchs neigen Klein- und Kleinstgewässer sehr schnell zur Verlandung. Je nach Standort und Ausgangssituation verlandet ein seichtes, zu- und abflussloses Kleingewässer in der Regel in fünf bis 20 Jahren. Beschleunigt wird dies durch den Eintrag von Nährstoffen (z.B. von angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen oder aus Hochwassereinträgen naher Fließgewässer) und durch den Laubfall naher Gehölze. So verlandet ein See mit eutropherem Einzugsgebiet 100 bis 200-mal schneller (Kaule 1991: 447). Abhilfe würde regelmäßiges Ausbaggern bringen, was jedoch in den meisten Fällen nicht angebracht erscheint, da dies eine immense Störung der Organismen bedeutet, die sich mittlerweile dort angesiedelt haben, außerdem eine extreme Veränderung der Umweltbedingungen in kurzer Zeit. So scheiden solche Maßnahmen während der Vegetationsperiode grundsätzlich aus. Im Winter ist ein erneutes Ausbaggern auch nicht sinnvoll, da sich einige Arten zur Winterruhe im Sediment eingraben. Bliebe also noch die Möglichkeit der erneuten Anlage von Kleingewässern im näheren Umfeld. Dies würde jedoch einen weiteren Eingriff bedeuten.
Eine dauerhafte Erhaltung von abflusslosen Kleingewässern ist daher ohne derartige Pflegemaßnahmen nicht oder nur unter bestimmten räumlichen Bedingungen möglich.
7 Schlussfolgerungen
Kleingewässer sollten nur in Naturräumen angelegt werden, die von ihrer ursprünglichen Ausstattung her die Voraussetzungen bieten und in denen in den letzten Jahrzehnten tatsächlich ein Verlust ebensolcher Gewässer beklagt werden kann. Dabei ist es weitgehend unerheblich, ob es sich dabei um natürliche Gewässer oder Relikte der Kulturlandschaft handelte. Eine ganzheitliche Sichtweise erscheint daher unabdingbar. Eine Ausnahme bilden Auen- oder auennahe Bereiche, in denen Kleingewässer als Ersatz für eine künstlich erzeugte geringe Gewässerstrukturgüte eines Flusses oder Baches dienen können, z.B. um Laichmöglichkeiten zu schaffen. Sinnvoll erscheint auch die Miteinbindung in ohnehin notwendige Renaturierungskonzepte, z.B. von Kiesgruben oder anderen Abbauflächen.
In jedem Fall ist zudem eine großflächige Vorerkundung der betreffenden Fläche erforderlich, die möglichst nicht durch die Anlage von Bodenschürfen oder mit der Baggerschaufel, sondern mit dem Pürckhauer-Bohrstock oder anderem geeigneten Bohrgerät, verlängert bis wenigstens drei Meter, erfolgen soll. Wichtig dabei ist die genaue Kartierung der Grundwasser-Mindesttiefe nach Vorgaben der Bodenkundlichen Kartieranleitung (z.B. durch Erkundung der Tiefe von Oxidations- und Reduktionshorizonten mittels Bohrstock; Ad-hoc AG Boden 2005). Besonders in siedlungsnahen Bereichen und in typischen siedlungsgünstigen Lagen (z.B. auf Schwemmfächern, an Quellen und in Gewässernähe) sollte vorher ein Überblick über u.U. vorhandene archäologische Befunde eingeholt werden und im besten Falle eine grobe Überprüfung vorhandener Fundkataster und der Örtlichkeiten im Gelände stattfinden.
Tabuflächen sind generell Hoch- und Niedermoorkörper, Quellbiotope, vermoorte Senken, generell abflusslose Tiefenbereiche und Binnendünen/Flugsanddecken (und möglichst alle gesetzlich geschützten Biotope nach BNatSchG, §30, Abs. 2), außerdem Örtlichkeiten mit nachgewiesenen Archivböden oder archäologischen Relikten. Bei Tiefenbereichen sollte ggf. auf den Übergangsbereich zwischen Hang und Senke ausgewichen werden, wo Archivböden weitgehend unberührt bleiben oder nur randlich tangiert werden, aber dennoch in erreichbarer Tiefe Grund- oder Hangwasser zur Verfügung steht.
Die Entscheidung zur Neuanlage von Kleingewässern bedeutet immer auch einen erneuten Eingriff in Natur und Landschaft, der unweigerlich mit der Zerstörung von Böden einhergeht. Biotop- und Geotopschutz sollten daher sorgsam und im Hinblick auf die Ausstattung und den Zustand des umliegenden Naturraums abgewogen werden.
Wenn die Anlage abflussloser Kleingewässer aus den genannten Gründen nicht sinnvoll erscheint, aber dennoch ein erkennbarer Mangel an Feuchtbiotopen besteht, sollte bevorzugt die Renaturierung von Fließgewässern forciert werden. Leider scheitert dies aber häufig aufgrund von erheblichen Planungserfordernissen, Besitzfragen und dem Mangel an finanziellen Mitteln.
Zu guter Letzt sollte angemerkt werden, dass die Anlage eines Kleingewässers alleine kaum sinnvoll ist. Sie sollte immer Teil eines umfassenden und abgestimmten Naturschutz- und Pflegekonzepts für das jeweilige Gebiet sein, das z.B. eine extensive Beweidung, Gehölzpflanzungen (wie in Form von Knicks oder Streuobstwiesen, je nach Region) und Nutzungsänderungen oder -aufgaben beinhaltet.
Literatur
Ad-hoc AG Boden (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung. Hannover, 438S.
Beebee, T.J.C., Flower, R.J., Stevenson, A.C, Patrick,S.T., Appleby, P.G., Fletcher, C., Marsh, C., Natkanski, J., Rippey, B., Battarbee, R.W. (1990): Decline of the natterjack toad Bufo calamita in Britain: Palaeoecological, documentary and experimental evidence for breeding site acidification. Biol. Conserv. 53 (1), 1-20.
Dambeck, R. (2005): Beiträge zur spät- und postglazialen Fluß- und Landschaftsgeschichte im nördlichen Oberrheingraben. Diss. Univ. Frankfurt a.M., Physische Geographie. 312S.
DIE ZEIT 28/2014 vom 3.7.2014: Jedem Dorf seinen Weiher. Das Artensterben in Deutschland lässt sich womöglich leicht stoppen. Wie? Ein Vogelkundler von Weltruf hat sich etwas einfallen lassen. S.32.
Drews, R., Ziemek, H. (1995): Kleingewässerkunde. Eine praktische Einführung. Reihe: Biologische Arbeitsbücher 41. Quelle & Meyer, Wiesbaden, 146S.
European Pond Conservation Network (2010): Das Kleingewässer-Manifest. O.O.: EPCN, 20S.
Grell, H., Grell, O., Voss, K. (1998): Erfolgskontrolle von biotopgestaltenden Maßnahmen im Agrarbereich; Kleingewässer. Kiel, 64S.
Halle, M. (2009): Operationalisierung von Migrationswirkungen auf den ökologischen Gewässerzustand von grobmaterialreichen silikatischen Mittelgebirgsbächen (Fließgewässertyp 5) unter Berücksichtigung von Biotopverbundaspekten. Schr.-R. DRL 82, 48-59.
Heitkamp, U. (2006): Stagnierende Kleingewässer in Südniedersachsen. Typologie, Umweltbedingungen und Fauna. Naturschutzverband Niedersachsen, Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems, Merkblatt 70. Göttingen: NVN, 8S.
Heydemann, B. (1997): Neuer Biologischer Atlas. Ökologie für Schleswig-Holstein und Hamburg. Wachholtz, Neumünster, 591S.
Joosten, H. (2012): Zustand und Perspektiven der Moore weltweit. Natur und Landschaft 87 (2), 50-55.
Kaule, G. (1991): Arten- und Biotopschutz. Ulmer, Stuttgart, 519S.
LABO (Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz, 2011): Archivböden. Empfehlungen zur Bewertung und zum Schutz von Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Aachen, 160S.
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (2012): Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Arbeitshilfe. Bodenschutz 24. Umweltministerium Baden-Württemberg, Stuttgart, 32S.
Landesbund für Vogelschutz in Bayern (o.J.): Wo lege ich Kleingewässer an? Online: http://praxistipps.lbv.de/praxistipps/kleingewaesser-an legen/ein-kleingewaesser-anlegen.html (25.02. 2014).
Leopold, M., Völkel, J. (2006): Colluvium: Definition, differentiation, and possible suitability for reconstructing Holocene climate data. Quaternary Int. 162-163, 133-140.
Liedtke, H. (1981): Die nordischen Vereisungen in Mitteleuropa. Forschungen zur Deutschen Landeskunde 204, 307S.
– (Hrsg., 2002): Physische Geographie Deutschlands. Klett-Perthes, Gotha, 786S.
Remmert, W. (1991): Das Mosaik-Zyklus-Konzept und seine Bedeutung für den Naturschutz – eine Übersicht. Laufener Seminarbeitr. 5/1991, 5-15.
Rickert, B.-H. (2006): Kleinstmoore als Archive für räumlich hoch auflösende landschaftsgeschichtliche Untersuchungen. Fallstudien aus Schleswig-Holstein. EcoSys. Beiträge zur Ökosystemforschung 45, 173S.
Riedel, W. (1985): Kleingewässer in der heutigen Kulturlandschaft. Das Schicksal der Dorfteiche des Friedrich Junge. In: Janssen, W., Riedel, W., Trommer, G., Hrsg., Junge, F., Nachdruck von 1907, Der Dorfteich als Lebensgemeinschaft, Lühr und Dircks, St. Peter-Ording, 55-90.
–, Lange, H. (2002): Landschaftsplanung. Spektrum, Heidelberg, 384S.
Schneeweiss, N. (2009): Artenschutzprogramm Rotbauchunke und Laubfrosch. Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, Land Brandenburg. Potsdam.
Stolz, C. (2012): Holozäne Sedimentfüllungen verlandeter Sölle und Auenablagerungen südlich von Flensburg. Natur und Landeskunde 119 (10-12), 150-161.
–, Grunert, J., Fülling, A. (2013): Quantification of floodplain sedimentation in a medium sized river catchment of the German Uplands. A case study from the Aar River in the southern Rhenish Slate Mts., Western Germany. Die Erde 144 (1-2), 31-50.
Wildermuth, H. (1982): Die Bedeutung anthropogener Kleingewässer für die Erhaltung aquatischer Fauna. Natur und Landschaft 57 (9), 297-306.
Zierhofer, W. (2007): Natur als kulturelles Konzept. In: Gebhardt, H., Glaser, R., Radtke, U., Reuber, P., Hrsg., Geographie, Physische Geographie und Humangeographie, Elsevier, München, 934-941.
Zepp, H. (2004): Geomorphologie. Grundriss Allgemeine Geographie. Schöningh, Paderborn, 354S.
Anschriften der Verfasser: PD Dr. rer. nat. habil. Christian Stolz, Europa-Universität Flensburg, Abteilung Geographie, Interdisziplinäres Institut für Umwelt-, Sozial- und Humanwissenschaften, Auf dem Campus 1, D-24943 Flensburg, E-Mail christian.stolz@uni-flensburg.de, sowie Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Geographisches Institut, D-55099 Mainz, E-Mail C.Stolz@geo.uni-mainz.de; Prof. em. Dr. rer. nat. Wolfgang Riedel (Universität Rostock), Birkenweg 29, 24944 Flensburg, E-Mail wmriedel@t-online.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen



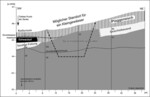
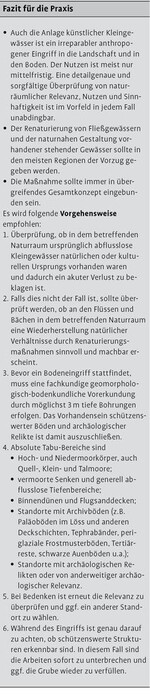
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.