Verjüngungspotenzial der Douglasie in Bayern
Abstracts
Die Verjüngungsökologie der Douglasie (Pseudotsuga menziesii) wurde iin der vorliegenden Arbeit im Hinblick auf ein fragliches Invasionspotenzial dieser Baumart für bayerische Verhältnisse untersucht.
Aus den analysierten Merkmalen („quantitative“ Invasivitäts-Kriterien) ergeben sich keine Hinweise auf ein invasives Verhalten der Douglasie in Bayern (Definition „invasiv“ = §7 Abs. 2 Nr. 9 BNatSchG): Die Samenflugweite der Douglasie ist gering und beträgt i.d.R. weniger als 100 bis 200m. Die erfolgreiche Etablierung von Naturverjüngung wird durch eine Vielzahl von Faktoren (vor allem Standort, Boden, Waldstruktur, Lichtverfügbarkeit) stark beeinflusst.
Die Douglasie neigt auf dem Weg der natürlichen Verjüngung kaum zur Bildung von Reinbeständen (in der Regel besitzt sie lediglich geringe Bestockungs-Anteile) oder zu einer einseitigen Dominanz in Mischverjüngungen. Nur auf sehr kleinflächig vorhandenen trocken-silikatischen Sonderstandorten zeigt sich eine deutliche Wuchsüberlegenheit der Douglasie aufgrund des Krüppelwuchses der vorkommenden heimischen (Laub-) Baumarten. Eine invasive Art im Sinne der rechtlichen Definition des Bundesnaturschutzgesetzes stellt sie auf diesen häufig naturschutzfachlich wertvollen Flächen jedoch nicht dar: Ihre Ausbreitung und Anteile sind dort wie auch auf der übrigen Waldfläche begrenzt und mit Pflegemaßnahmen leicht steuerbar.
Regeneration Potential of Douglas Fir in Bavaria – No classification as invasive species according to the Federal Nature Conservation Act
A research project examined the ecology of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) regeneration in Bavarian forests in connection with the question of invasive behaviour of the species. The results reveal that Douglas fir does not behave as a pest or a problematic foreign species in Bavaria. Therefore it cannot be classified as” invasive” species in Bavaria (definition of “invasive” species following §7, section 2 (9) BNatSchG (Federal Nature Conservation Act)). Distance of seed flight usually does not exceed 100-200 meters. The process of natural regeneration is strongly influenced by several factors such as soil, light availability and forest structure. During forest regeneration Douglas fir usually does not dominate in growth or number. The species can be controlled and managed by common forestry practice. On a very small scale there are sites with a special combination of climatic and soil conditions (dry, silicate bedrock slopes) in Bavaria. Most native tree species struggle under these conditions and therefore show little growth rates. In contrast, Douglas fir regeneration shows normal growth on these sites and therefore could potentially overgrow other individuals. However, the spreading of Douglas fir is also limited and, if necessary (e.g. to protect rare close-to-nature habitats), regeneration or trees can be completely removed.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii) wird als Baumart seit mehr als 150 Jahren in die bayerischen Wälder eingebracht. Ihre Heimat ist ein ausgedehntes Verbreitungsgebiet im Westen Nordamerikas. Sowohl im Zuge des Klimawandels und der nötigen Anpassung der heimischen Wälder daran als auch im Kontext des Umbaus von Fichten-Altersklassenwäldern in strukturreichere, gemischte und stabile Wälder kommt der Douglasie eine wachsende Aufmerksamkeit zu. Sie hat sich aus Sicht des Waldbesitzes seit geraumer Zeit als stabile, ertragreiche und leicht in den naturnahen Waldbau integrierbare Baumart bewährt (v. Lerchenfeld 2008).
Von Vertretern des Naturschutzes wird diese Entwicklung und insbesondere der angestrebte Ausbau der Anteile der Douglasie am Waldaufbau mit Skepsis betrachtet (vTI 2011). Mitunter wird die Pflanzung nicht einheimischer Baumarten abgelehnt (Reif et al. 2010). Es wird befürchtet, dass sie heimische Ökosysteme, Biotope oder Arten verfälschen oder beeinträchtigen könnte. Das Bundesamt für Naturschutz stufte die Douglasie 2013 für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland als invasive Art ein (Nehring et al. 2013). Vertreter der deutschen forstlichen Hochschulen, Universitäten und Forschungsanstalten übten daraufhin öffentliche Kritik an der fachlichen Qualität der Einstufungsmethodik (Ammer et al. 2014).
Die Diskussion um die Douglasie und um ihre Rolle in heimischen Ökosystemen stützt sich noch auf eine nur geringe Anzahl von Untersuchungen. An der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) wurde daher die Verjüngungsökologie der Douglasie in Bayern untersucht, um mit belastbaren Fakten zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen zu können. Unter anderem wurden dabei folgende Fragestellungen bearbeitet:
Wie verbreitet ist die Douglasie in Bayerns Wäldern (Schwerpunkte, Altersstruktur, Bestockungsanteile)?
Wie und wo fruktifiziert die Douglasie (Alter, Samenmengen, Samenflugweite, Mastjahre, Etablierungserfolg, Einflussfaktoren, Notwendigkeit einer Kunstverjüngung)?
Welche Anteile erreicht Douglasien-Naturverjüngung und wie stellen sich interspezifische Konkurrenzverhältnisse in den Mischverjüngungen dar (Mischungsanteile, Verdrängungsprozesse zugunsten/zulasten der Douglasie)?
Sind aus der Verjüngungsökologie der Douglasie (standörtliche) Konstellationen in Bayern abzuleiten, bei denen von einem erheblichen Gefährdungspotenzial der Douglasie ausgegangen werden muss? Kann im Umkehrschluss ein erhebliches Gefährdungspotenzial auf bestimmten Standorten begründet ausgeschlossen werden?
Eine Auswahl von wichtigen Ergebnissen wird in diesem Beutrag dargestellt.
2 Methoden
Die Basis der Untersuchung bildete eine Literaturstudie zur Douglasie. Schwerpunkte waren das Fruktifikations- und Verjüngungsverhalten der Douglasie sowie ökologische Aspekte des Douglasien-Anbaus im europäischen Raum (unter besonderer Berücksichtigung von Deutschland). In Kooperation mit dem Lehrstuhl für Waldwachstumskunde der Technischen Universität München (TUM) wurden als ein Projektschwerpunkt verschiedene Auswertungen von Inventurdaten aus dem bayerischen Staatswald vorgenommen, die verlässliche Aussagen zu Vorkommen, Alter und Verjüngung der Douglasie ermöglichen. Es handelt sich um sehr umfangreiche Daten (5203 Stichprobenpunkte mit Douglasie) überwiegend aus laufend durchgeführten, permanenten, standardisierten Inventuren.
Ergänzend wurden auch Auswertungen von Daten der Bundeswaldinventuren I und II durchgeführt, um Aussagen zum Vorkommen der Douglasie in den verschiedenen Waldbesitzarten treffen zu können. Die Daten der Bundeswaldinventuren I und II wurden aufgrund des bei dieser Bundes-Inventur groben Stichprobenrasters, der Seltenheit bzw. des sehr geringen Bestockungsanteils der Douglasie in Bayern und der damit verbundenen breiten Fehlergrenzen nur für die Ableitung von Tendenzen genutzt. Die Daten der BWI III liegen voraussichtlich erst ab Spätherbst 2014 vor und konnten (noch) nicht einbezogen werden.
Befragungen von Experten bildeten in der Methode des Projekts einen weiteren Schwerpunkt: Zum einen wurde eine Befragung von Staatswald-Revierleitern in Bayern durchgeführt. In 21 ausgewählten Forstbetrieben wurden alle Revierleiter befragt, in deren Revieren fruktifikationsfähige Douglasie nennenswerte Anteile am Waldaufbau aufweist. Die ausgewählten Forstbetriebe repräsentieren fast alle Wuchsgebiete, -bezirke und standörtlichen Einflussfaktoren in ganz Bayern. Der Fragebogen umfasste 17 Fragen zur Douglasie und ihrer Verjüngungsökologie; in die Auswertungen gingen 178 beantwortete Fragebögen ein.
Zusätzlich zu den Forst-Experten wurden in einer zweiten Befragung acht erfahrene Vegetationskundler und Naturschutz-Experten befragt.
3 Ergebnisse
3.1 Verbreitung der Douglasie in Bayern
Die Douglasie nimmt derzeit im bayerischen Staatswald einen im Vergleich zu benachbarten Bundesländern geringen Anteil an der Waldfläche von ca. 0,8 % ein (Projektauswertung). Bei Betrachtung aller Waldbesitzarten kommen in Bayern Douglasien auf ca. 0,6 % der Waldfläche oder auf ca. 13900ha ideeller Waldfläche vor (BWI II; vTI 2011). Direkt benachbarte Bundesländer, wie Hessen (3,1 %; 25530ha), Rheinland-Pfalz (5,7 %, 46270ha) oder Baden-Württemberg (2,8 %; 36400ha) weisen sowohl prozentual als auch von der ideellen Waldfläche her deutlich mehr Douglasie auf als Bayern.
Schwerpunkte der Verbreitung befinden sich vor allem in Unterfranken, speziell im nadelholzreichen Nordspessart, dem sogenannten „Glashütten-Spessart“. In variierendem Umfang kommt Douglasie aber auch in nahezu allen anderen Wuchsgebieten vor. Dabei dominieren die aus verstärkter Pflanztätigkeit („Douglasienwelle“) in den 1970er Jahren stammenden Douglasien der zweiten und dritten Altersklasse (Alter bis 60 Jahre). Wie Auswertungen der Bundeswaldinventuren I und II zeigen, hat die Douglasie vor allem im bayerischen Staatswald eine lange Anbautradition. Auch im Privatwald sind in nennenswertem Umfang Douglasien vorhanden, die aber im Durchschnitt etwas jünger sind.
Auswertungen von Inventurdaten zeigen, dass es sich bei der überwiegenden Mehrzahl (75 %) der Douglasienvorkommen im bayerischen Staatswald um Vorkommen von fruktifikationsfähigen Bäumen ohne Verjüngung am gleichen Stichprobenpunkt handelt. In lediglich 6 % der Fälle gibt es unter den (Alt-)Douglasien auch Verjüngung dieser Baumart. Bei den restlichen 19 % der repräsentierten Douglasienfläche handelt es sich um junge Douglasie ohne erfasste Altbäume.
3.2 Ausbreitungsdistanz der Samen
Aus den in die Literaturstudie einbezogenen Untersuchungen lassen sich zur Ausbreitungsdistanz der Samen folgende Zusammenhänge resümieren: Die Masse der Samen verbreitet sich nur über kurze Distanzen, die in der Regel 100 bis 200m nicht überschreiten (Broncano et al. 2005, Hermann & Lavender 1990, Sankey 2007). Eine seltene größere Verbreitungsdistanz geringer Samenmengen erklärt sich mit großen Baumhöhen, Freilandbedingungen und starkem Wind vor allem im Zusammenhang mit großflächigen Waldbränden (Lavender & Hermann 2014). Diese Einflüsse sind im amerikanischen Verbreitungsgebiet von Bedeutung, spielen in Deutschland dagegen kaum eine Rolle. Ein stark abweichender Extremwert (Verbreitung größerer Samenmengen über bis zu 2km und Entstehung von ganzen Douglasienbeständen in dieser Entfernung (Hermann & Lavender 1990) ist weder durch eigene Untersuchungen der Autoren oder Quellenangaben noch durch weitere Literaturstellen belegt. In dem von Lavender & Hermann (2014) neu veröffentlichten Standardwerk zur Douglasie ist diese Passage nicht mehr enthalten.
Eigene Untersuchungen im Rahmen des bayerischen Projekts zeigen, dass die Masse der Douglasien-Verjüngung sich unmittelbar unter den fruktifizierenden Bäumen und in einem Umkreis von 50m findet (Abb.1). Nennenswerte Verjüngung kommt noch in einer Entfernung bis etwa 100m und, in bereits deutlich abgestufter Häufigkeit, 200m von fruktifizierender (Alt-)Douglasie vor. Naturverjüngung in einer Entfernung von mehr als 200m um die Samenquelle ist selten und von geringer Dichte.
3.3 Einflussfaktoren auf die Etablierung der Douglasien-Verjüngung
Insbesondere die Nähe zu Douglasien-Altbäumen, ein hohes Lichtangebot und gute Bodendurchlüftung wurden von den befragten Forstexperten als besonders förderlich für die Etablierung von Douglasien-Verjüngung bewertet. Dagegen beeinflussen Fegeschäden durch Rehböcke, ein geringes Lichtangebot und eine schlechte Bodendurchlüftung die Verjüngung nach Einschätzung der Befragten besonders negativ. Der Einfluss von Faktoren wie Pilzkrankheiten, Schalenwildverbiss oder geringem Wasserangebot wurde dagegen für die Naturverjüngung der Douglasie als weniger bedeutsam eingeschätzt (Abb. 2).
Ein wichtiger Einflussfaktor ist auch das Alter der Douglasien. Nach Literaturangaben (Hermann & Lavender 1990) ist mit einer bis zum Baumalter von 200 bis 300 Jahren deutlich ansteigenden Samenmenge zu rechnen. Grundsätzlich fruktifiziert Douglasie in unregelmäßigen Abständen; Voll- und Halbmastjahre wechseln sich nach Literaturangaben etwa alle sieben Jahre ab (Hermann & Lavender 1990).
Die Qualität der Samen der Douglasie variiert stark. Die Hohlkornanteile (nicht keimfähige Samen) können bei der Douglasie nach Angaben des Bayerischen Amtes für forstliche Saat- und Pflanzenzucht (ASP) stark schwanken (ca. 15–85 %) (die genannten Hohlkornanteile beziehen sich auf gereinigtes Saatgut der Douglasie; sie sind bei Rohsaatgut noch deutlich höher und schwanken bei gereinigtem Saatgut stark). Vor allem in Verbindung mit jahrelang ausbleibender Baummast bzw. aufgrund von reduzierter Keimungsfähigkeit durch Inzuchtdepression (niedrige Individuenzahlen bei geringen Bestockungsanteilen) führen die Hohlkornanteile zu geringem Verjüngungserfolg (Konnert, schriftl. Mitt. 2012).
3.4 Das Verhalten der Douglasie als Mischbaumart
Die Douglasie kommt in Bayern überwiegend als mit anderen Baumarten vergesellschaftete Mischbaumart vor. In Naturverjüngungen sind geringe Anteile bis 5 % am häufigsten anzutreffen. Douglasien-Anteile von 5 bis 10 % oder auch von 10 bis zu 25 % kommen weniger oft vor. Noch höhere Anteile bis hin zu reinen (>90 %) Douglasien-Verjüngungen sind (sehr) selten (Projektauswertungen ST 289).
Die Douglasie verhält sich in gemischten Verjüngungen besonders häufig als Baumart, die in der Verjüngung mithält, ohne zu dominieren. Konkurrenzstarkes Verhalten der Douglasie in der Verjüngung liegt an zweiter Stelle. Als dritthäufigste Wuchskonstellation wurde auch Konkurrenzschwäche der Douglasie beschrieben. Dagegen wurde besonders konkurrenzstarkes oder ausgeprägt konkurrenzschwaches Wuchsverhalten, also eine sehr starke Abweichung in den Wuchsverhältnissen der Baumarten, nur sehr selten beschrieben (Projektauswertungen ST 289, siehe Abb. 3).
Die Situation in 500 kontrollierten bayerischen Douglasienvorkommen stellt sich ähnlich dar (Konnert, schriftl. Mitt. 2012; Feststellungen von Kontrollbeamten und Revisoren des Bayerischen Amtes für forstliche Saat- und Pflanzenzucht (ASP) in über 500 bayerischen Douglasienvorkommen). Eine dominante Douglasienverjüngung, die andere Baumarten verdrängen könnte, tritt dort in keinem Bestand auf. In mehr als der Hälfte der zwischen 45 und 80 Jahre alten Erntebestände, die in manchen Jahren gut fruktifizieren, fehlt die Verjüngung gänzlich. Douglasienverjüngung wird vor allem im Spessart beobachtet, aber dort sehr oft von der Buche verdrängt. Ähnliche Beobachtungen wurden bei Untersuchungen in bayerischen Naturwaldreservaten gemacht, in denen sich der Wald ohne aktive menschliche Steuerung entwickelt. (Ehemals gepflanzte) Douglasie kommt in derzeit 27 von 160 Reservaten in geringer Dichte vor und verjüngt sich in einzelnen Fällen spärlich (Endres & Förster 2013). Dabei ist ihr die Buche in der Verjüngung vor allem unter dem Schirm vorratsreicher geschlossener Altbestände überlegen.
3.5 Interaktionen mit der einheimischen Fauna
Der Neophyt Douglasie stellt in bayerischen Wäldern keinen „ökologischen Totraum“ dar (Gossner 2004). Interaktionen mit der heimischen Fauna finden in stark variierendem Umfang statt. Dies erklärt sich insbesondere auch damit, dass die Gattung Pseudotsuga erst seit Einbringung der Douglasie in Deutschland bzw. Bayern vertreten ist und somit an weitere Gattungsvertreter angepasste Arten bisher fehlen. Gossner fasst seine ökologischen Vergleichsuntersuchungen wie folgt zusammen: „Bei der Douglasie stehen dem Ausfall einzelner xylobionter Arten, für die in einer auch in Zukunft fichtendominierten Landschaft allerdings keine generelle Gefährdung besteht, die besondere Kronenstruktur und die besondere Nahrungsressource Douglasien-Wolllaus gegenüber. Bei einem regional geringen Douglasien-Anteil könnte die hohe Massenleistung der Douglasie mit einem befriedigenden Maß an ökologischer Leistungsfähigkeit verbunden werden. Dies ließe sich in Laubholz- (Buchen-) Grundbeständen mit weitständigen Douglasien am besten verwirklichen.“ Im Vergleich verschiedener Artgruppen an Fichte und Douglasie weist die Douglasie bei den xylobionten (speziell bei rindenbrütenden) Käfern eine geringere Abundanz (Fichte n=3226; Douglasie n=1907) auf. Deutliche Unterschiede zeigten sich speziell bei der Inkubation von Kronentotholz. In Bezug auf die absolute Artenzahl an xylobionten Arten (Fichte = 68; Douglasie = 66) zeigt sich dieser Effekt nicht.
Der Mischungsform der Wälder kommt eine Schlüsselrolle hinsichtlich der Interaktionsrate und der Ökosystemverträglichkeit zu. Die Integration der Douglasie als Mischbaumart (Abb. 4) wird oft als Kompromiss zwischen Ökologie und wirtschaftlichen Erwägungen herausgestellt (Fischer 2008, Gossner 2004). Ökologisch problematische Reinbestände (Gossner 2004) sind weder von forstlicher Seite noch von Seiten des Naturschutzes (Fischer 2008) gewollt.
3.6 Biologische Invasionsprozesse
Die Douglasie zeigt in Deutschland je nach regionaler Klimatönung, nach standörtlicher Ausstattung der Wuchsräume und nach aktueller Waldzustandsform ein differenziertes Ausbreitungsverhalten. Die Tendenz zur (kritisch zu bewertenden) Veränderung von naturschutzfachlich wertvollen Biotopen und Verdrängung einheimischer Arten mit internationaler Verantwortung („biologische Invasion“) kann lokal dort auftreten, wo ein wintermildes subatlantisch-submediterran geprägtes Klima und ausgedehnte silikatische Xerotherm-Komplexe zusammentreffen (Walentowski, schriftl. Mitt. 2012). Derartige Situationen wurden nach den Ergebnissen der durchgeführten Befragung von Vegetationskundlern bislang lediglich in Südwestdeutschland beobachtet (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Süd-Hessen), wo z.B. im Süd-Schwarzwald, im unteren Moseltal, im Nahetal und in Tälern ihrer Nebenflüsse steile Erosionslagen in klimagünstiger Lage zu finden sind.
In Bayern sind daher vor allem zwei Gebiete von Interesse, in denen aus edaphischen und klimatischen Gründen Invasivitätspotenziale bestehen könnten: zum einen der Donaurandbruch zwischen Regensburg und Passau mit silikatischen Xerotherm-Komplexen, zum anderen zum Maintal hin abfallende steile Hanglagen im forstlichen Teilwuchsbezirk Mainspessart. Die Befragung von Vegetationskundlern und Naturschutzexperten ergab jedoch, dass aktuell weder am Donaurandbruch noch in maintalnahen Steillagen des Buntsandsteinspessarts Invasionsprozesse der Douglasie zu beobachten sind.
4 Diskussion
4.1 Verbreitung der Douglasie in Bayern
Die Douglasie kommt im bayerischen Staatswald mit wenigen Ausnahmen in fast allen forstlichen Wuchsgebieten vor. Aus diesem Grund können die Ergebnisse dieser Untersuchung auf ein breites Spektrum von unterschiedlichen standörtlichen und klimatischen Wuchsbedingungen bezogen werden und sind auch auf andere Waldbesitzarten übertragbar. Die bekannten Verbreitungsschwerpunkte in Unterfranken (Wuchsgebiete Spessart-Odenwald und Rhön) sind gleichzeitig die ältesten Douglasienvorkommen, in denen das Vorhandensein von Naturverjüngung aufgrund örtlich günstiger Bedingungen besonders wahrscheinlich ist. Speziell im Nordspessart bieten das vergleichsweise hohe Alter der Douglasien und nadelholzdominierte Wälder auf armen Sandstandorten günstige Ausgangsvoraussetzungen (Standort, Oberbodenzustand) für die Verjüngung der Douglasie (siehe auch Annen 1998). In diesen alten Vorkommen ist zudem am ehesten mit dem Auftreten von Invasionsprozessen zu rechnen, da diese möglicherweise erst zeitverzögert nach einer sogenannten „lag-Phase“ auftreten (Kowarik 2010).
Nur 6 % der repräsentierten Douglasienfläche im bayerischen Staatswald entfällt auf Verjüngung der Douglasie unter Altbäumen, in mehr als drei Viertel der Fälle ist unter Altbäumen gar keine Verjüngung vorhanden – aufgrund des nachweislich engen räumlichen Zusammenhangs zwischen fruktifizierender Douglasie und Verjüngung sind dies Werte, die die Seltenheit von Naturverjüngung der Douglasie ausdrücken. Die auf 19 % der Fläche vorhandene Verjüngung der Douglasie ohne erfassten Bezug zu Altbäumen ist vor allem durch die kontinuierlich durchgeführte Pflanzung von junger Douglasie zu erklären, repräsentiert also vor allem künstliche Verjüngung. Anteile natürlicher Verjüngung der Douglasie in diesem Wert können zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden (z.B. abgedeckte Naturverjüngungen oder Lage des Altbaumes außerhalb des Aufnahmeradius). Der nachweisbar enge räumliche Bezug zwischen Altdouglasie und Verjüngung als auch das Vorhandensein von umfangreichen Kunstverjüngungsflächen lassen jedoch nur geringe Anteile an Naturverjüngung in diesem Wert zu.
Eine hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit der Douglasie kann somit in Bayern nicht beobachtet werden – eher das Gegenteil ist der Fall. Das eher geringe durchschnittliche Alter der bayerischen Douglasien ist zwar ein Teil einer Erklärung für den spärlichen Verjüngungserfolg. Eine zukünftige „Douglasienschwemme“ durch eine mit dem Alter der Bäume steigende Menge an produzierten Samen ist jedoch nicht zu erwarten (Annen 1998). Der angestrebte Zieldurchmesser („Zielstärke“) der Bäume liegt meist bei 50–70cm (Zielstärken im Bayerischen Staatswald, Forsteinrichtungsrichtlinie 2011), je nachdem, ob durchschnittliches Sägeholz oder hochwertiges Wertholz heranwachsen soll. Douglasien erreichen diese Dimension bereits im Alter von ca. 80 bis 140 Jahren. Sie werden in der Regel lange vor dem Zeitpunkt gefällt, zu dem die Fruktifikationsleistung ihr Maximum erreicht. Zusätzlich zur zeitlichen Begrenzung der Fruktifikation durch die frühe forstwirtschaftliche Nutzung der Bäume wird der Verjüngungserfolg stets durch zahlreiche weitere Einflüsse limitiert (siehe auch Abschnitt 4.4).
4.2 Ausbreitungsdistanz der Samen
Die von den Samen erreichte Flugweite bestimmt in hohem Maß die Fähigkeit einer Baumart zu einer schnellen, raumgreifenden Ausbreitung. Bei zu dieser Thematik vorliegenden (amerikanischen) Untersuchungen sollte beachtet werden, dass nicht alle genannten Faktoren, wie Baumhöhe, Art der Waldbewirtschaftung, Auftreten von Stürmen und großflächigen Waldbränden (Lavander & Hermann 2014), auf europäische Bedingungen übertragbar bzw. zutreffend sind. Die Baumhöhen der Douglasien sind in den bayerischen Beständen niedriger (in der Regel deutlich unter 60m). Die Waldbausysteme unterscheiden sich zudem deutlich, da im amerikanischen Herkunftsgebiet vorkommende flächige Kahlschläge in Bayern im Rahmen einer sachgemäßen Forstwirtschaft kaum eine Rolle spielen. Bereits aus diesen Gründen ist in Deutschland grundsätzlich von geringeren Verbreitungsdistanzen auszugehen.
Immer wieder wird (auch) in der deutschsprachigen Literatur eine amerikanische Veröffentlichung zitiert (Hermann & Lavender 1990), in der die maximale Samenflugweite größerer Samenmengen der Douglasie mit bis zu 2km angegeben wird. Als Quelle beziehen sich die Autoren auf Dick, der 1955 den Samenflug der Douglasie im Süd-Westen Washingtons untersuchte. Dicks Untersuchungen belegen allerdings nicht eine Samenflugweite von bis zu 2km (erster Halbsatz), sondern die abgestufte Verbreitung der Samen nur über Kurzdistanzen bis in ca. 240m Entfernung (zweiter Halbsatz). Eine Verfrachtung größerer Samenmengen oder gar die Etablierung ganzer Bestände durch über sehr weite Distanzen verfrachtete Douglasien-Samen ist somit nicht belegt und zudem auch inhaltlich unplausibel. Die „2-km-Behauptung“ ist in einer sehr ausführlichen, aktuellen Veröffentlichung der beiden Autoren (Lavender & Hermann 2014) auch nicht mehr erwähnt.
Folgende Angaben können als gesichert gelten: Die überwiegende Masse der keimungsfähigen Douglasien-Samen breitet sich nur über Kurzdistanzen aus (Fowells 1965; Issac 1930 Lavender & Hermann 2014), wobei die Verjüngungsdichte mit zunehmender Entfernung stetig abnimmt. Dieses Muster der Kurzstreckenverbreitung der Douglasiensamen von bis zu 200m wird durch die Ergebnisse eigener Untersuchungen im bayerischen Staatswald bestätigt (Abb. 1). Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Douglasie ist gering.
4.3 Einflussfaktoren auf die Verjüngung der Douglasie
Das Alter der fruktifizierenden Douglasien und die Flugweite der Samen sind wichtige Aspekte der Verjüngungsökologie. Wie bereits dargestellt wurde, wirken sich zudem zahlreiche weitere Faktoren positiv oder negativ auf die Etablierungswahrscheinlichkeit von Douglasien-Verjüngung aus. Dies sind zum einen standörtliche Faktoren (Annen 1998, Knoerzer 1999). Zwar kann die Douglasie auf besseren Standorten grundsätzlich wachsen (d.h. Standorte mit einer „guten Wasserversorgung, wenig exponierte Lagen mit Laubförnauflagen oder sehr guten Humusformen, Bereiche mit oberflächlicher Schutt- oder Grusbewegung, höheren pH-Werten und meist Basenreichtum und einem sehr dichten Kronendach“; Knoerzer 1999).) Jedoch ist dort auch bei vermehrtem Lichtgenuss keine massiv aufkommende Douglasienverjüngung festzustellen (Annen 1998, Knoerzer 1999). In der Regel handelt es sich um Laubholzstandorte, auf denen einige heimische Baumarten, insbesondere die Buche, ausgeprägt konkurrenzkräftig sind und sich gegenüber der meist ohnehin nur in geringen Anteilen vorhandenen Douglasie durchsetzen.
Verknüpft sind die Konkurrenzsituation in der Verjüngung und andere bestimmende Faktoren wie die Lichtverfügbarkeit sowohl mit dem Standort als auch mit dem Ausgangsbestand. Günstige Bedingungen für eine natürliche Verjüngung findet die Douglasie beispielsweise auf armen Buntsandsteinstandorten in wintermilden Lagen (Annen 1998) und dort speziell in Nadelholzbeständen (u.a. Knoerzer 1999, Kowarik 2012), wo sie als langlebige Halbschattbaumart in Mischung mit weiteren Baumarten strukturreiche Nadelmischwälder aufbauen kann (Walentowski 2008). Ist der Ausgangsbestand dagegen laubholzdominiert, beispielsweise ein Buchen-(Rein-)Bestand, sinken die Chancen der Douglasie stark, sich erfolgreich natürlich zu verjüngen (z.B. Knoerzer 1999; Konnert, schriftl. Mitt. 2012; Walentowski, schriftl. Mitt. 2012).
Die hohe Konkurrenzkraft der Buche auf vielen für sie günstigen Waldstandorten Bayerns verhindert oft eine Etablierung von Douglasien-Naturverjüngung oder verdrängt im Wachstumsgang eventuell vorhandene Douglasie nach und nach. In Buchenbeständen im Südspessart können durch Buchenverjüngung ablaufende Verdrängungsprozesse gegenüber der Naturverjüngung der Douglasie trotz eines drei- bis vierjährigen Wuchsvorsprungs der Douglasie beobachtet werden. Massiv aufkommende Buchenverjüngung reduzierte die Douglasien-Anteile auf geringe Reste. Diese Prozesse sind, auch ohne Einflussnahme des wirtschaftenden Menschen, in bayerischen Naturwaldreservaten zu beobachten (Endres & Förster 2013).
Zusammenfassend ist für die bayerischen Verhältnisse festzustellen, dass die Douglasie sich vor allem dort natürlich verjüngen kann, wo anthropogen stark veränderte Nadelbaumgesellschaften auf armen Standorten mit wintermilder Klimatönung ihr entsprechend günstige Bedingungen bieten. Aus der Verbreitung von anthropogen beeinflussten Nadelwäldern in Bayern kann jedoch nicht per se ein hohes Ausbreitungspotenzial der Douglasie abgeleitet werden: Die Wälder stocken nicht nur auf armen Böden, sondern häufig auch auf reicheren Standorten bzw. wachsen unter klimatischen Verhältnissen, die die Konkurrenzkraft der Douglasie und ihre Fähigkeit zu einer erfolgreichen Verjüngung einschränken. Auf diesen reicheren Standorten, besonders ausgeprägt in Buchenwäldern, kann die Douglasie keine flächenhafte Dominanz entfalten und wird oftmals bereits im Verjüngungsstadium von der konkurrenzkräftigen Buche verdrängt. Diese Zusammenhänge beschränken das Ausbreitungspotenzial der Douglasie deutlich.
Aus der Literatur ist nur ein sehr enges standörtliches Spektrum beschrieben, auf dem sich die Douglasie in Süddeutschland erfolgreich verjüngt und gleichzeitig zur starken Dominanz über dort natürlich vorkommende heimische Baumarten neigt. Betroffen sind durchweg solche Standorte, auf denen die heimischen Baumarten nur eine eingeschränkte Vitalität entfalten und zum Krüppelwuchs neigen. Auch in Bayern kommen solche als „trocken, sauer, basenarm und meist hell“ beschriebene Sonderstandorte (Knoerzer 1999) in einem eng begrenzten Umfang von etwa 300ha Fläche oder 0,012 % der bayerischen Waldfläche vor. Sie liegen am Donaurandbruch bei Regensburg und in den zum Maintal hin steil abfallenden Hanglagen des Mainspessarts. Innerhalb dieser Suchkulisse kommt Douglasien-Naturverjüngung in Teilbereichen einer 70ha großen Fläche vor. Dort zeigt sich die Douglasie gegenüber heimischen Baumarten (Krüppelwuchs) wuchsüberlegen, verjüngt sich gleichzeitig aber nur in geringen Dichten in der Umgebung der Samenbäume. Sie kann daher mit geringem Aufwand und dauerhaft aus diesen naturschutzfachlich wertvollen Flächen entfernt werden, da Douglasie nicht zu Stockausschlag oder zu vegetativen Vermehrungsstrategien befähigt ist. Allgemein ist zu vermuten, dass das Ausbreitungsvermögen der Douglasie am Donaurandbruch im Vergleich zu benachbarten Bundesländern bereits durch subkontinentale Klimaeinflüsse limitiert sein könnte (Walentowski, schriftl. Mitt. 2012). In den zum Maintal hin abfallenden Hanglagen fehlen gegebenenfalls ausgeprägte Xerotherm-Komplexe. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf.
5 Fazit
Die Ausdehnung von Naturverjüngungsflächen mit Douglasien-Anteilen ist derzeit deutlich geringer als die Fläche, die mit fruktifikationsfähiger Douglasie bestockt ist. Die Fruktifikation der älteren Douglasie bildet sich also im Verjüngungsbild nur eingeschränkt ab. Das ist kein Zufallsbefund: Zum einen wird die Fruktifikationsleistung der Altbestände durch natürliche und anthropogene Einflüsse begrenzt, zudem wirken eine Vielzahl von Faktoren nachweisbar auf den Verjüngungserfolg ein. Die Etablierung und Entwicklung von Douglasien-Verjüngung ist also kein zufälliges Ereignis, das unkontrolliert und unkontrollierbar ist. Vielmehr ergeben sich Möglichkeiten zu einer gezielten Beeinflussung und einer Steuerung der Verjüngung. Dies gilt sowohl für die Förderung der Naturverjüngung als auch für die Reduktion: Sofern die Etablierung der Douglasie z.B. aus forstlichen Gründen (z.B. abweichende Verjüngungsplanung) oder naturschutzfachlichen Aspekten (z.B. Gefährdung der Erhaltungsziele) unerwünscht ist, können durch gezielte Steuerungs- und Pflegemaßnahmen die Anteile der Douglasie effektiv und dauerhaft reduziert werden.
Die Douglasie verhält sich in Bayern überwiegend als eine pflegliche Mischbaumart, die in Verjüngungen mit anderen Baumarten mithält, sie aber nicht dominiert. Das gilt nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ für die meist nur geringen Anteile der Douglasie in Mischverjüngungen. Eine Bildung von Reinbeständen der Douglasie auf dem Weg der Naturverjüngung findet somit kaum statt. Damit erfüllt sich durch reguläre ökosystemare Abläufe die sowohl von Forst- als auch Naturschutzvertretern aufgestellte Forderung, Douglasien-Reinbestände zu vermeiden. Die Beteiligung der Douglasie in geringen Anteilen als standortgemäße Mischbaumart entspricht den häufig in ähnlicher Weise formulierten Handlungsempfehlungen in ökologischen Untersuchungen.
Multifunktionale Forstwirtschaft muss heute mehr denn je ein breites Spektrum an z.T. divergierenden Ansprüchen und Interessen angemessen berücksichtigen. Das Ziel multifunktionaler, naturnaher Forstwirtschaft besteht darin, stabile, gemischte Wälder zu schaffen, zu erhalten und zu optimieren, die ökologische, aber auch ökonomische und soziale Funktionen auf der gesamten Fläche erfüllen. Dabei werden standortheimische Waldbäume bevorzugt berücksichtigt, weitere aus fachlicher Sicht geeignete standortgemäße Baumarten aber nicht generell ausgeschlossen. Dies trifft auch für die nicht einheimische Douglasie zu. Der Anbau nicht einheimischer Baumarten verlangt, ganz unabhängig von der Frage einer möglichen Invasivität, stets eine intensive fachliche Abwägung, die auch naturschutzfachliche Kriterien einbezieht. Die Untersuchungsergebnisse deuten im Fall der Douglasie darauf hin, dass ihre Beteiligung am Waldaufbau in Bayern als standortgemäße Mischbaumart in bemessenen Anteilen mit dem Leitgedanken der multifunktionalen Forstwirtschaft vereinbar ist.
6 Ausblick
Das Verjüngungspotenzial einer Baumart, das den Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung bildete, gibt wichtige Hinweise auf die Fähigkeit einer Art, sich etwa durch Anzahl oder Konkurrenzstärke in Ökosystemen zu behaupten. So kann festgestellt werden, ob eine gebietsfremde Baumart in der Lage ist, auf bestimmten Standorten heimische Waldgesellschaften quantitativ negativ zu beeinflussen oder nicht. Über derartige Untersuchungen können also „Problemkonstellationen“ identifiziert und auch quantifiziert werden.
Invasive Arten können jedoch nicht nur über quantitative Mechanismen (wie z.B. massenhaftes Aufkommen, Verdrängung), sondern ggf. auch in qualitativer Hinsicht wirken: Damit sind beispielsweise komplexe ökologische Wechselwirkungen zum Nachteil heimischer Arten gemeint. Bei der Douglasie ist trotz ihrer hohen Relevanz für Forstwirtschaft und Naturschutz in diesem Themenfeld die Anzahl an Untersuchungen noch sehr gering. Eine abschließende, fundierte Beurteilung aller ökologischen Auswirkungen der Douglasie auf heimische Arten ist daher zum jetzigen Zeitpunkt (noch) nicht möglich. Um diesen wichtigen Aspekt ausführlich zu bearbeiten, befindet sich derzeit ein weiteres Forschungsprojekt in der Planungsphase. Es soll sich vor allem mit den Auswirkungen verschiedener Anbau-Varianten der Douglasie auf ausgewählte heimische Arten und Ökosysteme befassen.
Literatur
Ammer, C., Arenhövel, W., Bauhus, J., Bolte, A., Degen, B., Dieter, M., Erhard, H.-P., Erler, J., Hein, S., Kätzel, R., Konnert, M., Leder, B., Mosandl, R., Spellmann, H., Schölch, M., Schmidt, O., Schmidt, W., Schmitt, U., Spathelf, P., v. Teuffel, K., Vor, T. (2014): Offener Brief deutscher Forstwissenschaftler vom 04.Juni 2014 an das BfN. http://www.waldbau.uni-freiburg.de/news_events/off_brief_neopht_anBFN.
Annen, H. (1998): Zum Einfluss von Oberbodenzustand und Zustand auf Samenkeimung und Verjüngungsdichte der Douglasie in Südwestdeutschland. Schriften aus dem Waldbau-Institut der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Dick, J. (1955): Studies of Douglas Fir seed flight in South Western Washington. Weyerhaeuser timber company.
Endres, U., Förster, B. (2013): Die Douglasie in Naturwaldreservaten – passt das zusammen? LWF aktuell 93, 37-39.
Fischer, A. (2008): Die Eignung der Douglasie im Hinblick auf den Klimawandel. LWF Wissen 59, 63-66.
Gossner, M. (2004): Diversität und Struktur arborikoler Arthropodenzönosen fremdländischer und einheimischer Baumarten. Ein Beitrag zur Bewertung des Anbaus von Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) und Roteiche (Quercus rubra L.). Kowarik, I., Starfinger, U., Hrsg., TU Berlin, NEOBIOTA 5.
– (2004): Nicht tot, aber sehr anders! Arthropodenfauna auf Douglasie und Amerikanischer Roteiche. LWF aktuell 45, 10-11.
Hermann, R.K., Lavender, D.P. (1990): Douglas-fir. In: Burns, R.M., Honkala, B.H., eds., Silvics of North America. (Volume 1: Conifers), Agriculture handbook 654, Forest Service U.S.D.A., Washington, D.C. S. 527-540. http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/silvics_manual/volume_1/silvics_vol1.pdf.
Isaac, L.A. (1930): Seed flight in the douglas fir region. Journal of forestry, Pacific Northwest Forest Experiment Station.
Knoerzer, D. (1999): Zur Naturverjüngung der Douglasie im Schwarzwald. Inventur und Analyse von Umwelt- und Konkurrenzfaktoren sowie eine naturschutzfachliche Bewertung. Ausbreitung der Douglasie im Schwarzwald. J. Cramer, Berlin.
Kowarik, I. (2010): Biologische Invasionen – Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. 2. Aufl. Ulmer, Stuttgart.
– (2012): Exoten unter uns. Fakten und Weltanschauungen. Vortrag im Rahmen der Tagung: „Fremdländische Baumarten: Fluch oder Segen?“. Evangelische Akademie Tutzing, 03.–05. Februar 2012.
Lavender, D.P., Hermann, R.K. (2014): Douglas-fir: The Genus Pseudotsuga. Oregon State University. College of Forestry. Forest Research Laboratory. http://hdl.handle.net/1957/47 168.
Lerchenfeld, L.v. (2008): Heinersreuth setzt auf die Douglasie. LWF Wissen 59, 88-91.
Okubo, A., Levin, S.A. (1989): A theoretical Framework for Data Analysis of Wind Dispersal of Seeds and Pollen. Ecology 70, 329-338.
Reif, A., Brucker, U., Kratzer, R., Schmiedinger, A., Bauhus, J. (2010): Waldbau und Baumartenwahl in Zeiten des Klimawandels aus Sicht des Naturschutzes. Abschlussbericht eines F+E-Vorhabens im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. FKZ 3508 84 0200. BfN-Skripten 272.
Sankey, T.T. (2007): Spatial patterns of Douglas-fir and aspen forest expansion. New Forests 35 (1), 45-55.
Schmidt, O., Konnert, M. (2012): Die Douglasie in Bayern – Perspektiven im Klimawandel. Positionspapier der LWF und des ASP. AFZ-Der Wald 18, 30-34.
Slow, L.J. (1954): Douglas fir regeneration on the Kaingaroa plains, Rotorua Conservancy. N.Z. Journal of Forestry, 83–89.
Von Thünen-Institut (Hrsg., 2011): Zum Douglasienanbau in Deutschland. Ökologische, waldbauliche, genetische und holzbiologische Gesichtspunkte des Douglasienanbaus in Deutschland und den angrenzenden Staaten aus naturwissenschaftlicher und gesellschaftspolitischer Sicht. Braunschweig.
Walentowski, H. (2008): Die Douglasie aus naturschutzfachlicher Sicht. LWF Wissen 59, 67-69.
Anschrift des Verfassers: Martin Eggert, ehemals Abteilung Waldbau und Bergwald an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF); jetzt: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 München, E-Mail Martin.Eggert@stmelf.bayern.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

![Abb. 2: Bewertung von Einflussfaktoren, die auf den Erfolg von natürlicher Verjüngung der Douglasie einwirken [fünfstufige Bewertung von sehr positiv (++) über indifferent (0) bis sehr negativ (--); Quelle: Projektauswertungen ST289; Forstexpertenbefragung].](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/graphic-export-2054-0950541_gq2tkmjuguyq-150x80.jpg)




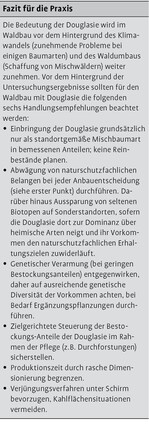
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.