Die intergenerationell differenzierte Konstruktion von Landschaft
Abstracts
Konstruktivistische Ansätze der Landschaftsforschung gehen davon aus, dass Landschaft nicht als gegebener Gegenstand zu verstehen ist, sondern als soziale und individuelle Konstruktion. Aus dieser Perspektive gewinnt die Frage an Bedeutung, inwiefern sich gesellschaftliche Konstrukte von Landschaft im Allgemeinen und Wald im Besonderen voneinander unterscheiden. Diese Unterschiede finden sich zwischen unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Milieus und, wie in diesem Beitrag dargestellt, intergenerationell. Die Ergebnisse der quantitativen Studie als Teil des Projekts „Wertvoller Wald“ zeigen zahlreiche signifikante bis hochsignifikante Unterschiede bei der sozialen Konstruktion von Wald im intergenerationellen Vergleich. So nimmt bei Jüngeren die Tendenz ab, sich Wald durch unmittelbare Auseinandersetzung anzueignen, während die Tendenz zunimmt, sich Wissen durch sekundäre Quellen anzueignen. Ferner präferieren Jüngere stärker natürliche Waldbilder als Ältere. In der Kinder- und Jugendzeit der Älteren waren einerseits Wälder stärker nach dem Prinzip der „Ordnung“ gestaltet, andererseits galt „Ordnung“ als besonderer Wert.
Construction of Landscape Differentiated Between Generations – Results of an empiric study on the perception of forest
Constructivist approaches to landscape research assume that landscape is not to be understood as a given object but as a social and individual construction. From this perspective, the question gains significance as to what extent social constructs of landscape in general and forest in particular differ from each other. These differences can be found between different cultural backgrounds, environments and, as shown in this paper, intergenerationally. The results of the quantitative study as part of the project ‘Wertvoller Wald’ (,Precious Forest‘) show numerous significant to highly significant differences in the social construction of forest in intergenerational comparison. In younger people, the tendency decreases to acquire forest by direct confrontation against the increasing trend to acquire knowledge through secondary sources. Furthermore, younger people prefer more natural forest images as the elderly. In the childhood and youth of the elderly on the one hand forests were cultivated more ‘orderly’, on the other hand ‘order’ was a special value.
- Veröffentlicht am
1 Einleitung
Landschaft entsteht – gemäß konstruktivistischer Ansätze der Landschaftsforschung – durch die Zusammenschau unterschiedlicher Elemente auf Grundlage sozial vermittelter Deutungs- und Bewertungsmuster (siehe z.B. Burckhardt 2006, Kühne 2006 und 2013). Neben unterschiedlichen kulturellen Konstruktionen (z.B. in Bezug auf einen interkulturellen Kontext, wie dem deutschen und dem chinesischen Sprachraum; siehe Bruns 2013) finden sich auch Unterschiede hinsichtlich sozialer Aspekte bei der Konstruktion von Landschaft (beispielsweise hinsichtlich Alter, Bildung, Geschlecht; wie bei Kühne 2006). Der vorliegende Beitrag befasst sich mit diesen Unterschieden bei der sozialen Konstruktion von Landschaft eigens mit der Frage, wie unterschiedlich Landschaft, hier am Beispiel von Wald, von Personen unterschiedlichen Alters konstruiert wird.
Die hier vorgestellten Ergebnisse wurden im Kontext einer sozialwissenschaftlichen Studie zum Thema der Wahrnehmung von Alt- und Totholz sowie zur symbolischen Konnotation von Wald im Rahmen des Projektes „Wertvoller Wald“ des Naturschutzbundes (NABU) Saarland ermittelt. Das Projekt wird gefördert mit Mitteln des Bundesprogramms Biologische Vielfalt des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). Die Datenerhebung erfolgte mittels einer Online-Befragung zwischen dem 13.09.2013 und dem 31.10.2013 (Näheres unter http://www.wertvoller-wald.de ).
Der vorliegende Beitrag befasst sich zunächst mit der Frage, wie Menschen Landschaft im Allgemeinen und Wald im Besonderen konstruieren. Im Anschluss daran werden Ergebnisse der Studie in Bezug auf demographische Unterschiede im Kontexte der sozialen Konstruktion von Landschaft dargestellt. Darauf folgt die Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund sozialkonstruktivistischer Landschaftstheorie. Dabei wird auch die Frage behandelt, wie infolge einer nach Alter differenzierten Konstruktion von Wald die Effektivität der Kommunikation zu Inhalten der naturnahen Waldwirtschaft gesteigert werden kann.
2 Aspekte der sozialen Konstruktion von Landschaft und Wald
Unser Wissen über die Welt ist durch soziale Prozesse bestimmt: „Nirgends [gibt es] so etwas wie reine und einfache Tatsachen“ (Schütz 1971 [1962]: 5), schließlich ist Wissen das Ergebnis „eines sehr komplizierten Interpretationsprozesses, in welchem gegenwärtige Wahrnehmungen mit früheren Wahrnehmungen“ (Schütz 1971 [1962]: 123-124) in Verbindung gebracht werden. Dabei ist der größte „Teil des Wissensvorrates des normalen Erwachsenen nicht unmittelbar erworben, sondern ‚erlernt‘“ (Schütz & Luckmann 2003 [1975]: 332). In Bezug auf Landschaft bedeutet dies: Die Mechanismen der Zusammenschau bestimmter Elemente in räumlicher Anordnung zu „Landschaft“ sind Teil eines gesellschaftlichen Vermittlungsprozesses. Die Landschaft konstruierende Person greift auf erlernte und verinnerlichte Deutungs- und Wertungsmuster zurück und ist darum bemüht, das Wahrgenommene in eine (möglichst widerspruchsfreie) Beziehung zum Wissen zu bringen. Dieses Erlernen von dem, was Landschaft genannt wird, und wie diese zu typisieren und zu beurteilen ist, ist Teil eines mittlerweile lebenslangen Sozialisationsprozesses, wobei insbesondere die Kindes- und Jugendjahre eine besondere Bedeutung für die Prägung von landschaftlichen Deutungsmustern einnehmen. Die Vermittlung erfolgt mehr (durch Schulunterricht, Schulbücher, Klassenausflüge) oder minder (durch Eltern, Verwandte, die Gleichaltrige) systematisch (vgl. Kook 2009, Kühne 2008). Landschaftliche Deutungsmuster sind dabei kulturell differenziert (Bruns 2013) und unterliegen zeitlich einem Wandel (z.B. Kühne 2013). Im Folgenden soll die historische Entwicklung der sozialen Konstruktion von Wald für den deutschen kulturellen Kontext dargestellt werden. Diese historische Herleitung erleichtert die Deutung der Ergebnisse der Befragung im folgenden Abschnitt.
Insbesondere in Deutschland erfährt Wald – im interkulturellen Vergleich – eine große soziale Wertschätzung. Dem Wald – genauer dem deutschen Wald – wird eine identitätsstiftende Bedeutung zugeschrieben (Lehmann 2001). Diese Identitätsstiftung nahm mit der Mystifizierung der Varusschlacht in der Romantik ihren Anfang: Sind die Deutschen (bzw. die zu ihren Vorfahren erklärten Germanen) geeint, werden sie gemeinsam mit ihrem Wald als unbesiegbar verklärt. In der Romantik wurzelt auch die Mythologisierung der Eiche, die zu „ein[em] Sinnbild für Ewigkeit des so genannten germanischen Ursprungsvolkes“ (Urmersbach 2009: 76) erklärt wurde. Auch die Buche unterliegt einer hohen symbolischen Aufladung: Die Wörter „Buchstabe“ und „Buch“ kommen von der Buche, da Germanen Schriftzeichen in Buchenstäbe ritzten, auch rund 1500 Ortsnamen in Deutschland gehen auf die Buche zurück. Wald wird bis in die Gegenwart positiv mit einem „natürlichen Zustand“ konnotiert. Zugleich wird er mit Personen verbunden, deren Aktivitäten als gesellschaftlich abweichend gelten: So beschreibt die Märchenwelt die Aktivitäten von Wilderern, Räubern, Hexen, Feen und anderen (Urmersbach 2009). Diese Tradition der Verbindung von Wald und Abweichung von gesellschaftlichen Handlungsnormen wird bis heute perpetuiert, wie u.a. Endes Erzählung „Die unendliche Geschichte“ mit ihren jeweiligen Verfilmungen, im internationalen Kontext, aber beträchtlicher Wirkmächtigkeit auch im deutschen Sprachraum: Tolkiens „Herr der Ringe“, die Produktion der Serie „Game of Thrones“ u.v.a. nahelegen (vgl. Heck 2010). Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde dem Wald eine politisch-pädagogische Bedeutung zugeschrieben, der „Wald möge den Menschen und seine Welt verbessern“ (Urmersbach 2009: 85). Die Wandervogel- und die Heimatschutzbewegung luden den Wald symbolisch als Alternative zu Industrialisierung, Individualisierung und Rationalisierung auf. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde diese Konnotation gemeinsam mit dem Mythos des „deutschen Waldes“ zu propagandistischen Zwecken und zur Erzeugung von Überlegenheitsphantasien herangezogen (vgl. Körner 2006). Der Heimatfilm der 1950er Jahre lässt sich als – wohl gelungener – Versuch der Rehabilitation des (deutschen) Waldes von der Nazi-Propaganda deuten, indem er wiederum als edles und wildes Stück Natur inszeniert wurde – „das Einfache, so romantisch, so schön, so völlig unpolitisch“ (Urmersbach 2009: 105).
Die intensive symbolische positive Besetzung des Waldes in Deutschland lässt die hohe gesellschaftliche Resonanz nachvollziehbar werden, die das „Waldsterben“ ausgelöst hat: Es hat „eine Krise der Kultur bewirkt und das gegenwärtige politische Bewusstsein vieler Zeitgenossen sehr weitgehend beeinflusst“ (Lehmann 1996: 145). So dient der Wald bis heute weithin als ästhetische Landschaftskulisse, er gilt als Symbol für ein harmonisches Zusammenleben von Bäumen unterschiedlicher Art und unterschiedlichen Alters (Lehmann 2001). Die die quantitative bzw. qualitative sozialwissenschaftliche Untersuchung der Bedeutung von Wald im deutschen Sprachraum blieb – der großen Aktualität des Themas zum Trotz – in den vergangenen Jahren eher verhalten: Im Jahr 2010 fand eine Studie zur sozialen Bedeutung von Wald mit 3000 Schweizern statt (Hunziker et al. 2012). Die Befragten schätzten die typischen Waldgerüche und Naturgeräusche, wobei eine Bevorzugung von Mischwäldern gegenüber reinen Laub- oder Nadelbaumbeständen festzustellen war. In Wäldern genießen Quellen, Bäche, Teiche und Tümpel eine starke Wertschätzung, während Totholz als störend empfunden wurde. Als die wichtigsten Funktionen des Waldes gelten „Lebensraum für Tiere“, gefolgt von „Schutz vor Naturgefahren“ und „Luft- und Wasserqualität“ sowie „gliedert und verschönert Landschaft“ (ähnliche Ergebnisse finden sich für Deutschland bei Kleinhückelkotten et al. 2009). Der hohen ästhetischen Wertschätzung von und emotionalen Zuwendung zu Wald zum Trotz sind die kognitiven Kenntnisse über Wald eher gering ausgeprägt (Lehmann 2001).
3 Alter und soziale Konstruktion von Wald
Die vorliegende Untersuchung bezieht sich auf eine Stichprobe. Da eine Stichprobe nie der Merkmalsverteilung der Gesamtpopulation entspricht, ist „die Redeweise von der „repräsentativen Stichprobe“ [...] nicht mehr als eine Metapher, eine bildhafte Vergleichung“ (Diekmann 2003: 368; vgl. auch Kromrey 2002). Von den Befragten machten n=1546 Angaben zu ihrem Alter. Personen, die keine Angabe zu ihrem Alter machten, wurden für diese Auswertung ausgeschlossen, da sich diese explizit auf die Auswertung der Altersvariable bezieht. 0,9 % der Befragten gaben ein Alter von bis zu 15 Jahren an, 10,7 % von 16 bis 25, 35,6 % von 26 bis 45, 40,5 % von 46 bis 65 und 8,7 % von über 65 Jahren. Die Altersverteilung der Befragten zeigt eine Dominanz der Alterskohorten mittleren Alters. Die üblicherweise festzustellende Dominanz älterer Kohorten (Diekmann 2003) bei Erhebungen lässt sich, vermutlich der Erhebungsmethode der Online-Befragung geschuldet, nicht feststellen. Somit ist in diesem Kontext eine stärkere Annäherung an die Repräsentativität festzustellen. Aufgrund des geringen Stichprobenumfanges der Alterskohorte der bis zu 15-Jährigen sind diese Angaben für eine statistische Auswertung ungeeignet, werden allerdings der Vollständigkeit halber – teiltransparent – ebenfalls dargestellt.
Wald stellt im westlichen Kulturkreis gegenwärtig einen wichtigen Aktivitätsraum dar, insbesondere in Bezug auf Freizeit. Hinsichtlich zwei von drei am häufigsten genannten Aktivitäten, während derer Wald wahrgenommen wird (also auf Wanderungen und vom Fahrrad aus; Abb. 1), finden sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Altersdifferenzierung.
[Die Signifikanz wurde mit dem Chi-Quadrat-Test unterzogen. Der Chi-Quadrat-Test prüft, ob und mit welcher Signifikanz ein Zusammenhang zwischen zwei Datensätzen besteht. Je kleiner der Wert, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zusammenhang besteht. Ist der Wert beispielsweise <0,05 kann mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95 % davon ausgegangen werden (oder mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 5 %), dass tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den beiden Annahmen besteht (signifikant). Bei einem Wert >0,01 ist die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs sogar größer als 99 %, also ist das Ergebnis hochsignifikant.]
Hinsichtlich der Wahrnehmung in Dokumentarfilmen zeigt sich eine signifikant (also einer Irrtumswahrscheinlichkeit von <5 %) höhere Neigung in der Kohorte der 16- bis 25-Jährigen, Wald durch dieses Medium wahrzunehmen, als dies in den älteren Kohorten der Fall ist. Eine stärkere Differenzierung der Wahrnehmung von Wald findet sich auch in den weniger häufig genannten Aktivitäten, teilweise auf hohem Signifikanzniveau: Während mit dem Alter die Neigung steigt, Wald auf Reisen (signifikant) bzw. in Bildbänden (hochsignifikant; signifikant (also einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 1 %) wahrzunehmen, nehmen Jüngere Wald vom Auto (signifikant), vom Zug (hochsignifikant), in Gemälden (hochsignifikant), in der Phantasie (hochsignifikant), in Romanen (hochsignifikant), im Internet (hochsignifikant) und in der Film- und Fernsehwerbung (signifikant) wahr.
Diese Ergebnisse zeigen eine zunehmende Bedeutung der medialen Konstruktion von Wald insbesondere bei jüngeren Menschen. Dieser Befund lässt sich als ein spezielles Beispiel der zunehmenden Konstruktion von Welt beschreiben, der eingebettet ist in den Kontext einer generell zunehmenden Bedeutung des indirekten Zugangs zur Welt mit Hilfe virtueller Medien, schließlich wird „zum historisch ersten Mal eine massenhafte Nutzung gemeinschaftlich geteilter, interaktiver Medien nicht nur möglich, sondern wirklich“ (Münker 2009: 10-11; vgl. auch Schmidt 2011).
Noch deutlicher zeigt sich die zunehmende Bedeutung des Internets bei der Aneignung von Wissen über Wald mit abnehmendem Alter (Abb. 2): Nutzt lediglich rund ein Viertel der über 65-Jährigen das Internet zur Generierung von Wissen über Wald, sind dies bei den 16- bis 25-Jährigen drei Fünftel. Hierzeigt sich ein hochsignifikanter umgekehrter Zusammenhang zwischen Alter und Internetnutzung bei der Gewinnung von Wissen. Ebenfalls hochsignifikant zeigt sich der Zusammenhang zwischen zunehmendem Alter und abnehmender Nutzung von Informationsflyern sowie zunehmendem Alter und der Inanspruchnahme von Kursen zur Wissensaneignung über Wald. Gleichfalls hochsignifikant stellen sich die Zusammenhänge zwischen zunehmendem Alter und der zunehmenden Neigung dar, sich Wissen über Wald durch direkte Beobachtung und durch Führungen anzueignen. Auch wenn den 16- bis 25-Jährigen die direkte Beobachtung hinsichtlich der Wissensaneignung über Wald noch immer dominiert, fällt die ebenfalls unmittelbare Aneignung von Wissen mittels Führungen deutlich zurück und wird durch indirektere Formen, wie die Nutzung des Internets, von Informationsflyern oder Kursen, ersetzt. Auch hier zeigt sich eine Verschiebung der Bedeutung von Information aus unmittelbarer Auseinandersetzung mit der physischen Welt zugunsten von bereits aufbereiteten und somit indirekten Informationen.
Sehr deutlich wurden auch die intergenerationellen Unterschiede bei der Beurteilung von Waldbildern. Hierbei wurden den Befragten Fotos eines Fichtenreinbestandes, eines naturnahen Laubmischwaldes und eines Parks im Stile eines Englischen Gartens vorgelegt. Deutlich differieren die Beurteilungen des Parks (die Auswertung findet sich in Abb. 3): Zwar dominiert in allen Alterskohorten die Einschätzung „ordentlich“, jedoch nimmt diese Einschätzung mit dem Alter hochsignifikant ab. Mit zunehmendem Alter nimmt ebenfalls hochsignifikant die Zuschreibung von Modernität und Hässlichkeit ab. Mit zunehmendem Alter gewinnen hingegen folgende Zuschreibungen (jeweils hochsignifikant, also einer Irrtumswahrscheinlichkeit von <5 %) an Bedeutung: Schönheit, Romantik, Traditionalität und Natürlichkeit. Bemerkenswert ist hier der Wandel der ästhetischen Urteile: Ältere neigen dazu, den Park als „schön“, Jüngere hingegen als „hässlich“ zu beschreiben. Ähnlich deutliche intergenerationelle Unterschiede finden sich auch bei der ästhetischen Deutung von Fichtenreinbestand und naturnahem Laubmischwald: So nimmt die Beschreibung des naturnahen Laubmischwaldes als „schön“ mit zunehmendem Alter hochsignifikant ab (von 69,2 % bei den 16- bis 25-Jährigen bis auf 59,0 % bei den über 65-Jährigen), die Beschreibung des Fichtenwaldes als „hässlich“ nimmt hochsignifikant zu (von 11,0 auf 18,7 % in den angesprochenen Alterskohorten). Auch hinsichtlich anderer Deutungen finden sich bezüglich der untersuchten Alterskohorten signifikante bis hochsignifikante Unterschiede:
Der Fichtenwald wird von der jüngsten Alterskohorte vergleichsweise gering (22,1 %) als „traditionell“ beurteilt.
Fichtenwald sehen die Befragten mit zunehmendem Alter hochsignifikant häufiger als „traditionell“ an (bei der ältesten Kohorte 46,8 %).
Mit zunehmendem Alter nimmt die Bereitschaft in hochsignifikanter Weise ab, den Fichtenwald als „modern“ (von 17,4 auf 4,3 %), „wild“ (von 14,0 auf 3,6 %) bzw. „interessant“ (von 13,4 auf 8,6 %) zu beschreiben.
Mit zunehmendem Alter nimmt die Neigung hochsignifikant ab, naturnahen Laubmischwald als „modern“ zu betrachten (von 14,0 auf 6,5 %).
Auch hinsichtlich der Frage, wie Personen unterschiedlichen Alters reagieren, wenn sie auf einem Waldweg spazieren, auf dem ein Ast liegt, lassen sich hochsignifikante Unterschiede zwischen den Alterskohorten feststellen: Mit zunehmendem Alter geben die Befragten hochsignifikant zunehmend an, den Ast selbst zur Seite zu räumen, und somit nimmt mit zunehmendem Alter die Neigung ab, den Ast liegenzulassen. Die übrigen Antwortmöglichkeiten wurden dem gegenüber kaum gewählt.
4 Diskussion der Ergebnisse: Intergenerationalität und die soziale Konstruktion von Wald
Die Ergebnisse der empirischen Studie verdeutlichen die Differenziertheit der sozialen Konstruktion von Wald im Besonderen, von Landschaft im Allgemeinen (vgl. auch Kühne 2006), auch innerhalb eines Kulturkreises (hier des deutschsprachigen). So schätzen Ältere „ordentliche“ Waldbilder mehr als Jüngere. Dies betrifft die Bewertung des naturnahen Waldes, der von Jüngeren stärker präferiert wird, gegenüber dem Park, der stärker von Älteren präferiert wird. Auch neigen Menschen mit zunehmendem Alter dazu, sich selbst bei der Herstellung eines „ordentlichen“ Zustandes einzubringen als Jüngere.
Neben dem Ansatz der differenzierten Sozialisation von Landschaft (Kühne 2008) lässt sich dieser Befund auch mit der Postmaterialismusthese Ingleharts (1977 und 1998) deuten. Inglehart geht von einer signifikanten Verschiebung der Wertvorstellungen seit dem Zweiten Weltkrieg aus, insbesondere in westlichen Gesellschaften. Als Antriebsquelle schätzte er den – seit den 1950er Jahren in den Staaten der westlichen Welt – kontinuierlich ansteigenden Wohlstand ein. Im Zuge der Zunahme des gesellschaftlichen Wohlstandes verschoben sich die Wertprioritäten vom Materialismus zum Postmaterialismus: Jüngere Generationen, die in ihre Kindheit und Jugend in der materiellen Sicherheit der nach-1950er Jahre verbrachten, brachen mit den traditionellen Werten und Wertvorstellungen der älteren Generation. Ökonomische Sicherheit gehört in der Öffentlichkeit westlicher Gesellschaften zwar noch immer zu den Werten, die breite Zustimmung finden, ist aber nicht länger Synonym für Glück. Dagegen nimmt die Bedeutung von Lebensqualität eine wachsende Bedeutung ein – insbesondere die Verwirklichung eigener Fähigkeiten gilt als erstrebenswertes Ziel. Auch wird dem Schutz von Natur und Umwelt ein höherer Stellenwert zugesprochen als in materialistisch orientierten Gesellschaften (Inglehart 1998).
Die Theorie des intergenerationellen Wertewandels fußt auf zwei Schlüsselhypothesen (Inglehart 1977): erstens der Mangelhypothese, gemäß derer Prioritäten einer Person die sozioökonomische Umwelt reflektieren. Der höchste subjektive Wert wird daher solchen Dingen beigemessen, die relativ knapp sind. Zweitens der Sozialisationshypothese, gemäß derer die Beziehung zwischen sozioökonomischer Umwelt und Wertprioritäten einer handelnden Person nicht regelmäßig hergestellt wird. Anpassungen vollziehen sich vielmehr mit erheblicher Zeitverzögerung. Die nicht hinterfragten Werte eines Menschen spiegeln im hohen Maße die Bedingungen wider, die in Kindheit und Jugend herrschten. Gerade die Sozialisationshypothese birgt ein großes Potenzial zum Verständnis der hier präsentierten Ergebnisse.
Aus Perspektive des Ansatzes, wie welche Landschaft wann sozialisiert wird, lassen sich die empirischen Befunde folgendermaßen deuten: Allgemein werden Landschaften, die sich die oder der Heranwachsende in ihrer oder seiner Kinder- und Jugendzeit unter Vermittlung signifikanter Anderer (Eltern, Verwandte, Freunde etc.) im Wohnumfeld aneignet, als „normal“ gedeutet. Sie bilden neben den durch Sekundärinformationen (durch Kinder-, Jugend- und Jugendbücher, durch Fernsehen und zunehmend auch durch Internet) erzeugte stereotypen Landschaftsvorstellungen die Grundlage für die Deutung und Bewertung jener physischen Objekte, die als Landschaft oder Wald synthetisiert werden.
Waren die Wälder, in denen ältere Personen ihre primären Waldvorstellungen bildeten, stärker durch einen aufgeräumt-parkartigen Charakter geprägt und es wurde die stereotype Vorstellung vermittelt, ein „aufgeräumter“ Zustand des Waldes (im Besonderen) und Landschaft (im Allgemeinen) sei erstrebenswert, hat sich dies in den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten deutlich gewandelt. So sind die Wälder der Gegenwart infolge der stärkeren Durchsetzung von Elementen der naturnahen Waldwirtschaft weniger stark durch den Drang nach Ordnung geprägt. Auch ist im Kontext des von Inglehart (1977 und 1998) empirisch beobachteten epochalen Wandels der Präferenz von Ordnungs- und Pflichtwerten hin zu Selbstverwirklichungswerten eine Veränderung der gesellschaftlichen Beurteilung von „Ordnung“ einhergegangen. Während also in Bezug auf Wald ältere Befragte eher einen „ordentlichen“ Zustand präferieren, geben jüngere Befragte unordentlich erscheinenden Wäldern mit hohem Erlebniswert den Vorzug (vgl. auch Braun 2000).
Diese erneute Präferierung von „wildem Wald“ durch Jüngere lässt sich auch als Wiederanknüpfung an romantische Vorstellungen deuten, die sich mit einer „Wiederverzauberung der Welt“ im Kontext gesellschaftlicher Postmodernisierung deuten lässt (Pohl 1993). Der wilde Wald ermöglicht so „ein Stück Gegenerfahrung zur Sphäre der kulturellen Sinne“ (Seel 1996: 115). Wildnis wird nicht mehr mit Gefahr, sondern mit Angenehmem konnotiert: So stellt Bauman (2008: 108) fest, „dass beinahe sämtliche Gefahrenquellen in die Städte übergesiedelt sind und sich dort niedergelassen haben“. Besonders die „schwer fassbaren und mysteriösen Fremden“ (Bauman 2008: 10). Die zunehmende Präferenz von Wildnis verdeutlicht auch die Sehnsucht nach Authentizität in einer durch Simulation geprägten Welt (Baudrillard 1994). Diese Sehnsucht nach Authentizität erscheint angesichts der medialen Konstruktion von Wald eine innere Widersprüchlichkeit.
Die Befragung zeigt eine zunehmende Bedeutung der medialen Konstruktion von Landschaft im Allgemeinen und Wald im Besonderen bei den Befragten. Dies verdeutlicht die große Bedeutung der indirekten Waldwahrnehmung. Insbesondere das Internet gewinnt bei der Generierung von Wissen über Wald eine zunehmende Bedeutung – ein Ergebnis, das einer allgemeinen Entwicklung der gesellschaftlichen Verbreitung von Informationen folgt. Mit der steigenden Bedeutung der medialen Repräsentation und Deutung von Wald und sozial erwünschten Waldzuständen wird diese zunehmend als Maßstab für die individuelle und soziale Bewertung von Wald auch dann herangezogen, wenn Wald der Gegenstand der direkten Wahrnehmung ist (vgl. z.B. Kühne 2006 und 2008).
Hinsichtlich einer stärkeren Sensibilisierung für Fragen der Waldentwicklung erscheint einerseits eine verstärkte Aufmerksamkeit der Erzeuger virtueller Informationen zielführend, z.B. für die Fragen naturnaher Waldnutzung. Andererseits scheint infolge der Entwicklung des Webs 2.0 sowie des Preisverfalls für Geräte zur Erzeugung von elektronischen Filmen und Videos auch der Zugang zum weltweiten Netz für eigene Produktionen jener Personen erleichtert, die sich als Experten mit naturnaher Waldentwicklung befassen. Dies bedeutet, dass – auch wenn das Ziel von Umweltprojekten darin besteht, Menschen in unmittelbaren Kontakt z.B. zu Wald zu versetzten – es sich als Ziel führend erweisen kann, mediale Repräsentationen von Wald im Besonderen und Natur im Allgemeinen zu fertigen, um so den Gewohnheiten der Weltkonstruktion der jüngeren Generation stärker zu entsprechen.
Dabei erscheint die Herausforderung solchermaßen produzierter Inhalte weniger in Bezug auf deren Erzeugung zu bestehen, denn vielmehr hinsichtlich deren Wahrnehmung, wie Kühne & Weber (2014) am Beispiel des Netzausbaudiskurses gezeigt haben. Das heißt, die Darstellungsform muss den Erwartungen der Zielgruppe entsprechen, wenn die Inhalte wahrgenommen und in die jeweilige Weltkonstruktion aufgenommen werden sollen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwar jüngere Menschen verstärkt dazu neigen, Informationen über die Welt insbesondere über virtuelle Medien zu gewinnen, ältere hingegen stärker auf traditionelle Medien, wie auf Führungen zurückgreifen. Eine verstärkte Ausrichtung der kommunikativen Bemühungen auf neue Medien sollte dabei nicht auf Kosten traditioneller Informationswege gehen.
Literatur
Baudrillard, J. (1994): Simulacra and Simulation. Ann Arbor.
Bauman, Z. (2008): Flüchtige Zeiten. Leben in der Ungewissheit. Hamburg.
Braun, A. (2000): Wahrnehmung von Wald und Natur. Wiesbaden
Bruns, D. (2013): Landschaft, ein internationaler Begriff? In: Bruns, D., Kühne, O., Hrsg., Landschaften: Theorie, Praxis und internationale Bezüge, Schwerin, 153–170.
Burckhardt, L. (2006): Warum ist Landschaft schön? Die Spaziergangswissenschaft. Berlin.
Diekmann, A. (2003): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Hamburg.
Heck, B. (2010): WaldKulTur. Ein Rückblick auf 200 Jahre kulturelle Aneignung. In: Nationalparkverwaltung Bayrischer Wald, Hrsg., Kulturwissenschaftliches Symposium, Wald : Museum : Mensch : Wildnis, Grafenau, 30-49.
Hunziker, M., von Linden, E., Bauer, N., Frick, J. (2012): Das Verhältnis der Schweizer Bevölkerung zum Wald. Waldmonitoring soziokulturell: Weiterentwicklung und zweite Erhebung – WaMos 2. Birmensdorf.
Inglehart, R. (1977): The Silent Revolution. Change and Political Styles in Western Publics. Princeton.
– (1998): Modernisierung und Postmodernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und politischer Wandel in 43 Gesellschaften. Frankfurt am Main, New York.
Kleinhückelkotten S., Neitzke H.-P., Wippermann, C. (2009): Einstellungen zu Wald, Forstwirtschaft und Holz in Deutschland. Forst und Holz 64 (4), 12-19.
Kook, K. (2009): Landschaft als soziale Konstruktion. Raumwahrnehmung und Imagination am Kaiserstuhl. Freiburg i. Br.
Körner, S. (2006): Heimatschutz, Naturschutz und Landschaftsplanung. In: Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung – Technische Universität Berlin, Hrsg., Perspektive Landschaft, Berlin, 131-142.
Kromrey, H. (2002): Empirische Sozialforschung. Opladen.
Kühne, O. (2006): Landschaft in der Postmoderne. Das Beispiel des Saarlandes. Wiesbaden.
– (2008): Distinktion – Macht – Landschaft. Zur sozialen Definition von Landschaft. Wiesbaden.
– (2013): Landschaftstheorie und Landschaftspraxis. Eine Einführung aus sozialkonstruktivistischer Perspektive. Wiesbaden.
–, Weber, F. (2014): Der Energienetzausbau in Internetvideos – eine quantitativ ausgerichtete diskurstheoretisch orientierte Analyse. In: Kost, S., Schönwald, A., Hrsg., Landschaftswandel, Wandel von Machtstrukturen, Wiesbaden (im Druck).
Münker, S. (2009): Emergenz digitaler Öffentlichkeiten. Die Sozialen Medien im Web 2.0. Frankfurt a.M.
Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Saarland e.V. (2014): Wertvoller Wald durch Alt- und Totholz. Lebach.
Lehmann, A. (2001): Mythos Deutscher Wald. Der Bürger im Staat 51 (1), 4-9.
Pohl, J. (1993): Regionalbewusstsein als Thema der Sozialgeographie. Theoretische Überlegungen und empirische Untersuchungen am Beispiel Friaul. Münchener Geogr. Hefte 70, Regensburg.
Schmidt, J. (2011): Das neue Netz. Merkmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0. Konstanz.
Schütz, A. (1971 [1962]): Gesammelte Aufsätze 1. Das Problem der Wirklichkeit. Den Haag.
–, Luckmann, T. (2003 [1975]): Strukturen der Lebenswelt. Konstanz.
Seel, M. (1996): Eine Ästhetik der Natur. Frankfurt am Main.
Urmersbach, V. (2009): Im Wald, da sind die Räuber. Eine Kulturgeschichte des Waldes. Berlin.
Anschrift des Verfassers: Prof Dr. Dr. Olaf Kühne, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Fakultät Landschaftsarchitektur (Ländliche Räume, Regionalmanagement), Im Hofgarten 4, D-85354 Freising, E-Mail olaf.kuehne@hswt.de, Internet http://www.hswt.de/person/olaf-kuehne.html.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen




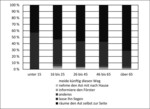

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.