Ökologische Auswirkungen von Klimaänderungen und Maßnahmenstrategien für europäisch geschützte Arten
Abstracts
Der anthropogen beschleunigte Klimawandel stellt für viele geschützte Arten eine zusätzliche Gefährdung dar. Angesichts der projizierten Trockenheitszunahme gilt dieses insbesondere für Arten der Gewässerökosysteme und Feuchtgebiete. Der Beitrag analysiert die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf europäisch geschützte Arten anhand von zwei FFH-Gebieten in Sachsen-Anhalt. Nach einer literaturgestützten Bewertung von Grad und Richtung der Klimasensibilität für jede Art wurde durch Modellierung dreier Zeiträume (2011–2040, 2041–2070, 2071–2100) die bioklimatische Reaktion der einzelnen Arten prognostiziert. Der Abgleich zwischen den für die FFH-Gebiete projizierten Klimaparametern mit dem artspezifischen klimatischen Rahmen ergab eine Aussage, ob eine Art, bezogen auf die drei Zeiträume, in den FFH-Gebieten zukünftig weiterhin existieren kann oder nicht. Bei der Auswertung der Modellierungsergebnisse zeigte sich, dass für viele Arten die zukünftig zu geringe Kälteverfügbarkeit ein Problem werden kann. Zur Minimierung der zu erwartenden Folgen des Klimawandels wurden gebietsspezifische Maßnahmenstrategien für die beiden FFH-Gebiete abgeleitet.
Ecological Effects of Climate Change and Strategies for European Protected Species – Case studies of two Natura 2000 Sites in Saxony-Anhalt
Climate change represents an additional hazard for many protected species. In the light of the supposed increase in aridity this especially applies to aquatic ecosystems and wetlands. The study presented aimed to analyse the impact of climate change on European protected species based on two Natura 2000 sites in Saxony-Anhalt. In the first step the study assessed the degree and type of climate sensitivity for each species using literature research. On this base the bio-climatic response of the species could be predicted for three periods (2011-2040, 2041-2070, 2071-2100). The comparison between projected climate parameters of the areas analysed and the species-specific climatic envelope allowed to determine whether or not a species might be able to persist in the examined areas regarding each of the three time periods. The results show that in future many of the considered species could suffer from a lack of cold. To minimise the expected impacts of climate change area-specific management strategies are outlined.
- Veröffentlicht am
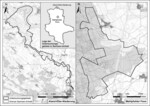
1 Einleitung
Die durchschnittliche globale Temperatur an der Erdoberfläche ist in den letzten 100 Jahren um 0,74 °C angestiegen (IPCC 2007). Als wesentlicher Faktor dieser Veränderung wird der anthropogen bedingte Konzentrationsanstieg von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre postuliert (ACIA 2004, IPCC 2007). Projektionen gehen von einer Erderwärmung von durchschnittlich bis zu 6 °C innerhalb dieses Jahrhunderts aus (IPCC 2007).
Als eine Folge dieser Veränderungen wird mit einer globalen Zunahme extremer Wetterereignisse, wie Starkregenfällen, Hitzewellen und Stürmen, gerechnet (Enquete-Kommission 1992). In Bezug auf die europäischen Ökosysteme werden die größten Veränderungen wahrscheinlich in den borealen, subarktischen und arktischen Lebensräumen auftreten (Hülber et al. 2009).
Viele mitteleuropäische Ökosysteme weisen deutlich geringere sichtbare Wirkungen auf, klimatische Änderungen führen aber bereits heute zu detektierbaren Arealverschiebungen von Lebensräumen, zu modifizierten Nahrungsnetzen und lokal zur Etablierung neuer Tier- und Pflanzengemeinschaften (Devictor et al. 2012, Kromp-Kolb & Gerersdorfer 2003, Parmesan & Yohe 2003, Schlumprecht et al. 2010). Gerade für geschützte Arten und Lebensräume wirkt der Klimawandel zudem als zusätzliche Gefährdung (Schlumprecht et al. 2010), da viele der klimasensiblen Taxa Habitatkomplexe und Ökotonbereiche im Bereich der Feuchtlebensräume sowie Gewässer und kleinklimatische Sonderstandorte als Lebensraum nutzen (Koda & Nakamura 2008, Leuschner & Schipka 2004).
Nicht nur für Vögel und Schmetterlinge (Devictor et al. 2012), sondern auch für viele Gewässerorganismen können sich durch den Klimawandel die ökosystemaren Gegebenheiten sehr schnell und zumeist negativ ändern. So ist bekannt, dass sich Amphibien aufgrund der günstigeren Wasserverhältnisse im Frühjahr bei steigenden Temperaturen massenhaft vermehren können. Infolge des zukünftig im weiteren Entwicklungszyklus häufig fehlenden Niederschlags und hoher Temperaturen trocknen aber viele der Laichgewässer schnell aus, ohne dass die Larvalentwicklung der Tiere abgeschlossen ist.
Einige Arten werden sich besser, andere schlechter an ein sich wandelndes Klima anpassen. Bestehende Biozönosen können zerfallen, andere sich neu etablieren.
In Anerkennung dieser Tatsachen hat das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt in fachlicher Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umweltschutz eine Studie in Auftrag gegeben, in der Analysen zu den Folgen des Klimawandels in Sachsen-Anhalt durchgeführt werden sollten. Dazu gehörten auch naturschutzfachliche Betrachtungen, welche die Wirkung des Klimawandels auf die europäisch geschützten Arten der FFH-Gebiete „Mahlpfuhler Fenn“ und „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ darstellen. Einige wichtige methodische Grundlagen und Ergebnisse dieser Studie sollen im Folgenden präsentiert und diskutiert werden.
2 Untersuchungsgebiete
Der Klimawandel in Sachsen-Anhalt führt vornehmlich zu einer Temperaturzunahme und in dessen Folge auch vielfach zu einer Verstärkung der Sommertrockenheit (Kreienkamp et al. 2012). Somit werden insbesondere Feuchtgebiete und aquatische Biotope von Veränderungen betroffen sein. Aus diesem Grund wurden ein Moor und ein Fließgewässersystem in die vorliegenden Untersuchungen einbezogen. An ihnen lassen sich modellhaft mögliche Veränderungen der Artenzusammensetzung veranschaulichen.
Das FFH-Gebiet „Mahlpfuhler Fenn“ liegt im Norden des Landes Sachsen-Anhalt (vgl. Abb. 1). Es dehnt sich über eine Fläche von 1210 ha zwischen den Ortschaften Schernebeck im Norden, Burgstall im Westen und der Stadt Tangerhütte im Osten aus. Ein Großteil des FFH-Gebietes ist durch ein voll hydromorphes Sand-Moor-Mosaik mit ebenem Relief charakterisiert (RANA 2011). Die geringmächtigen Hangmoore des Mahlpfuhler Fenns sind aufgrund von Meliorationsmaßnahmen der Torfmineralisation ausgesetzt (Abb. 2).
Aus der insgesamt großen standörtlichen Vielfalt des Gebietes begründet sich seine Bedeutung als Lebensraum vieler europäisch geschützter Arten. So brüten zahlreiche Vogelarten im Mahlpfuhler Fenn, darunter sowohl Wald- als auch Moor- und Nasswiesenbewohner. Insgesamt elf Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (VRL 2009) wurden nachgewiesen [u.a. Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Kranich (Grus grus)]. Weiterhin kommen acht Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie (2003) sowie 16 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (2003) im Gebiet vor. Neben den Moorbereichen bieten auch Alteichen im Gebiet wertvolle Lebensräume, in denen Mops- und Bechsteinfledermaus (Barbastella barbastellus und Myotis bechsteinii) sowie Heldbock (Cerambyx cerdo), Eremit (Osmoderma eremita) und Hirschkäfer (Lucanus cervus) leben.
Das FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ weist eine Fläche von 2573 ha auf und erstreckt sich beidseitig des Fließgewässers Aland (vgl. Abb. 1). Die Aland-Elbe-Niederung ist eine strukturreiche Stromtalaue mit Brenndoldenauenwiesen, Eichen-, Ulmen- und Eschen-Auenwäldern sowie Weichholzauenwäldern (vgl. Abb. 2). Die Wälder dienen als Lebensraum für zahlreiche an Feuchtgebiete gebundene Tier- und Pflanzenarten. Geprägt wird das Untersuchungsgebiet insgesamt jedoch durch Grünländer, die durch Altwässer, Gräben und Flutrinnen gegliedert sind. Von herausragender Bedeutung ist die Aland-Elbe-Niederung sowohl für Vogelarten des Offenlandes, der halboffenen Kulturlandschaft als auch des Waldes. Diese Habitate bieten insbesondere zahlreichen Wat- und Wasservögeln bedeutende Brut- und Raststätten (Röper & Szekely 2010). Im Gebiet wurden insgesamt 25 Vogelarten nach Anhang I der VRL (2009) nachgewiesen. Darüber hinaus treten 25 nicht im Anhang I der VRL (2009) aufgeführte Zug- oder wertgebende Brutvogelarten auf [u.a. Bekassine (Gallinago gallinago) und Großer Brachvogel (Numenius arquata)]. Das Natura-2000-Gebiet ist weiterhin Lebensraum für zwölf Tierarten nach Anhang II und fünf Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (2003). Im landesweiten Vergleich sind insbesondere die Vorkommen des Bibers (Castor fiber) und des Fischotters (Lutra lutra), aber auch von Kreuzkröte (Bufo calamita) und Moorfrosch (Rana arvalis) bedeutsam (Röper & Szekely 2010).
3 Methode
Um die Auswirkungen des Klimawandels auf europäisch geschützte Arten in den beiden Untersuchungsgebieten beurteilen zu können, wurde zunächst die Klimasensibilität der geschützten Arten analysiert. Grundlage war eine umfassende Literaturrecherche, die einerseits die Wirkung unterschiedlicher, sich ändernder Klimafaktoren (Temperatur, Niederschlag) auf Arten, andererseits aber auch den Menschen als zusätzlichen Gefährdungsfaktor (Treibhausgase, Schadstoffe, Landschaftszerschneidung etc.) berücksichtigte.
Weiter nahmen Experten für jede in den FFH-Gebieten vorkommende europäisch geschützte Art eine Einschätzung ihrer autökologischen Ansprüche und der daraus resultierenden ökologischen Amplituden vor und glichen diese zusätzlich mit Literaturangaben ab. Im Rahmen der Expertise wurde das sensibelste Stadium im Lebenszyklus der Arten zugrunde gelegt und jeweils dessen Ansprüche gegenüber den beiden Klimaparametern Temperatur und Feuchte bewertet. Zudem ist die Breite der ökologischen Amplitude der Arten im Hinblick auf Temperatur und Feuchte eingeschätzt worden, um Aussagen zum Grad der Beeinflussung der Arten durch den Klimawandel zu ermöglichen.
Es wird postuliert, dass eine umso höhere Klimasensibilität vorliegt, je enger die ökologischen Amplituden einer Art gegenüber Temperatur und Feuchte sind und je mehr die Art an kühle und nasse Habitate angepasst ist.
Sowohl die Ergebnisse der Literaturrecherche, die Indikatoren einer BfN-Studie (Rabitsch et al. 2010) als auch die Ergebnisse der Experteneinschätzung gingen in die Endbewertung der Klimasensibilität der in den Gebieten vorkommenden europäisch geschützten Arten ein.
Als weiterer Faktor der Klimawirkung (vgl. Bertzky et al. 2011) wurde die Klimaexposition der europäisch geschützten Arten in den Untersuchungsgebieten analysiert. Dazu erfolgte mit Hilfe einer an Huntley et al. (2007) angelehnten Methode die Verschneidung gebietsspezifischer Klimaparameter mit den Anspruchskomplexen der Taxa. Eine zentrale Annahme der bioklimatischen Modellierung lag darin, dass die in den aktuellen Verbreitungsgebieten bestehenden Temperatur- und Feuchteparameter die derzeitigen klimatischen Ansprüche der Arten widerspiegeln. Nach einem Abgleich dieser Ansprüche mit projizierten Temperatur- und Feuchtewerten für die Zeiträume 2011–2040, 2041–2070 und 2071–2100 konnte eine Aussage über zukünftige Vorkommensbedingungen der relevanten Arten im Mahlpfuhler Fenn und in der Aland-Elbe-Niederung getroffen werden (vgl. Abb. 3).
Dabei sind folgende Entwicklungstendenzen möglich:
die klimatischen Bedingungen in den FFH-Gebieten entsprechen auch zukünftig den derzeit im Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art vorherrschenden Feuchte- und Temperaturwerten wahrscheinliches lokales Fortbestehen der Art;
die klimatischen Bedingungen in den FFH-Gebieten weichen künftig in mindestens einem Parameterwert von den derzeit im Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art vorherrschenden Feuchte- und Temperaturwerten ab wahrscheinlicher starker lokaler Rückgang der Art.
Zur bioklimatischen Modellierung und Einschätzung der Entwicklungstendenz der untersuchten Arten in den FFH-Gebieten dienten drei europaweit erfassbare klimatologische Merkmale (vgl. Abb. 4):
Kälteverfügbarkeit (mittlere Temperatur des kältesten Monats [TkMon]),
Wärmeverfügbarkeit (Jahressumme aller Tagestemperaturanteile > 5 °C [TSum5]) und
Feuchteverfügbarkeit (Verhältnis zwischen realer und potenzieller jährlicher Verdunstung [AET/PET]).
Das Merkmal „Kälteverfügbarkeit“ diente als Proxy für die in einem bestimmten Gebiet zu erwartende, über einen gewissen Zeitraum andauernde Minimaltemperatur. Viele in Europa überwinternde, aber auch migrierende Arten können nachweislich sensibel auf diesen Faktor reagieren (vgl. u.a. Both & Visser 2001, Koppmann-Rumpf et al. 2003).
Das Merkmal „Wärmeverfügbarkeit“ lieferte ein Maß für die Intensität der Vegetationsausprägung und die Dauer der Vegetationsperiode. Dieser Faktor bestimmt vor allem für Organismen höherer Breiten, ob sie ihren jährlichen Wachstums- und/oder Reproduktionszyklus an einem bestimmten Ort beenden können. Das Merkmal „Feuchteverfügbarkeit“ reflektiert schließlich die Einschränkungen, die aufgrund zunehmender Trockenheit auf Organismen wirken können. Über die Steuerung der Verbreitung von Pflanzenarten und des Vegetationscharakters wird durch diesen Faktor indirekt die Habitatverfügbarkeit beeinflusst. Außerdem wirkt die Feuchteverfügbarkeit auf Qualität und Quantität der pflanzlichen Nahrung. Sie korreliert zudem mit dem Bodenfeuchtegehalt, der wiederum die Menge und Verfügbarkeit von Bodenwirbellosen bestimmt (vgl. Huntley et al. 2007).
Alle erforderlichen Klimawerte für die Modellierung konnten aus regionalen Klimadaten des aktuellen WETTREG-Rechenlaufes berechnet werden (Kreienkamp et al. 2012). Parallel dazu wurden Temperatur- und Niederschlagsdaten in den drei Betrachtungszeiträumen speziell für die zu bearbeitenden FFH-Gebiete aggregiert und die realen Verdunstungswerte entsprechend der vorherrschenden Landnutzung und Bodentypen ergänzt (vgl. Pfützner et al. 2012).
Aus den unterschiedlichen Bewertungsergebnissen zur Klimasensibilität sowie zur Klimaexposition der europäisch geschützten Arten in den FFH-Gebieten ließen sich dann für die Naturschutzpraxis relevante gebietsspezifische Strategien zur Minimierung der Klimafolgen ableiten.
4 Ergebnisse und Diskussion
4.1 Klimasensibilität der Arten
In die Bewertung der Klimasensibilität sind insbesondere Abschätzungen über klimabedingte Änderungen der Habitat- und Verbreitungsverhältnisse der jeweiligen Taxa eingeflossen, wobei der räumliche Bezug auf das Land Sachsen-Anhalt gerichtet war. In dieser Einstufung spiegeln sich vor allem Stärke und Richtung der abzuschätzenden Reaktion auf den Klimawandel wider. Entsprechend erfolgte die Einteilung in High-Risk-Species (starke Klimasensibilität), Medium-Risk-Species (mittlere Klimasensibilität) bzw. Low-Risk-Species (geringe Klimasensibilität) bei prognostizierter negativer Reaktion. Bei anzunehmender positiver Beeinflussung durch den Klimawandel wurde die Art als Benefited Species kategorisiert.
Von den insgesamt 97 bewerteten Arten konnten ca. 20 % keiner Gefährdungskategorie zugeordnet werden, da eine defizitäre oder widersprüchliche Datenlage hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels bestand.
Insgesamt 13 Arten wurden als „High-Risk-Species“ klassifiziert (Abb. 5). Mit fast 50 % sind aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Mobilität und der wassergebundenen Lebensweise insbesondere Amphibien und Libellen, wie Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis), Rotbauchunke (Bombina bombina) und Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis), stark vom prognostizierten Klimawandel betroffen.
In die mittlere Risikokategorie wurden insgesamt 30 der 97 untersuchten Arten eingestuft [u.a. Steinbeißer (Cobitis taenia), Bekassine (Gallinago gallinago), Großer Brachvogel (Numenius arquata), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und Kreuzkröte (Bufo calamita)].
In die Kategorie „Low-Risk-Species“ sind unter den 24 Arten viele Säugetiere und Vögel eingeordnet worden. Das geringe Risiko ist u.a. auf ihre vergleichsweise hohe Mobilität und große ökologische Amplitude gegenüber Temperatur- und Feuchteänderungen zurückzuführen, die diese Artengruppen relativ flexibel auf Umweltveränderungen reagieren lässt. Als Beispiele sind diesbezüglich Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) und Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) sowie Beutelmeise (Remiz pendulinus) und Braunkehlchen (Saxicola rubetra) zu nennen.
Insgesamt zehn Arten wurden der Kategorie „Benefited Species“ zugeordnet. Dazu zählen:
Neuntöter (Lanius collurio), Ortolan (Emberiza hortulana), Schwarzmilan (Milvus migrans), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) und Zwergschwan (Cygnus columbianus bewickii);
Zauneidechse (Lacerta agilis);
Großes Mausohr (Myotis myotis);
alle untersuchten Käferarten.
4.2 Prognose zum zukünftigen Vorkommen der Arten in den FFH-Gebieten (Klimaexposition)
Bis zum Jahr 2040 werden den Modellierungsergebnissen zufolge folgende Arten von einem starken lokalen Rückgang bedroht sein; für diese besteht somit ein dringender Handlungsbedarf:
Aland-Elbe-Niederung: Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Kranich (Grus grus), Moorfrosch (Rana arvalis), Rotbauchunke (Bombina bombina);
Mahlpfuhler Fenn: Kranich (Grus grus), Moorfrosch (Rana arvalis), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus).
Die genannten Arten gehören zu den „High-Risk-Species“. Weiterhin ergab die Klimasensibilitätsanalyse, dass alle Taxa feuchtstenotop sind, wodurch sie zusätzlich empfindlich auf klimatische Veränderungen reagieren. Eine erhöhte Gefährdung begründet sich nicht nur dadurch, dass die direkten klimatischen Ansprüche der Arten nicht mehr erfüllt werden können, sondern auch dadurch, dass indirekte Wirkungen (u.a. Veränderungen im Nahrungsnetz oder im Gefüge der Habitatstrukturen) auftreten. Damit kann sich ein ganzer Komplex von Ökosystemfaktoren derart ändern, dass die Toleranzschwelle der Art überschritten wird.
Für den Zeitraum 2041 bis 2070 zeigen die Modellierungsergebnisse, dass 20 % (inklusive der bereits im vorherigen Zeitraum bedrohten Spezies) der europäisch geschützten Arten lokal keine geeigneten klimatischen Bedingungen mehr vorfinden werden. Für folgende Arten besteht aufgrund ihrer mittelfristigen Gefährdung ein starker Handlungsbedarf:
Aland-Elbe-Niederung: Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis), Rapfen (Aspius aspius), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Seeadler (Haliaeetus albicilla), Teichfledermaus (Myotis dasycneme);Mahlpfuhler Fenn: Biber (Castor fiber), Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe), Schlagschwirl (Locustella fluviatilis), Seeadler (Haliaeetus albicilla).
Fast alle betroffenen Arten (mit Ausnahme des Schlagschwirls) sind entweder gegenüber Feuchte oder Temperatur stenök und reagieren damit besonders sensibel auf die Wirkungen des Klimawandels.
In Bezug auf den letzten untersuchten Zeitraum (2071 bis 2100) wurden sowohl in der Aland-Elbe-Niederung als auch im Mahlpfuhler Fenn weitere sechs Arten ermittelt, die dort potenziell keine geeigneten Klimabedingungen mehr vorfinden. Insgesamt könnten bis zum Ende des Jahrhunderts somit 32 % (Aland-Elbe-Niederung) bzw. 36 % (Mahlpfuhler Fenn) der betrachteten Arten aus den beiden FFH-Gebieten verschwunden sein.
Folgende Arten sind langfristig in der Aland-Elbe-Niederung bzw. im Mahlpfuhler Fenn von einem starken lokalen Rückgang bedroht:
Aland-Elbe-Niederung: Atlantischer Lachs (Salmo salar), Biber (Castor fiber), Bitterling (Rhodeus sericeus amarus), Laubfrosch (Hyla arborea), Rothalstaucher (Podiceps grisgena), Steinbeißer (Cobitis taenia);
Mahlpfuhler Fenn: Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo), Hirschkäfer (Lucanus cervus), Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae), Waldwasserläufer (Tringa ochropus), Zauneidechse (Lacerta agilis).
Auch im letzten betrachteten Zeitraum sind fast alle betroffenen Arten (mit Ausnahme der Zauneidechse) stenök gegenüber Feuchte und/oder Temperatur.
4.3 Ableitung gebietsspezifischer Minimierungsmaßnahmen für besonders klimasensible und -exponierte Arten
Die Ergebnisse der Klimasensibilitätsanalyse und der Modellierung zeigen, dass insbesondere eng an Gewässer gebundene Arten in den FFH-Gebieten stark vom Klimawandel betroffen werden könnten (vgl. Kasten 1).
Schon heute zeigen sich in den untersuchten FFH-Gebieten Anzeichen einer zunehmenden Verlandung von Kleingewässern und einer Austrocknung von Feuchtgebietslebensräumen (vgl. Abb. 6). Diese Prozesse sind zum Einen durch Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt (Deichbau, Entwässerung) bedingt, erfahren aber zum Anderen durch das immer trockener werdende Klima auch eine Verstärkung.
Um dieser Problematik zu begegnen, sollten am dringlichsten die Klein- und Altwasserstrukturen am Aland reaktiviert und spezifische Moor- und Feuchtgebietshabitate im Mahlpfuhler Fenn gefördert werden.
Kleingewässer, Altarme aller Verlandungs- und Ausbaustufen sowie Qualmwasser sind wichtige Lebensräume für zahlreiche geschützte Arten in der Aland-Elbe-Niederung (Vögel, Fische, Amphibien, Invertebraten). Besonders die innendeichs liegenden Strukturen haben einen hohen Wert, kommunizieren sie doch biozönotisch noch relativ eng mit dem Fließgewässer. Die zumindest zeitweise Verbindung zwischen Altarmen oder anderen Stillgewässern mit dem Fließgewässer ist für viele Organismen von großer Bedeutung. Aufgrund des Klimawandels werden sich jedoch Niedrigwasserphasen häufen. Damit besteht die erhöhte Gefahr, dass diese Anbindungen verloren gehen und der Fluss an natürlicher Heterogenität verliert.
Die Verbesserung der Überflutungsdynamik in der Aland-Elbe-Niederung ist nicht zuletzt auch aufgrund der internationalen Bedeutung des Gebietes für Zug- und Rastvögel anzustreben. Viele dieser Vögel profitieren von der Gewährleistung einer unregelmäßigen natürlichen Überflutung weiter Teile des Gebietes durch die Elbe bzw. den Aland (LAU Sachsen-Anhalt 2010).
Im Mahlpfuhler Fenn sollte, insbesondere mit Blick auf die Erhaltung der High-Risk-Arten, auf die Realisierung folgender Maßnahmen hingewirkt werden:
Erhaltung eines ständig wasserführenden Bulten- und Schlenkensystems,
Etablierung eines funktionsfähigen Laggs (ohne das Überschusswasser bereits vorher durch Gräben abzuführen),
Errichtung von Nisthilfen, Sommer- und Winterquartieren für Fledermäuse,
Sicherung der Störungsarmut von Feuchtgrünländern (Nahrungs- und Bruthabitat für Kranich) sowie
Förderung störungsarmer Bruchwälder (Lebensraum des Waldwasserläufers).
Der Landschaftswasserhaushalt im Einzugsgebiet des Mahlpfuhler Fenns ist anthropogen stark verändert. Zusätzlich durchzieht ein melioratives System das Moor. Wo immer es infolge der gestörten hydrologischen Verhältnisse möglich war, sind schnell wachsende Nutzhölzer (vielfach Nadelbäume) aufgeforstet worden. Zudem haben sich auf dem Moorkörper selbst Bäume durch Samenanflug und niedrigen Moorwasserstand etablieren können. Unabhängig davon, ob angepflanzt oder Selbstaussaat, tragen diese Gehölze durch ihre Kronenarchitektur dazu bei, die Evapotranspiration weiter zu erhöhen.
Um die Gebietseigenschaften zu sichern, sind somit abgestimmte Maßnahmen zur Wasserrückhaltung notwendig. Diese sollten sich vor allem auf die noch vorhandenen Moorflächen beziehen und diese mit ausreichend Wasser versorgen. Das hätte den Effekt, dass auf den zentralen Flächen Bäume über einen natürlichen Absterbeprozess zurückgedrängt werden. Dadurch sinkt die Evapotranspiration, die Grundwasserneubildungsrate steigt. Es kommt mehr Wasser in die Fläche und die Torfbildung wird befördert. Gleichzeitig sinkt die Freisetzung von klimaschädlichem Kohlendioxid.
Bei einer Wiedervernässung von Teilbereichen des Moores würden optimale Lebensräume für Vogelarten wie Bekassine (Gallinago gallinago), Kranich (Grus grus), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Waldwasserläufer (Tringa ochropus) und Waldschnepfe (Scolopax rusticola) geschaffen.
Insgesamt sollte in beiden Gebieten auf die Verbesserung der Konnektivität der Feucht-, Wald- und Offenlandlebensräume hingewirkt werden. Ein engmaschiges und vielfältiges Netz an Biotopen im guten ökologischen Zustand erleichtert es den Individuen einzelner Arten, klein- und großräumige Wanderungen in Anpassung an den Klimawandel durchzuführen. Es verhindert zudem die räumliche Isolation von Populationen und steuert somit der genetischen Verarmung entgegen, so dass die Überlebensfähigkeit gestärkt wird.
4.4 Folgerungen für andere Gebiete
Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden sich in vielen Teilen Deutschlands im Zuge des Klimawandels die Ökosysteme in ihrer Ausstattung und Besiedlung ändern. Das betrifft im besonderen Maße die aquatischen und amphibischen Lebensräume. Geschützte Taxa sind von diesen Prozessen wegen ihrer häufig kleineren ökologischen Amplitude in der gesamten Bundesrepublik stärker betroffen und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. In der bioklimatischen Anpassung vieler Organismen spielt dabei, so zeigen die Untersuchungen, die fehlende winterliche Kälteverfügbarkeit eine wesentliche Rolle. Dieser überraschende Effekt wird auch in anderen Gebieten von zentraler Bedeutung sein.
Viele Arten und Lebensraumtypen von Feuchtgebieten wurden in der hier vorliegenden Studie bezüglich ihrer Klimasensibilität kategorisiert. Diese Einordnungen können unproblematisch für weitere Analysen genutzt werden. Außerdem sind die Degradationen (z.B. Entwässerung, Eindeichung) der bearbeiteten Ökosysteme in Deutschland ähnlich, so dass auch viele Maßnahmenkomplexe übertragbar sind.
Das Prinzip und die Methode der bioklimatischen Analyse (Ermittlung der Klimaexposition) sind ebenfalls vielfältig anwendbar, da sie auf andere Regionen und Ökosysteme übertragen werden können. In solche Analysen müssen auch zu erwartende Entwicklungen in der Landschaftsausprägung und -nutzung einfließen. Das Ziel besteht darin, durch vorsorgliche Maßnahmen Zeit für die Organismen zu gewinnen, damit diese sich rechtzeitig an die projizierten Klima- und erwarteten Landnutzungsänderungen anpassen können. Folgende Vorgehensweise wäre denkbar:
periodische Erstellung von aktuellen regionalen Klimamodellen,
Prognose zu den perspektivischen Nutzungen land- und forstwirtschaftlicher Flächen sowie zum Landschaftswasserhaushalt und Wasserdargebot,
Vertiefung der Forschungen zur Klimasensibilität von Lebensräumen und Arten (Klimasensibilitätsanalyse),
periodische bioklimatische Analyse (insbesondere für Lebensräume und Arten in Schutzgebieten) auf Basis der modellierten Klima- und Landnutzungsdaten,
Gefährungsabschätzung und Ableitung von Gegenmaßnahmen.
Flankierend müssen nach Möglichkeit alle über die klimatischen Effekte hinausgehenden Störfaktoren (u.a. unterbrochene Konnektivität zwischen Biotopen, Degradationen in bzw. Beseitigung von Lebensräumen) für geschützte Lebensraumtypen und Arten beseitigt werden, um „Kollateralschäden“ zu vermeiden, die Ökosystemelemente von vornherein weniger widerstandsfähig gegenüber Klimawirkungen werden lassen.
Zudem muss alles getan werden, um die Erwärmung der Erde nicht weiter zu befördern. Das ist Aufgabe der Klimapolitik und gestaltet sich sehr schwierig.
Durch die Kombination dieser Maßnahmen kann es auch in der Praxis gelingen, die Veränderungen in den Ökosystemen in einem für die Organismen erträglichen Rahmen zu halten.
Dank
Die Autoren danken Dr. Ulrich Lange, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, für die wertvollen Anregungen sowie für die kritische Diskussion der Ergebnisse.
Literatur
ACIA (2004): Impacts of a Warming Arctic, Arctic Climate Impact Assessment. University Press, Cambridge.
Beebee, T.J.C. (1995): Amphibian Breeding and Climate. Nature 374, 219-220.
Behrens, M., Fartmann, T., Hölzel, N. (2009): Auswirkungen von Klimaänderungen auf die Biologische Vielfalt, Pilotstudie zu den voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf ausgewählte Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen, Teil 1: Fragestellung, Klimaszenario, erster Schritt der Empfindlichkeitsanalyse – Kurzprognose. Institut für Landschaftsökologie (ILÖK), Westfälische Wilhelms-Universität, Münster.
Bertzky, M., Dickson, B., Galt, R., Glen, E., Harley, M., Hodgson, N., Keder, G., Lysenko, I., Pooley, M., Ravilious, C., Sajwaj, T., Schiopu, R., de Soye, Y., Tucker, G. (2011): Impacts of climate change and selected renewable energy infrastructures on EU biodiversity and the Natura 2000 network, Summary Report. European Commission & International Union for Conservation of Nature, Brüssel.
Both, C., Visser, M.E. (2001): Adjustment to climate change is constrained by arrival date in a long-distance migrant bird. Nature 411, 296-298.
Devictor, V., van Swaay, C., Brereton, T., Brotons, L., Chamberlain, D., Heliölä, J., Herrando, S., Julliard, R., Kuussaari, M., Lindström, Å., Reif, J., Roy, D., van Strien, A, Settele, J., Schweiger, O., Stefanescu, C., Vermouzek, Z., van Turnhout, C., Wallis de Vries, M., Wynhoff, I., Jiguet, F. (2012): Differences in the climatic debts of birds and butterflies at a continental scale. Nature Climate Change 2, 121-124.
Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre” des Deutschen Bundestages (1992): Klimaänderung gefährdet globale Entwicklungen. Economica/C.F. Müller, Bonn/Karlsruhe.
FFH-RL (2003): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/ 2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. September 2003 (Abl. EU Nr. L 284 S. 1).
Hülber, K., Sonnenleitner, M., Flatscher, R., Berger, A., Dobrowsky, R., Niessner, S., Nigl, T., Schneeweiss, G., Kubešová, M., Rauchová, J., Suda, J., Schönswetter, P. (2009): Ecological segregation drives fine-scale cytotype distribution of Senecio carniolicus in the Eastern Alps. Preslia 81, 309–319.
Huntley, B., Green, R.E., Collingham, Y.C., Willis, S. (2007): A Climatic Atlas of European Breeding Birds. Durham University, the RSPB and Lynx Editions, Barcelona.
IPCC (2007): IPCC Fourth Assessment Report, Climate Change 2007 (AR4). Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneve.
Kagarise, S., Morton, C., Morton, M.L. (1993): Population declines of Yosemite toads in the eastern Sierra Nevada of California. Journal of Herpetology 27, 186-198.
Koda, K., Nakamura, H. (2008): Effects of temperature on the development and survival of an endangered butterfly, Shijimiaeoides divines barine (Leech) (Lepidoptera: Lycaenidae). Entomological Science 11, 29-34.
Koppmann-Rumpf, B., Heberer, C., Schmidt, K.-H. (2003): Long term study of the reaction of the Edible Dormouse Glis glis (Rodentia: Gliridae) to climatic changes and its interactions with hole-breeding passerines. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49, 69-76.
Kreienkamp, F., Spekat, A., Enke, W. (2012): Durchführung einer Untersuchung zu den Folgen des Klimawandels in Sachsen-Anhalt. Bericht, Los 1.1 und 1.2, Climate and Environment Consulting Potsdam GmbH im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle (Saale).
Kromp-Kolb, H., Gerersdorfer, T. (2003): Auswirkungen von Klimaänderungen auf die Tierwelt, derzeitiger Wissensstand, fokussiert auf den Alpenraum und Österreich. Endbericht, Projekt GZ 54 3895/171-V/4/02.
LAU Sachsen-Anhalt (2010): Lebensraumtypen und Arten. Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 47, Sonderheft.
Leuschner, C., Schipka, F. (2004): Vorstudie Klimawandel und Naturschutz in Deutschland. BfN-Skripten 115, 1-40.
Meinig, H. (2010): Die Klimaveränderung – Auswirkungen auf Vögel und Säugetiere in Mitteleuropa. Nyctalus (N.F.) 15, 128-153.
Parmesan, C, Yohe, G. (2003): A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems. Nature 421, 37-42.
Pfützner, B., Klöcking, B., Schumann, A., Hesse, P. (2012): Durchführung einer Untersuchung zu den Folgen des Klimawandels in Sachsen-Anhalt. Bericht, Los 1.3, Büro für Angewandte Hydrologie (Berlin) im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle (Saale).
Rabitsch, W., Winter, M., Kühn, E., Kühn, I., Götzl, M., Essl, F., Gruttke, H. (2010): Auswirkungen des rezenten Klimawandels auf die Fauna in Deutschland. Naturschutz und Biologische Vielfalt 98,1-299.
RANA (2011): Managementplan für das FFH-Gebiet (SCI) 35 und das Vogelschutzgebiet (SPA) 26 „Mahlpfuhler Fenn“. RANA – Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer, Halle (Saale).
Rödder, D., Schulte, U. (2010): Amphibien und Reptilien im anthropogenen Klimawandel, Was wissen wir und was erwarten wir? Zeitschrift für Feldherpetologie 17, 1-22.
Röper, C., Szekely, S. (2010): Das Naturschutzgebiet Aland-Elbe-Niederung. Ausweisung eines NSG zur Umsetzung der Ziel von NATURA 2000. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 47, 1-64.
Schlumprecht, H., Bittner, T., Jaeschke, A., Jentsch, A., Reineking, B., Beierkuhnlein, C. (2010): Gefährdungsdisposition von FFH-Tierarten Deutschlands angesichts des Klimawandels. Eine vergleichende Sensitivitätsanalyse. Naturschutz und Landschaftsplanung 42, 293-303.
Stuart, S., Chanson, J.S., Cox, N.A., Young, B.E., Rodrigues, A.S.L., Fischman, D.L., Waller, R.W. (2004): Status and Trends of Amphibian Declines and Extinctions Worldwide. Science 306, 1783-1786.
VRL (2009): Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie). Amtsblatt der Europäischen Union L20/8 vom 26.08.2010.
Anschriften der Verfasser(innen): Dr. Volker Thiele, Anne Luttmann und Dr. Tim Hoffmann, biota – Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH, Nebelring 15, D-18246 Bützow, E-Mail volker.thiele@institut-biota.de, anne.luttmann@institut-biota.de bzw. tim.hoffmann@institut-biota.de; Dr. Christiane Röper, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Stabsstelle Fachbereichsübergreifende Aufgaben, Klimawandel, Öffentlichkeitsarbeit, Reideburger Str. 47, D-06116 Halle (Saale), E-Mail christiane.roeper@lau.mlu.sachsen-anhalt.de.
Fallstudien zweier FFH-Gebiete in Sachsen-Anhalt
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen







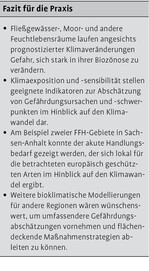
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.