Wie sensibel reagiert die Stadtbevölkerung auf Veränderung ihrer Erholungslandschaft?
Eine Untersuchung in der Metropolregion Hamburg zur voraussichtlichen Akzeptanz einer Ausweitung des Dendromasseanbaus
Abstracts
Der Wandel der Agrarproduktion, namentlich infolge des Energiepflanzenanbaus, bewirkt in vielen Regionen Deutschlands starke Landschaftsveränderungen. Insbesondere in Maisanbauregionen gibt es Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung und Proteste von Bürgerinitiativen. In Zukunft könnten Entwicklungen im Bioenergiesektor zu noch höherwüchsigen Kulturen wie Kurzumtriebsplantagen führen mit potenziell stärkeren Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungseignung der Landschaft. In einer für Hamburg repräsentativen Befragung wurde die Akzeptanz von Landschaftsveränderungen in vier landschaftlich unterschiedlichen Erholungslandschaften der Metropolregion ermittelt. Viele Landschaftsveränderungen werden je nach Erholungsgebiet signifikant unterschiedlich beurteilt. Während eine Abnahme des Grünlandanteils generell abgelehnt wurde, ist die Akzeptanz einer Zu- oder Abnahme von Wald und Gehölzen stark abhängig vom Landschaftstyp. In wald- und ackerreichen Erholungslandschaften gibt es eine deutlich höhere Zustimmung zu einer Waldausweitung als in offenen Erholungslandschaften mit hohen Heide- und Grünlandanteilen. Dieses lässt für die Landschaftsebene Rückschlüsse auf die Akzeptanz von Kurzumtriebsplantagen in den unterschiedlichen Landschaftstypen und die Notwendigkeit einer räumlichen Steuerung zu.
Landscape Changes in Recreation Areas – Survey with Particular Focus on the Acceptance of Increasing Dendromass Production
Recently, many German regions have seen dramatic landscape changes in agricultural areas due to the increasing cultivation of bioenergy crops. In the future, tall bioenergy plants like maize could be replaced by even taller short rotation coppice plantations of willow and poplar. This development raises the question of how people perceive potential landscape changes and if perceptions are influenced by the landscape where they take place.
We conducted a survey (n = 400) among urban residents in the city of Hamburg about their perceptions of potential landscape changes in four recreation landscapes with different landscape structures. The survey showed that people rated changes significantly different depending on the specific landscape character of the recreation areas. Especially changes of the forest share are strongly depending on the landscape character. People showed a significantly higher negative reaction towards more potential forests in open landscapes characterised by heath and meadows than in landscapes with a higher share of forests and fields.
- Veröffentlicht am

1 Einleitung
Ländliche Gebiete in Metropolregionen werden von unterschiedlichen Flächennutzungen beansprucht. Neben dem Suburbanisierungsdruck, der Intensivierung der Landwirtschaft und der zunehmenden Produktion von erneuerbaren Energien sollen auch Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung bereitgestellt werden (Antrop 2004, European Commission 2007, Palang et al. 2010). Die Bedeutung dieser weichen Standortfaktoren bzw. kulturellen Ökosystemleistungen nimmt stetig zu, da die Ansprüche bezüglich eines attraktiven Lebensumfelds steigen (Guo et al. 2010). Dazu gehört in der Metropolregion Hamburg neben den innerstädtischen Parks auch das Vorhandensein von Erholungsgebieten im Umland. Aufgrund ihrer hohen Erholungseignung sind diese Gebiete besonders empfindlich gegenüber einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung wie der Beseitigung von Landschaftselementen, der Zusammenlegung von kleineren zu größeren Schlägen, dem Anbau von hochwüchsigen Kulturen wie Mais und dem Umbruch von Grünland zu Acker (Franke 2008, Tveit 2009).
In Zukunft könnte eine weitere Veränderung durch Kurzumtriebsplantagen (KUP) eintreten. Da diese einige ökologische Vorteile bieten (Baum et al. 2009, Bemmann 2010, Strohm et al. 2012), ist ihre Anerkennung als ökologische Vorrangfläche im Zuge des Greening der EU-Agrarpolitik im Gespräch. Dieses könnte dem KUP-Anbau zum Durchbruch verhelfen. KUP können aufgrund ihrer hohen Wuchsleistungen von bis zu 10m Höhe in drei Jahren den Charakter einer Landschaft erheblich beeinflussen. Besonders in Erholungsgebieten mit hoher landschaftlicher Schönheit und Eigenart und in traditionell offenen Landschaften könnte sich das negativ auf die Erholungseignung auswirken.
Bisher wurden die landschaftsästhetischen Wirkungen des Bioenergieanbaus im Allgemeinen und des Dendromasseanbaus im Speziellen kaum wissenschaftlich untersucht. Kenntnisse über die Beurteilung von Landschaftsveränderungen durch die Bevölkerung können dazu beitragen, Handlungsempfehlungen für den zukünftigen Dendromasseanbau zu geben.
2 Forschungsfragen
Die hier vorgestellte Untersuchung sollte der Frage nachgehen, wie die städtische Bevölkerung von Hamburg auf unterschiedliche potenzielle Landschaftsveränderungen in den beliebtesten umliegenden Erholungsgebieten reagiert. Dadurch sollte festgestellt werden, welche landschaftlichen Veränderungen abgelehnt oder toleriert werden. Schwerpunkt der Untersuchung war die Frage, ob Landschaftsveränderungen abhängig vom Landschaftstyp unterschiedlich beurteilt werden. Aus der Beurteilung der Landschaftsveränderungen sollten Rückschlüsse gezogen werden, in welchen Landschaften Dendromasseanbau voraussichtlich mehr oder weniger akzeptiert wird. Die Fragen richten sich auf die Landschaftsebene; es geht in dem vorliegenden Beitrag also nicht um die Ausgestaltung von Landschaftselementen. Die Forschungsfragen lauten:
(1) Wie beurteilen Stadtbewohner potenzielle Landschaftsveränderungen in ihren bevorzugten Erholungsgebieten?
(2) Hängt die Beurteilung von Landschaftsveränderungen vom Landschaftscharakter des jeweiligen Erholungsgebiets ab?
(3) Wie sollte der Dendromasseanbau räumlich ausgestaltet werden, um die Erholungseignung der Landschaft zu erhalten bzw. sogar zu fördern?
3 Methoden und Gebiete
3.1 Methodische Herangehensweise
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine standardisierte mündliche Befragung von Februar bis April 2011 an vier Terminen in unterschiedlichen Stadtteilen Hamburgs durchgeführt. Die Größe der Stichprobe betrug 400 Personen, von denen 193 männlich (48,3 %) und 207 weiblich (51,7 %) waren. Das Durchschnittsalter der Stichprobe lag bei 44 Jahren (min.=15; max.=85). Die Befragung beschränkte sich auf Einwohner der Stadt Hamburg und des Hamburger Umlands, da eine gewisse Kenntnis der Erholungsgebiete Voraussetzung für die Beurteilung von potenziell dort stattfindenden Landschaftsveränderungen ist. Die Teilnahmequote, also der Anteil der Angesprochenen, der an der Befragung teilnahm, lag bei rund 30 %. Die Gründe für eine Nichtteilnahme an der Befragung betrafen vor allem Zeitmangel und generelles Desinteresse an Befragungen. Die Stichprobe ist in Bezug auf Alter und Geschlecht der Befragten statistisch repräsentativ für die Hamburger Bevölkerung [im Vergleich mit Daten des Statistischen Bundesamtes (2010) und des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (2009)]. Das Bildungsniveau der Stichprobe ist allerdings signifikant höher als der Hamburger Durchschnitt.
Die Befragung beschränkte sich auf den niedersächsischen südlichen Teil der Metropolregion Hamburg und die dortigen Erholungsgebiete Lüneburger Heide, Harburger Berge, Elbtalaue/Elbmarsch und Altes Land. Die vier Gebiete wurden im Vorfeld als die wichtigsten und bekanntesten Erholungsgebiete ausgewählt. Sie stehen gleichzeitig stellvertretend für die unterschiedlichen charakteristischen Landschaftstypen der Metropolregion (Heidelandschaft, Waldlandschaft, grünlandreiche Landschaft, Obstanbaulandschaft). Die Befragung beschränkte sich für jeden Befragten auf dessen bevorzugtes Erholungsgebiet, da sich in Pre-Tests ergab, dass viele Personen nicht alle Erholungsgebiete kannten. Die Gesamtstichprobe teilt sich daher in jeweils eine Teilstichprobe für jedes Erholungsgebiet.
Die Befragten wurden gebeten, unterschiedliche Landschaftsveränderungen, ausgehend vom aktuellen Zustand der Landschaft, zu beurteilen („Welche Veränderungen würden für Sie die Erholungseignung einschränken?“). Untersuchte Landschaftsveränderungen betrafen Landnutzungsänderungen und Veränderungen der Infrastruktur und Serviceleistungen (Tab. 1). Dabei dienten die abgefragten Veränderungen der Infrastruktur und der Serviceleistungen als Referenzrahmen zur besseren Einordnung der Landnutzungsänderungen; sie werden in diesem Beitrag nicht differenziert nach Erholungsgebieten betrachtet. Die Landnutzungsänderungen wurden in beide Richtungen gefragt, da z.B. die Ablehnung von mehr Hecken nicht bedeutet, dass weniger Hecken automatisch positiv beurteilt werden. Es wurden sich einfach vorzustellende Landschaftsveränderungen abgefragt und nicht direkt nach KUP gefragt, da davon auszugehen war, dass die meisten Befragten keine KUP kennen. In der Befragung wurden keine Visualisierungen verwendet, da Ergebnisse für die Landschaftsebene generiert werden sollten, auf der Spezifitäten der Einzelelemente wie Artenzusammensetzung und die Anordnung der Elemente nicht hervortreten. Außerdem wurde durch die Nennung der präferierten Landschaften im ersten Teil der Befragung sichergestellt, dass die Befragten ein gedankliches Bild von diesen Landschaften hatten.
Die Befragung diente auch zur Herleitung von Hypothesen zum Dendromasseanbau, die in einer weiteren Befragung mit Unterstützung von 3D-Visualisierungen validiert werden sollen. Eine negative Beurteilung einer Zunahme an Wäldern, Hecken und kleinflächigen Gehölzen in einer bestimmten Landschaft lässt z.B. auch eine negative Einstellung gegenüber KUP erwarten. Bei unterschiedlichen Beurteilungen von Wäldern und Hecken und kleinflächigen Gehölzen wird angenommen, dass die Auswirkungen des KUP-Anbaus je nach Anbausystem unterschiedlich ausfallen. Die Ausklammerung von KUP in der Befragung sollte auch strategische Antworten und Vorurteile ausschließen, die den Fokus der Studie auf das Landschaftsbild beeinträchtigt hätten. Daher decken die Ergebnisse zum Dendromasseanbau auch nur die Auswirkungen auf das Landschaftsbild ab und können von persönlichen Einstellungen zum Bioenergieanbau überlagert werden.
Die Befragung wurde mit der Statistiksoftware SPSS19 ausgewertet. Signifikanzen für die Beurteilung von Landschaftsveränderungen wurden statistisch mit Pearson’s Chi2-Tests untersucht. Die Nullhypothese lautete, dass Landschaftsveränderungen für alle Erholungsgebiete gleich beurteilt werden. Wenn Pearson’s Chi2-Test signifikant war, wurden Landschaftsveränderungen unterschiedlich zwischen den Erholungsgebieten beurteilt. Dazu wurden vier Signifikanzniveaus festgelegt: p≥0.05 = nicht signifikant (n.s.), p<0.05 = signifikant (*), p<0.01 = hoch signifikant (**), p<0.001 = höchst signifikant (***).
3.2 Erholungsgebiete
Die vier untersuchten Erholungsgebiete Lüneburger Heide, Harburger Berge, Elbtalaue/Elbmarsch und Altes Land (Abb. 1) sind durch unterschiedliche Landnutzungen gekennzeichnet, durch die ein individueller Landschaftscharakter und Landschaftstyp ausgebildet wird (Tab. 2). Offene Heidelandschaften prägen die erholungsrelevanten Bereiche der Lüneburger Heide, die durch eine Übernutzung der armen Sandböden im Mittelalter und die anschließende Beweidung mit Schafen entstanden sind. Aufgrund der Besonderheit und Eigenart der Lüneburger Heide als eine der größten Heidegebiete Zentraleuropas entwickelte sie sich zu einem wichtigen Tourismus- und Erholungsschwerpunkt in Norddeutschland (Pott 1999). Die Harburger Berge sind ein hügeliges Waldgebiet im Süden Hamburgs, das von einigen Ackerflächen durchsetzt ist. Dieses beliebte Naherholungsgebiet ist von Hamburg gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen und wird häufig für Tagesausflüge genutzt. Geprägt durch landwirtschaftliche Nutzung, ist die Elbmarsch eine strukturreiche, grünlandgeprägte Landschaft. Aufgrund der naturräumlichen Ausstattung hat sie eine hohe Bedeutung für den Naturschutz. Das Alte Land ist eine der größten zusammenhängenden Obstanbaugebiete Mitteleuropas und insbesondere zur Apfelblüte ein beliebtes Erholungsziel.
4 Ergebnisse
Die Befragungsergebnisse wurden zuerst in Bezug auf generell akzeptierte und abgelehnte Landschaftsveränderungen in allen Erholungsgebieten ausgewertet. Danach wurden die Beurteilungen von Landschaftsveränderungen für jedes Erholungsgebiet separat untersucht, um den Einfluss des Landschaftstyps auf die Beurteilung der Landschaftsveränderung herauszufinden.
4.1 Generelle Beurteilung von Landschaftsveränderungen
Obwohl alle Erholungsgebiete in ihrem aktuellen Zustand schon eine hohe Erholungseignung aufweisen und in der Bevölkerung entsprechend beliebt sind, wurden Landschaftsveränderungen nicht pauschal abgelehnt. Es ergab sich eine starke Differenzierung zwischen akzeptierten und abgelehnten Landschaftsveränderungen. Die Spanne reichte von einem Anteil von 11,8 bis 97,2 % der Befragten, welche die jeweilige Landschaftsveränderung als Einschränkung der Erholungseignung ablehnte (Abb. 3). Nur vier Veränderungen wurden über alle Erholungsgebiete von der Mehrheit der Befragten abgelehnt. Die am stärksten abgelehnte Veränderung war der Neubau von Gebäuden, der von 97,2 % der Befragten abgelehnt wurde, und die Zunahme von Äckern zu Lasten von Grünland (82,6 %). Auch eine geringere Erreichbarkeit der Erholungsgebiete (75 %) und eine Zunahme von Touristen (71,3 %) lehnte eine deutliche Mehrheit der Befragten ab.
Landschaftsveränderungen, die das Wald-Offenland-Verhältnis betrafen, wurden von der Mehrheit der Befragten nicht als Einschränkung der Erholungseignung gesehen. Das galt sowohl für eine Veränderung der Landschaft von Offenland zu mehr Wald als auch eine gegenteilige Entwicklung von Wald zu mehr Offenland. 34,1 % der Befragten meinte, dass mehr Wälder die Erholungseignung negativ beeinflussen würden, während ein ähnlich hoher Anteil von 32,3 % fand, dass mehr offene Landschaft sich negativ auswirken würde. Eine Zunahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen wurde insgesamt weniger negativ gesehen als eine Waldzunahme. Während weniger Befragte eine Zunahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen als Einschränkung der Erholungseignung betrachteten (28,9 %), gab es größere Bedenken gegenüber einer Abnahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen (46,5 %). Änderungen des Acker-Grünland-Verhältnisses wurden deutlich extremer beurteilt als Zu- und Abnahmen von Gehölzen. Eine Zunahme von Äckern zu Lasten von Wiesen und Weiden wurde von 82,6 % der Befragten als Einschränkung der Erholungseignung gesehen, während nur 10,8 % eine Zunahme von Wiesen und Weiden negativ einschätzten. 32,6 % der Befragten fand, dass weniger Pflege und die Natur eher sich selbst zu überlassen die Erholungseignung einschränken würde. Ein geringeres Angebot an Serviceleistungen im Erholungsgebiet wurde von 40,4 % der Befragten negativ gesehen.
4.2 Differenzierte Beurteilung von Landnutzungsänderungen nach Erholungsgebieten
Während einige Landschaftsveränderungen signifikant unterschiedlich zwischen den Erholungsgebieten beurteilt wurden, gab es andere, deren Beurteilung nicht vom unterschiedlichen Charakter der Erholungsgebiete beeinflusst wurde. Die Beurteilungen von Veränderungen des Wald-Offenland-Verhältnisses unterschieden sich am statistisch signifikantesten zwischen den Erholungsgebieten (Abb. 4). Auch signifikant unterschiedlich beurteilt – allerdings nicht auf dem höchsten Signifikanzniveau – wurden eine Zunahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen und eine Zunahme von Grünland zu Lasten von Äckern. Eine Abnahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen und eine Zunahme von Äckern zu Lasten von Grünland wurde in allen Gebieten gleich beurteilt; die Beurteilung dieser Landschaftsveränderungen wurde also nicht durch den unterschiedlichen Landschaftscharakter der Erholungsgebiete beeinflusst.
Wald versus offene Landschaft
Eine Waldzunahme zu Lasten von Offenland wurde höchst signifikant unterschiedlich zwischen den Erholungsgebieten beurteilt (χ2=22,088; df=3; p<0.001; Abb. 4a). Obwohl die Harburger Berge schon durch einen hohen Waldanteil geprägt sind, beurteilten die Befragten eine Waldzunahme deutlich positiver als in den anderen Erholungsgebieten. Nur 13,3 % waren der Auffassung, dass eine Waldzunahme zu Lasten von Offenland die Erholungseignung in den Harburger Bergen negativ beeinflusst, d.h. die überwiegende Mehrheit von 86,7 % betrachtete einen Anstieg des Waldanteils nicht als Einschränkung der Erholungseignung. Eine Waldzunahme wurde in offenen Landschaften wie der Lüneburger Heide und der Elbmarsch demgegenüber deutlich negativer beurteilt. In beiden Landschaften war die Ablehnungsrate mit 44,7 % bzw. 43,5 % ähnlich hoch. Für die Obstbaulandschaft des Alten Landes wurde mit 25,6 % im Vergleich mit den anderen Erholungsgebieten eine mittlere Ablehnung einer Waldzunahme festgestellt.
Auch eine Offenlandzunahme zu Lasten von Wald wurde höchst signifikant unterschiedlich zwischen den Erholungsgebieten beurteilt (χ2=22,236; df=3; p<0,001; Abb. 4b). Allerdings betrachtete nur in den Harburger Bergen die Mehrheit der Befragten eine Offenlandzunahme als Einschränkung der Erholungseignung (62,2 %). In den übrigen Gebieten unterschied sich die Beurteilung nicht deutlich voneinander (24,6 % Altes Land; 29 % Elbmarsch; 31,3 % Lüneburger Heide). Insbesondere die Lüneburger Heide und die Elbmarsch ähnelten sich bei der Beurteilung von Landschaftsveränderungen bezüglich des Wald-Offenland-Verhältnisses. Eine Waldzunahme wurde in beiden Gebieten relativ negativ bewertet, während eine Zunahme von Offenland überwiegend positiv beurteilt wurde. In den Harburger Bergen wurde im Gegensatz dazu ein Waldanstieg vergleichsweise positiv gesehen, während eine Zunahme von Offenland relativ negativ beurteilt wurde. Im Alten Land – dessen Landschaftsstruktur sehr indifferent in Bezug auf das Wald/-Offenland-Verhältnis ist, da die Obstplantagen in ihrer Höhe zwischen Wald und Offenland einzuordnen sind – wurden sowohl eine Wald- als auch eine Offenlandzunahme von relativ wenig Befragten negativ beurteilt.
Hecken und kleinflächige Gehölze
Zunahmen von Hecken und kleinflächigen Gehölzen wurden signifikant unterschiedlich zwischen den Erholungsgebieten beurteilt, allerdings auf einem niedrigeren Signifikanzniveau als Veränderungen des Wald-Offenland-Verhältnisses (χ2=8,073; df=3; p=0,045; Abb. 4c). Obwohl die Lüneburger Heide und die Elbmarsch in Bezug auf das Wald-Offenland-Verhältnis sehr ähnlich beurteilt wurden, ergaben sich für Hecken und kleinflächige Gehölze deutliche Unterschiede. Mehr Hecken und kleinflächige Gehölze wurden in der Lüneburger Heide im Vergleich mit den anderen Erholungsgebieten am negativsten beurteilt (37,3 %), während in der Elbmarsch der geringste Anteil der Befragten etwas gegen eine Zunahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen hatte (18,5 %).
Eine Abnahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen wurde nicht signifikant unterschiedlich zwischen den Erholungsgebieten beurteilt (χ2=3,184; df=3; p=0,364; Abb. 4d), sondern in allen Erholungsgebieten überwiegend abgelehnt. In der Lüneburger Heide und im Alten Land, wo eine Zunahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen relativ negativ beurteilt wurde, stieß die Abnahme von Gehölzen in geringerem Maße als in den anderen Gebieten auf Ablehnung (Lüneburger Heide 41,7 % und Altes Land 45,1 %). Im Gegensatz dazu wurde in den Harburger Bergen (55 %) und der Elbmarsch (52,4 %) eine Abnahme von Gehölzstrukturen überwiegend als Einschränkung der Erholungseignung empfunden.
Äcker versus Wiesen und Weiden
Eine Zunahme von Äckern zu Lasten von Wiesen und Weiden wurde in allen Erholungsgebieten sehr negativ gesehen und nicht signifikant unterschiedlich zwischen den Gebieten (χ2=2,786; df=3; p=0,426; Abb. 4e). Die gegenteilige Entwicklung einer Zunahme von Grünland zu Lasten von Äckern wurde sehr positiv beurteilt, allerdings signifikant unterschiedlich zwischen den Erholungsgebieten (χ2=7,966; df=3; p=0,047; Abb. 4f). In der Lüneburger Heide und den Harburger Bergen, in denen Wiesen und Weiden nicht sehr häufig sind (vgl. Tab. 2), betrachteten mehr Befragte eine Zunahme von Grünland als negativ für die Erholungseignung (16,3 % in der Lüneburger Heide; 17,4 % in den Harburger Bergen) als in der Elbmarsch und im Alten Land, wo Wiesen und Weiden sehr häufig vorkommen (4,4 % in der Elbmarsch; 9,4 % im Alten Land).
5 Diskussion
Die Ergebnisse zeigen, dass der Landschaftstyp einen starken Einfluss auf die Akzeptanz der meisten Landschaftsveränderungen hat. Die Präferenzen der Bevölkerung gehen eindeutig dahin, dass der Landschaftstyp in seiner Eigenart erhalten werden soll. Dabei werden Landschaftsveränderungen nicht pauschal abgelehnt, sondern solche, die zur Eigenart der Landschaft beitragen, werden akzeptiert. Insgesamt wird im Falle von bekannten Landschaften also keine Vereinheitlichung in Richtung auf eine „optimale“ Landschaftsausstattung gewünscht, wie sie z.B. die Habitattheorien nahelegen könnten, die eine savannen- oder parkähnliche Landschaft als Optimum postulieren (z.B. „Prospect-Refuge Theorie“, „Information-Processing Theorie“; Appleton 1975, Balling & Falk 1982, Kaplan & Kaplan 1989, Ulrich 1986). Vielmehr wird eine Vielfalt an unterschiedlichen Landschaftstypen präferiert.
Die Akzeptanz von Landschaftsveränderungen hing nicht nur von der Veränderung selbst ab, sondern auch vom Landschaftstyp, in dem die Veränderung stattfand. So wurde der Verlust von Grünland, Hecken und kleinflächigen Gehölzen landschaftsunabhängig überall abgelehnt, während die Beurteilung von Veränderungen des Wald-Offenland-Verhältnisses am stärksten durch den Landschaftstyp beeinflusst wurde. Um die Erholungseignung einer Landschaft zu erhalten, ist es daher besonders bei Aufforstungen oder Abholzungen wichtig, den Landschaftstyp zu berücksichtigen.
Interessanterweise wurden Zu- und Abnahmen von Hecken und kleinflächigen Gehölzen deutlich unterschiedlich im Vergleich zu Änderungen des Waldanteils in den jeweiligen Gebieten beurteilt. Das bedeutet, dass die Befragten Gehölze nicht pauschal betrachteten, sondern zwischen Gehölztypen in den jeweiligen Landschaften differenzierten. In der Lüneburger Heide wurden beispielsweise sowohl eine Zunahme von Wäldern als auch eine Zunahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen relativ negativ beurteilt. In den Harburger Bergen und der Elbmarsch hingegen wurde entweder eine Waldzunahme oder eine Zunahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen deutlich stärker akzeptiert. Obwohl z.B. in der Elbmarsch die Beurteilung einer Waldzunahme ähnlich negativ wie in der Lüneburger Heide war, wurde in der Elbmarsch eine Zunahme von Hecken und kleinflächigen Gehölzen im Vergleich aller Erholungsgebiete am positivsten beurteilt.
Die unterschiedlichen Ergebnisse für die zwei durch offene Landschaft charakterisierten Erholungsgebiete Lüneburger Heide und Elbmarsch zeigen, dass bei der Beurteilung von Landschaftsveränderungen nicht nur das Wald-Offenland-Verhältnis, sondern auch weitere Unterschiede in der Landschaftsstruktur von Bedeutung sind. Die Elbmarsch ist z.B. deutlich stärker durch lineare Strukturen wie Hecken und Baumreihen entlang der Äcker und Grünländer geprägt als die Lüneburger Heide, in der kaum Hecken existieren.
Es ist nicht möglich, die Bewertungsergebnisse der Landschaftsveränderungen durch Wald, Hecken und kleinflächige Gehölze direkt auf den Anbau von Dendromasse zu übertragen. So werden aufgrund der geringeren Vielfalt der derzeitigen Anbauformen negativere Bewertungen von KUP-Einzelelementen im Vergleich mit Wald, Hecken und kleinflächigen Gehölzen erwartet. In Bezug auf die Akzeptanz in unterschiedlichen Landschaften kann aber davon ausgegangen werden, dass sich ähnliche Bewertungsunterschiede zwischen den Gebieten ergeben.
Die Wirkung von KUP wird außerdem durch das Anbausystem zu beeinflussen sein. Aus den unterschiedlichen Beurteilungen von Wald bzw. Hecken und kleinflächigen Gehölzen lassen sich Hypothesen für den flächigen und streifenförmigen Anbau von KUP ableiten. Daraus ergibt sich für die Erholungsgebiete der südlichen Metropolregion Hamburg, dass ein streifenförmiger Anbau von KUP besonders positive Effekte auf die Erholungseignung in der Elbmarsch erwarten lässt, während auf den Äckern der Harburger Berge ein flächiger Anbau vorzuziehen wäre. In der Lüneburger Heide sind insgesamt die negativsten Auswirkungen auf die Erholungseignung zu erwarten, sowohl durch flächigen als auch durch streifenförmigen KUP-Anbau. Im Alten Land sind keine Präferenzen für eine bestimmte Anbauform zu erwarten.
Insgesamt zeigt die negative Beurteilung von Äckern in der Befragung, dass deren Ausweitung starke negative Auswirkungen auf die Erholungseignung hätte. In dieser Beurteilung spiegelt sich auch die negative Einstellung der Bevölkerung gegenüber der aktuellen Praxis in der Landwirtschaft wie dem verbreiteten Anbau von Mais-Monokulturen und dem Verlust von Brachen und Grünländern wider, die in der Befragung deutlich gegenüber Äckern präferiert wurden.
6 Fazit
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass
die Bevölkerung in den gut bekannten und geschätzten Erholungslandschaften den Landschaftstyp möglichst erhalten möchte und diese individuellen Landschaften nicht zu Gunsten einer idealen Einheitslandschaft „verbessert“ werden sollten;
eine Zunahme von Wald, Hecken und kleinflächigen Gehölzen nur selten negativ auf die Erholungseignung wirkt;
die Akzeptanz einer Veränderung des Waldanteils allerdings am stärksten vom Landschaftstyp beeinflusst wird;
Grünland in allen Landschaften sehr viel positiver beurteilt wird als Äcker; eine Intensivierung der Landwirtschaft durch Grünlandumbruch also sehr negative Auswirkungen auf die Erholungseignung einer Landschaft hätte.
Aus den Befragungsergebnissen lassen sich Hypothesen für den KUP-Anbau ziehen. Aufgrund der grundsätzlich positiven Einstellung gegenüber Gehölzen sind auch beim Anbau von Dendromasse in Form von KUP Chancen zur Aufwertung des Landschaftsbilds vorhanden. Der Anbau von KUP oder sonstigen Agroforstsystemen könnte im Sinne einer multifunktionalen Landnutzung sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Erholungsnutzung positive Wirkungen entfalten. Im Gegensatz zu den negativ wahrgenommenen intensiv agrarisch genutzten Landschaften bieten KUP als extensive, mehrjährige Kulturen neue Aufwertungsmöglichkeiten für Erholungslandschaften.
Die Befragungsergebnisse lassen allerdings erwarten, dass die Anlage von KUP stark unterschiedlich je nach Landschaftstyp beurteilt wird. Besonders in typischerweise offenen Kulturlandschaften muss darauf geachtet werden, dass eine Anreicherung mit Gehölzen dem Landschaftscharakter entspricht. Je nach Landschaftstyp sollte auch das Anbausystem der KUP auf den Landschaftscharakter angepasst werden. In einigen Landschaften könnten KUP flächig auf dem ganzen Schlag angebaut werden, wohingegen in anderen Landschaften dem streifenförmigen Anbau Vorrang eingeräumt werden sollte. In der Elbmarsch z.B. sind durch großflächigen KUP-Anbau negative Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der Landschaft zu erwarten; kleinflächig und in Streifenform könnte der KUP-Anbau allerdings auch hier zu einem attraktiven Landschaftsbild beitragen. Es sollte also sowohl der Landschaftstyp und dessen Empfindlichkeit gegenüber dem KUP-Anbau als auch das Anbausystem bei der Auswahl und Ausgestaltung von potenziellen KUP-Anbaugebieten berücksichtigt werden.
Dank und Hintergrund
Die Ergebnisse sind Teil des Forschungsprojektes AgroForNet, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb des Förderschwerpunktes Nachhaltiges Landmanagement gefördert wird. AgroForNet („Nachhaltige Entwicklung ländlicher Regionen durch die Vernetzung von Produzenten und Verwertern von Dendromasse für die energetische Nutzung“) versucht in den drei Modellregionen Lausitz, Mittelsächsisches Lößhügelland und Südliche Metropolregion Hamburg, regionale Wertschöpfungsnetze zur nachhaltigen und effizienten Erzeugung und Bereitstellung von Dendromasse aus Land- und Forstwirtschaft sowie der offenen Landschaft zu etablieren. Weitere Informationen sind auf der Projekthomepage http://www.agrofornet.de zu finden. Die hier veröffentlichten fokussierten Befragungsergebnisse mit Planungsrelevanz für Deutschland werden methodisch ausführlich in der Zeitschrift iForest veröffentlicht (Boll et al. 2014, accepted).
Literatur
Antrop, M. (2004): Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning 67 (1-4), 9-26.
Appleton, J. (1975): The experience of landscape. Wiley, London.
Balling, J.D., Falk, J.H. (1982): Development of visual preference for natural environments. Environment and Behavior 14 (1), 5-28.
Baum, C., Leinweber, P., Weih, M., Lamersdorf, N., Dimitriou, I. (2009): Effects of short rotation coppice with willows and poplar on soil ecology. Landbauforschung vTI Agriculture and Forestry Research 3 (59), 183-196. http://www.bfafh.de/bibl/lbf-pdf/lbf-dl.htm.
Bemmann, A. (Hrsg., 2010): AGROWOOD. Kurzumtriebsplantagen in Deutschland und europäische Perspektiven. Weißensee (Ökologie), Berlin.
BfN (Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., 2012): Landschaftssteckbriefe [online 10.09.2012]. http://www.bfn.de/0311_schutzw_landsch.html.
Boll, T., Haaren, C. v., Albert, C. (2014): How do urban dwellers react to potential landscape changes in recreation areas? – a case study with particular focus on the introduction of dendromass in the Hamburg Metropolitan Region. Iforest, akzeptiert zur Publikation.
European Commission (2007): Growing regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
Franke, U. (2008): Thema: Landschaftsbild. Landschaft lesen. Impulse zur Landschaftsästhetik, Naturwahrnehmung und Landschaftsbildbewertung für die norddeutsche Kulturlandschaft. Schwerin [online 15.01.2012]. http://www.ink-landschaft.de/index.php.
Guo, Z., Zhang, L., Li, Y., Romanuk, T. (2010): Increased Dependence of Humans on Ecosystem Services and Biodiversity. PLoS ONE 5 (10).
Kaplan, R., Kaplan, S. (1989): The experience of nature. A psychological perspective. Cambridge Univ. Pr., Cambridge.
Palang, H., Sooväli, H., Antrop, M., Setten, G. (eds., 2010): European rural landscapes. Persistence and change in a globalising environment. Springer, Dordrecht.
Pott, R. (1999): Lüneburger Heide, Wendland und Nationalpark Mittleres Elbtal. Ulmer, Stuttgart.
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2009) [online 15.01.2012]. http://www.statistik-nord.de.
Statistisches Bundesamt (2010): Regionalatlas. Gemeinschaftsentwicklung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder [online 15.01.2012]. http://ims.destatis.de/indikatoren/Default.aspx.
Strohm, K., Schweinle, J., Liesebach, M., Osterburg, B., Rödl, A., Baum, S., Nieberg, H., Bolte, A., Walter, K. (2012): Kurzumtriebsplantagen aus ökologischer und ökonomischer Sicht. Arbeitsber. vTI-Agrarökonomie 2012 (6), Braunschweig.
Tveit, M. (2009): Indicators of visual scale as predictors of landscape preference; a comparison between groups. J. Envir. Management 90 (9), 2882-2888.
Ulrich, R. (1986): Human response to vegetation and landscapes. Landscape and Urban planning 13, 29-44.
Anschrift der Verfasser(in): Dipl.-Ing. Thiemen Boll und Prof. Dr. Christina von Haaren, Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung, Herrenhäuser Straße 2, D-30419 Hannover, E-Mail boll@umwelt.uni-hannover.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen






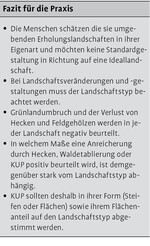
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.