Landschaft im Diskurs: Welche Landschaft? Welcher Diskurs?
Abstracts
Konstruktivistische Ansätze der Landschaftsforschung erfahren steigende Beachtung. Dabei ist jedoch dem Eindruck entgegen zu treten, es gäbe „die“ konstruktivistische Landschaftstheorie. In kritischer Auseinandersetzung mit dem Artikel von Bruns & Kühne (2013) in dieser Zeitschrift stelle ich eine diskurstheoretische Variante konstruktivistischer Landschaftsforschung vor und untermauere sie mit einem empirischen Beispiel. Darin geht es um eine Windkraft-Kontroverse in Ingersheim bei Stuttgart. Ziel ist es, diesen Ansatz konstruktivistischer Landschaftsforschung mit dem von Bruns & Kühne unter den Gesichtspunkten von Materialität und Macht zu vergleichen und planungspraktische Schlüsse daraus zu ziehen. Im Gegensatz zu Bruns & Kühne empfehle ich, dass Landschaftsplaner sich nicht auf eine Moderatorenrolle beschränken, sondern vielmehr ihre „Story“ der Wirklichkeit aktiver entwickeln und offensiver in der Öffentlichkeit vertreten sollten. Eine weitere Empfehlung zielt darauf ab, gesellschaftliche Aushandlungsprozesse über Landschaften zu intensivieren und so den Begriff der „landscape policy“ aus der Europäischen Landschaftskonvention stärker in Richtung von „landscape politics“ zu interpretieren.
Landscape in the Discourse – Which Landscape? Which Discourse? Practical implications of an alternative draft for constructivist landscape research
Constructivist landscape research has attracted increasing attention. It can be approached from different angles. In critical reflection upon a paper by Bruns & Kühne in NuL 45 (3), the paper introduces a discourse theoretic variant of constructivist landscape research underpinned with an empirical example. The case study deals with a controversy about wind energy in Ingersheim near Stuttgart. The aim is to compare the two approaches to constructivist landscape research with regard to materiality and power, and to draw conclusions for planning practice. The paper recommends, other than Bruns & Kühne, that landscape planners should not confine themselves to act as facilitators of the debate, but to advocate their concerns more confidently in the public and become more active in the production of discourses. Furthermore public debates about landscapes should be encouraged. This would help to evolve ‘landscape policies’ which are mentioned in the European Landscape Convention into ‘landscape politics’.
Die Kulturlandschaft, um die es hier geht, stellt einen Diskurs dar – oder anders gesagt: ein System von Beziehungen zwischen
- Veröffentlicht am
1 Einleitung
Seit einigen Jahren ist in Deutschland eine Konjunktur konstruktivistischer Ansätze in der Landschaftsforschung zu beobachten. Als Beispiele können die Arbeiten von Hahn (2004), Kook (2009) und Lippuner et al. (2010) angeführt werden. Damit wird eine Entwicklung nachvollzogen, die in der angelsächsischen Wissenschaftsszene bereits vor längerer Zeit eingesetzt hat. Im Vereinigten Königreich und Nordamerika, zum Teil auch in Skandinavien, hat sich neben eher naturwissenschaftlich geprägten Zweigen eine sozialwissenschaftliche Landschaftsforschung etabliert, die stark von der Neuen Kulturgeographie beeinflusst worden ist. Wylie (2007: 94 f.) beschreibt eine ihrer Grundannahmen mit den Worten: „[...] landscape is best conceived as part of a ‘constructed’ and circulating system of cultural meaning, encoded in images, texts and discourses [...]“.
Im deutschsprachigen Raum war es insbesondere Kühne, der das Thema einem breiteren Fachpublikum bekannt gemacht hat (z. B. Kühne 2006; 2009), zuletzt in einer gemeinsamen Publikation mit Bruns in dieser Zeitschrift (Bruns & Kühne 2013). Charakteristischerweise liegt den Arbeiten von Kühne ein Schichten- oder Mehrebenenmodell zugrunde, innerhalb dessen die „gesellschaftliche Landschaft“ von der „individuell aktualisierten gesellschaftlichen Landschaft“, der „angeeigneten physischen Landschaft“ und dem „physischen Raum“ (Bruns & Kühne 2013: 84) unterschieden wird.
Ich möchte den Artikel von Bruns & Kühne (2013) zum Anlass nehmen, eine andere Variante konstruktivistischer Landschaftsforschung vorzustellen und mit einem empirischen Beispiel zu untermauern – eine Variante, die den politischen Charakter von Landschaftskonstrukten in den Blick rückt. Sie stützt sich auf die Diskurstheorie von Laclau & Mouffe (1985). Anders als bei Kühne werden Landschaften hier nicht als mehrschichtige Phänomene, sondern als strukturierte Verbindungen von Wörtern, Gegenständen, Handlungen und Personen betrachtet.
Das empirische Beispiel bezieht sich auf die Kontroverse um den Bau eines Windrads in der Gemeinde Ingersheim bei Stuttgart. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurden gegensätzliche Landschaften konstruiert, die sich auf denselben Ausschnitt der Erdoberfläche beziehen und aufs Engste mit (energie)politischen Forderungen verwoben sind.
Ein weiteres Anliegen besteht darin, den diskurstheoretischen mit dem Mehrschichten-Ansatz zu vergleichen. Zwei Aspekte sind dabei aufschlussreich: Erstens der Umgang mit physischem Raum, materiellen Objekten und Materialität im Allgemeinen und zweitens die verwendeten Machtbegriffe (vgl. die ähnliche Struktur in Gailing & Leibenath 2013). Außerdem und vor allem möchte ich erörtern, welche planungspraktischen Schlüsse aus den Erkenntnissen konstruktivistischer Landschaftsforschung gezogen werden können – ebenfalls vor dem Hintergrund der Ausführungen von Bruns & Kühne.
Der Artikel ist folgendermaßen aufgebaut: Im nächsten Abschnitt skizziere ich mein diskurstheoretisches Verständnis der Konstruktion von Landschaft. Der dritte Abschnitt ist dem Kontext und den Ergebnissen der Ingersheim-Fallstudie gewidmet. Im vierten Abschnitt vergleiche ich die beiden Forschungsansätze miteinander, bevor ich im fünften Abschnitt abschließend auf die praktischen Implikationen eingehe.
2 Konstruktion von Landschaften aus diskurstheoretischer Sicht
Der Ausdruck „Diskurs“ kann unterschiedliche Dinge bezeichnen. Bei Laclau & Mouffe (1985) bildet ein Diskurs eine bedeutungsvolle, strukturierte Gesamtheit von Beziehungen zwischen Elementen wie sprachlichen Aussagen, Praktiken, Objekten und Subjekten, die durch so genannte Artikulationen zu Netzen oder Systemen verknüpft werden.
Was das praktisch bedeutet und wie auf diese Weise Landschaften konstruiert werden, lässt sich anhand eines Diskurses über Kulturlandschaften verdeutlichen, der so oder so ähnlich in einer deutschen Mittelgebirgslandschaft geführt werden könnte. Darin ergibt sich der Sinn des Ausdrucks „Kulturlandschaft“ nicht allein
dadurch, dass er in sprachlichen Äußerungen mit Wörtern wie „Bergwiese“, „Lesesteinwälle“, „Arnika“, „Wildapfel“, „Birkhuhn“ und „Fördermittel“ verbunden wird, sondern auch
dadurch, dass es Personen gibt, die sich als Landschaftspfleger bezeichnen, sowie
durch Handlungen wie das Mähen von Wiesen, das Aufstellen von Informationstafeln und das Veranstalten von Heulagern, Exkursionen und Naturmärkten.
Worten beziehungsweise sprachlichen Aussagen sowie
Objekten, die in sozial konstruierte Regeln eingebettet sind (Förderprogramme für die Kulturlandschaftspflege, institutionelle Strukturen, Landschaftspflegeverbände, Natura 2000 usw.) und mit
bestimmten Akteursrollen (z.B. Landwirte, die sich für die Landschaftspflege engagieren, aber auch Umweltpädagogen u. a.) und
Praktiken (z.B. das Wiesenmähen von Hand)
verbunden sind. Sprache, Subjekte, nicht-sprachliche Praktiken und Objekte sind dabei untrennbar miteinander verbunden und bilden in ihrer Gesamtheit den Diskurs (Leibenath & Otto 2012).
Daran wird deutlich, dass sich die Bedeutung oder Identität eines sprachlichen Elements wie „Kulturlandschaft“ erst durch die Beziehungen ergibt, die zwischen ihm und anderen Elementen artikuliert werden. Laclau & Mouffe postulieren darüber hinaus, dass es keine dauerhaft festgefügten Bedeutungen geben kann, weil immer wieder neue Beziehungen artikuliert werden oder zumindest artikuliert werden können. Es besteht zumindest prinzipiell die Möglichkeit, alternative Diskurse zu verwenden oder zu entwickeln. Jeder Diskurs ist ein kontingentes Konstrukt, weil er von Menschen geschaffen wurde, aber nicht notwendigerweise so sein muss, wie er ist, und auch anders – wenngleich nicht beliebig – konstruiert werden könnte (Wagenaar 2011).
In der Diskurstheorie spielt der Begriff der Abgrenzung eine zentrale Rolle: Die Bedeutung oder Identität einer Sache oder Person wird erst vollständig deutlich durch ihr negatives Pendant, also durch das, was sie nicht ist. In dem oben geschilderten exemplarischen Kulturlandschaftsdiskurs aus einer deutschen Mittelgebirgslandschaft würden die intensive Düngung von Bergwiesen, die Wiederbewaldung oder Aufforstung von Wiesen, die Errichtung von Windkraftanlagen, unreglementierter Skitourismus und der Bau großer technischer Hochwasserschutzanlagen abgelehnt. All diese Elemente werden als Bestandteil des Diskursäußeren artikuliert. Das Diskursinnere beinhaltet nur Elemente, die in einer positiven Beziehung (Äquivalenzbeziehung) zu „Kulturlandschaft“, „artenreiche Bergwiese“ usw. stehen. Zwischen Diskursinnerem und Diskursäußerem besteht also ein Antagonismus, der sich daraus ergibt, dass Kontraritätsbeziehungen zwischen vielen Einzelelementen artikuliert werden (Leibenath & Otto 2013b).
Grenzziehungen werden in der Diskurstheorie als Ausdruck von Macht verstanden. Denn dadurch, dass Grenzen zwischen Innen und Außen gezogen und aufrecht erhalten werden, wird definiert, was in einem Diskurs gesagt werden kann, was als wahr gilt, welche Handlungen zulässig sind und wer überhaupt als Sprecher und „Diskurs-Produzent“ in Erscheinung treten darf.
Diese Theorie kann empirisch angewandt werden, indem man Diskurse daraufhin untersucht, welche Äquivalenz- und Kontraritätsbeziehungen artikuliert werden, aus welchen Elementen das Diskursinnere und das Diskursäußere bestehen und wo folglich die antagonistische Grenze verläuft. Aufschlussreich ist darüber hinaus, welche Elemente besonders häufig zu anderen Elementen in Beziehung gesetzt werden und dadurch eine prominente Rolle spielen bei der temporären Fixierung von Bedeutung. Solche privilegierten Elemente werden als „Knotenpunkte“ (Laclau & Mouffe 1985: 112) bezeichnet.
Wie sich mit Hilfe der Diskurstheorie konkurrierende Landschaftskonstrukte ermitteln lassen, wird in der folgenden Fallstudie über einen Windenergie-Konflikt in Ingersheim gezeigt.
3 Fallstudie Ingersheim
3.1 Kontext
Das Besondere am Ingersheimer Windkraftkonflikt ist der Umstand, dass „Landschaft“ sowohl im Diskurs der Gegner als auch in dem der Befürworter in Erscheinung tritt, und zwar nicht nur am Rande. Die Fallstudie basiert auf der Auswertung mehrerer hundert Artikel aus der Lokalpresse sowie von Akteursdokumenten und Internetseiten. Außerdem wurden drei leitfadengestützte Interviews mit insgesamt sechs Schlüsselakteuren geführt und transkribiert. Die empirischen Erhebungen hat Frau Mag. Antje Otto durchgeführt. Eine ausführlichere Darstellung der Ergebnisse findet sich in Leibenath & Otto (eingereicht). Neben den Interviewtransskripten wurden acht schriftliche Diskursfragmente (EGIU 2010a und b, Eisenmann 2011, Grimm 2011, Haecker 2010, Huber & Huber 2010, Müller 2010a bis c, Schieber 2010, SHB 2010 und SPD 2011) einer detaillierten Feinanalyse unterzogen. Alle wörtlichen Zitate in diesem Kapitel stammen aus einem dieser Texte oder aus den Interviewtransskripten.
Die Gemeinde Ingersheim hat rund 6000 Einwohner und liegt nördlich von Stuttgart im Landkreis Ludwigsburg. Die Gegend ist durch ein dichtes Geflecht von Siedlungen, Feldern, Weinbergen, Waldstücken, Straßen und Hochspannungsleitungen gekennzeichnet. Unweit des Ortes gibt es zwei Großkraftwerke: Einen mit Öl und Kohle befeuerten Kraftwerkskomplex in Marbach am Neckar und ein Atomkraftwerk in Neckarwestheim, dessen zweiter Block noch in Betrieb ist. Die charakteristische Dampfwolke, die dem Kühlturm des Atomkraftwerks permanent entsteigt, ist von Ingersheim aus zu sehen (s. Abb. 1).
Bereits 2005 wurde im Regionalplan ein Vorranggebiet für Windenergie bei Ingersheim ausgewiesen, dem der Gemeinderat zugestimmt hat. 2010 schlug eine Gruppe von Bürgern vor, auf der Anhöhe zwischen Ingersheim und Besigheim ein großes Windrad mit einer Gesamthöhe von 179 Metern und einer Leistung von zwei Megawatt aufzustellen. Die Entfernung zum Ortsrand beträgt rund 700 m und nur 450 m bis zu den nächstgelegenen Einzelgehöften. Die Anlage sollte von einer Bürgerenergiegenossenschaft finanziert, errichtet und betrieben werden. Die Initiatoren erhielten im Januar 2011 die Baugenehmigung. Eine Bürgerinitiative, die sich aus Protest gegen die Windkraftpläne gegründet hatte, reichte im März eine Petition beim Baden-Württembergischen Landtag ein, die jedoch im Juli 2011 abgelehnt wurde. Weil auch die Bemühungen, das Windrad auf juristischem Wege zu verhindern, scheiterten, konnte der Bau im September 2011 begonnen und im März 2012 abgeschlossen werden.
Planung und Realisierung des Ingersheimer Windrades haben zu einer intensiven Diskussion geführt, in deren Verlauf sich zwei gegensätzliche Windenergie- und Landschaftsdiskurse entwickelt haben. Beide Diskurse werden von Akteursgruppen produziert, die auch als Diskurskoalitionen (Hajer 1995) bezeichnet werden können.
Interessanterweise gibt es für den Standort des Windrads keinen prägnanten Namen. Befürworter wie Gegner bezeichnen ihn mit allgemeinen Worten wie „die Landschaft“, „die Landschaft hier“ und „die Landschaft dort oben“ oder mit Umschreibungen wie „Hochfläche zwischen Ingersheim und dem Husarenhof” und „östlich der Straße zwischen Besigheim und Ingersheim an der L 1113“.
3.2 Befürworter
Zur Diskurskoalition der Befürworter gehörte eine Kerngruppe von 10–20 Personen, die von allen Parteien im Ingersheimer Gemeinderat, dem Bürgermeister, dem Landrat, Vertretern der örtlichen Kirchengemeinde und den meisten Medien unterstützt wurde. Auch die 2010 neu gewählte grün-rote Landesregierung sowie die überörtlichen Gremien des BUND standen dem Projekt positiv gegenüber.
Die zentralen Knotenpunkte im Inneren des Diskurses der Befürworter lauten „Wegkommen von der Atomenergie“, „Landschaften entwickeln sich“ und – bezogen auf den geplanten Standort – „gute Windverhältnisse“. Als prominente Knotenpunkte im Diskursäußeren sind „Idylle“, „Naturschutz“, „Atomenergie“ und „die Wolke“ zu nennen.
Die Befürworter lehnen es ab, in dem Areal „Idylle pur“ oder eine „völlig unberührte Landschaft“ zu sehen. Stattdessen ist für sie „die Landschaft [...] schon belastet durch diese Hochspannungsleitungen“ und „den intensiven Ackerbau“. Es handele sich um eine „Kulturlandschaft“, die „immer wieder verändert wurde und es noch wird“, eine „ausgeräumte landwirtschaftliche Nutzfläche“, die „in hohem Maße durch Siedlung, Industrie und Infrastruktur geprägt“ sei. Die sprachlichen Elemente „Rückzugsgebiet von Vogel- und Tierwelt“, „Naturschutz“ und „Vogelzugautobahn“ werden als Teile des Diskursäußeren artikuliert und somit abgelehnt. Was diese Landschaft in den Augen der Befürworter hingegen auszeichnet, ist die Tatsache, dass „da oben [...] der Wind immer spürbar ist“, was durch das Windgutachten eines „anerkannten und als konservativ geltenden Wind-Gutachters“ bestätigt worden sei. Für die Befürworter stellt das Windrad ein Wahrzeichen und einen „Imagegewinn“ für Ingersheim dar. Es sei „ästhetisch schön“ – vor allem „im Vergleich zu der Atomkraftwolke“. Bleibt „die Frage nach dem Geschmack“: Die könne „man im Raum stehen lassen“, aber die Energieversorgung werde „wahrscheinlich nicht nach Geschmack entschieden“ und da müsse man „Kompromisse eingehen“. Als nicht-sprachliche Elemente sind zahlreiche Fotos zu erwähnen, die entweder von der Kanzel des Windrades aufgenommen wurden oder das Windrad in ein positives Licht rücken. Darüber hinaus beinhaltet der Diskurs Praktiken wie die Durchführung von öffentlichen Informationsveranstaltungen und Baustellenfesten sowie – als physisches Objekt – das Windrad selbst.
3.3 Gegner
Der gegnerische Diskurs wird von einer Diskurskoalition getragen, in der Akteure aus Ingersheims Nachbarort Besigheim tonangebend sind. Die Bürgerinitiative gegen das Windrad hat nach eigenen Angaben rund hundert Mitglieder, die zu einem großen Teil dem bürgerlich-liberalen Teil des Parteienspektrums zuzurechnen sind. An einer Unterschriftenkampagne haben sich 1 400 Unterzeichner beteiligt. Neben der Bürgerinitiative haben sich insbesondere der langjährige Vorsitzende des Ingersheimer BUND-Ortsverbands und der Schwäbische Heimatbund gegen das Windrad ausgesprochen.
Im Zentrum des Diskurses der Gegner stehen die Knotenpunkte „Energiewende“ und „Atomausstieg“, aber in Verbindung mit konträren Elementen im Diskursäußeren wie „Windräder an Standorten, die weder volkswirtschaftlich noch energiepolitisch Sinn machen“, „verheerende Kosten-/Nutzenrelation“, „Ökologie- und Ökonomie-Unfug“, „Verfall von Grundstücks- und Immobilienwerten“ und „Gesundheitsschäden“. In Verbindung damit wurde ein Landschaftsbegriff entwickelt, bei dem „jahrhundertealte Kulturlandschaft“ äquivalenziert wird mit „sanfter Höhenrücken zwischen Enz und Neckar“, „Rückzugsgebiet für seltene und auf der FFH-Liste stehende Vogelarten (Rotmilan u.a.)“, „schützenswerte Landschaft“, „bäuerliche Landwirtschaft“, „Offenlandstandort mit hoher visueller Sensitivität“ und schließlich „unzureichende Windgeschwindigkeiten“. Die Elemente des Diskursäußeren, die abgelehnt werden, spielen bei diesem diskursiven Konstrukt eine überaus wichtige Rolle. Neben den bereits genannten gehören dazu: „das Kraftwerk an dem vorgesehenen Standort bauen“, „technischer Großeingriff“, „totale Verschandelung“, „das Landschaftsbild in nicht wieder gut zu machender Weise beeinträchtigen“ und „irreversibler Verlust“. Als nicht-sprachliche Elemente sind beispielsweise Hubschrauberflüge zu erwähnen, mit denen die Höhe des geplanten Windrades plastisch veranschaulicht werden sollte, sowie Informationsstände, Flugblattverteil-Aktionen, Standortbegehungen, eine Unterschriftensammlung und – in diesem Fall als Element des Diskursäußeren – das Windrad.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Landschaftskonzept der Gegner auf dem Gegensatz zwischen „jahrhundealte Kulturlandschaft“ und „totale Verschandelung“ beruht. Betont werden die Natürlichkeit, Empfindlichkeit und Schönheit des geplanten Windkraftstandorts. Der „Ökologie- und Ökonomie-Unfug“, an dieser Stelle ein Windrad zu errichten, wird damit gleichgesetzt, „der nötigen Energiewende einen Bärendienst [zu] erweisen“.
4 Vergleich der verschiedenen Spielarten konstruktivistischer Landschaftsforschung
Im Folgenden möchte ich Unterschiede zum Mehrschichten-Ansatz von Kühne beziehungsweise Bruns & Kühne herausarbeiten und auf einige Probleme eingehen, die meines Erachtens mit jenem Ansatz verbunden sind. Zwei Aspekte stehen dabei im Vordergrund: (a) Materialität und (b) Macht.
Zu (a), Materialität: Bei Bruns & Kühne treten Räume und Landschaften als scheinbar objektive Gegebenheiten in Erscheinung, die durch Sprache oder andere Symbolsysteme repräsentiert werden. So schreiben die Autoren, dass „Bedeutungen [...] mit Landschaften verknüpf[t]“ (83) werden, dass etwas Konstruiertes „auf den Raum projiziert wird“ (83), dass Landschaften „abgebildet“ (84 f.) werden und dass „der Umgang mit Landschaft“ (85) in einer bestimmten Weise erfolgen solle. Diese Diktion hat den Vorteil, dass sie anschlussfähig ist an die Raumkonzepte der physischen Geographie und der Landschaftsökologie sowie den alltäglichen Sprachgebrauch.
Als problematisch empfinde ich jedoch, dass Bruns & Kühne auf diese Weise in Gefahr geraten, Widersprüche zu einer Grundprämisse konstruktivistischer Forschung zu erzeugen. Diese besagt, dass Landschaften und Räume nicht per se existieren, sondern erst durch individuelle Erlebnisse und Wahrnehmungen und durch kontextgebundene gesellschaftliche Kommunikation entstehen (Leibenath 2013). Oder in den Worten von Wagenaar (2011: 179): „all we know are versions“, also individuell oder kollektiv erzeugte Versionen der Wirklichkeit, aber nie die Wirklichkeit an sich. Der von mir vorgeschlagene diskurstheoretische Landschaftsbegriff mag auf den ersten Blick „sperriger“ sein. Er wird dieser Prämisse aber eher gerecht, weil Landschaften hier von vornherein als konstruierte, bedeutungsvolle Ensembles aus Objekten, Praktiken, Individuen und sprachlichen Elementen verstanden werden. Daraus folgt logischerweise, dass es potenziell unendlich viele Landschaften geben kann, die sich auf einen Ausschnitt der Erdoberfläche beziehen. So gesehen erscheint auch die Frage von Bruns & Kühne, „wie [...] Landschaftsgestalter z.B. davon ausgehen [können], sie seien in der Lage, die „Raumwirkung“ oder „Identität“ einer bestimmten Landschaft ohne Berücksichtigung der Ansichten von Ortsansässigen zu definieren“ (85), als obsolet – einfach deswegen, weil es an einem konkreten Ort selten die eine Landschaft mit der einen Raumwirkung und Identität geben dürfte, sondern zumeist mehr oder weniger viele Versionen.
Zu (b), Macht: Bruns & Kühne unterstellen einen Gegensatz zwischen Macht- und Sachrationalität, wenn sie schreiben: „Der Umgang mit Landschaft wird dem Kalkül des Machterhalts und Machterwerbs unterworfen und ist häufig nur noch rudimentär an sachlichen bzw. fachlichen Aussagen orientiert [...]“ (86). In die gleiche Richtung geht ihre Beobachtung, dass Entscheidungsträger nicht aufgrund der ihnen vorliegenden genauen Untersuchungen, sondern „machtstrategischer Erwägungen“ (86) handeln. Auch dies mag aus einer alltagssprachlichen Perspektive heraus plausibel sein. Dabei gerät aus dem Blick, dass auch Fachleute wie beispielsweise Landschaftsplaner sich bestimmter Sinn- und Bedeutungsstrukturen bedienen müssen, die notwendigerweise Aus- und Abgrenzungen beinhalten und somit machtgeladen sind. Das äußert sich darin, dass diese Diskurse zum Beispiel das Wissen von Fachleuten gegenüber dem Laienwissen privilegieren, wie Bruns & Kühne in zutreffender Weise herausarbeiten.
Aus diskurstheoretischer Sicht gibt es keine machtfreien Räume und keine machtfreie Kommunikation. Man kann nur innerhalb vorgegebener Diskurse sprechen und handeln. Jeder Diskurs ist unweigerlich mit machtförmigen Inklusions- und Exklusionsprozessen verbunden. Objektivität, Wahrheit und Vernunft existieren stets nur innerhalb des Referenzrahmens eines Diskurses. So betrachtet gibt es keinen Gegensatz zwischen Macht- und Sachrationalität.
Konstruktivistische Landschaftsforschung kann emanzipatorisch wirken, indem sie Machtmechanismen offenlegt – auch solche, die zum Tragen kommen werden, wenn bestimmte „interessierte Kreise der Öffentlichkeit“ (Bruns & Kühne 2013: 87) stärker als bisher an landschaftsbezogenen Entscheidungen beteiligt werden sollten.
5 Praktische Implikationen
Wie soll damit umgegangen werden, dass es in der Regel alternative, konkurrierende Landschafts-Versionen gibt und dass jedes dieser Konstrukte machtgeladen ist?
Bruns & Kühne schlagen vor, „Landschaftsqualitätsziele multiperspektivisch auf[zu]stellen“ (87), „stärker auf tolerante und kontingente Soll-Vorstellungen [zu] orientier[en]“, die Öffentlichkeit intensiver zu beteiligen und das Berufsbild des Planers von dem eines Entwerfers zu dem eines „Moderator[s] und Szenarien-Ersteller[s]“ (88) weiterzuentwickeln.
Meines Erachtens liegt das Problem jedoch nicht so sehr darin, dass wenige Fachleute aus dem Bereich des „landschaftsbezogenen Planens“ (Bruns & Kühne 2013: 84) unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber entschieden, wie sich Landschaften entwickeln. Kritikwürdig finde ich mit Blick auf die Praxis und den Planungsalltag vielmehr,
dass einerseits die Landschaftsplanung als Fachplanung – ungeachtet mancher Umsetzungserfolge (Wende et al. 2012) – einen geringen Stellenwert hat und
dass andererseits Landschaften in weiten Teilen ungeplante „Nebenprodukte“ von Entscheidungen darstellen, die in sektoralen Politikfeldern wie der Energie-, Agrar- oder Verkehrspolitik getroffen werden.
Natürlich lassen sich die Rahmenbedingungen, unter denen Landschaftsplanung stattfindet (oder oftmals überhaupt nicht stattfindet), nicht leicht ändern. Wenn man aber schon über Berufsbilder nachdenkt, dann könnte – gerade auch aus diskurstheoretischer Sicht – eine Empfehlung lauten, dass Landschaftsplaner ihre gesetzlich begründeten Anliegen offensiver in der Öffentlichkeit vertreten und sich aktiver als Diskursproduzenten betätigen sollten: „Strategically perceptive planners and politicians may be very conscious of their role in creating new discourses“ (Healey 1997: 288).
Erfolgreiche Planung hat etwas mit „persuasive story-telling“ (Throgmorton 1992) zu tun. Es kommt darauf an, leicht kommunizierbare Bilder, plausible Metaphern und griffige Kurzformeln („story lines“ im Sinne von Hajer 1995) zu finden, um in der Öffentlichkeit größeres Gehör zu finden. Wichtig wäre es außerdem, den Landschaftsdiskurs der Landschaftsplanung inhaltlich auszuweiten und mit anderen politischen Zielen zu verknüpfen, zum Beispiel Gesundheit, hochwertige Ernährung und Zeitwohlstand/Entschleunigung. Aus der Erkenntnis, dass alle Landschaften kontingente Konstrukte sind, muss man jedenfalls nicht zwangsläufig den Schluss ziehen, die eigenen Vorstellungen aufzugeben und sich nur noch moderierend zu betätigen. Landschaftsplaner dürfen und sollten sich darum bemühen, ihre Ziele im politischen Raum durchzusetzen, allerdings in dem Bewusstsein, dass andere Versionen genauso wahr und legitim sind.
Meine zweite Empfehlung ist nicht unmittelbar diskurstheoretisch begründet und lautet, dass mehr Landschaftsdiskurse produziert werden sollten. Landschaften sollten bei politischen Entscheidungen öfter thematisiert werden. Beispielsweise sind viele landschaftsbezogene Debatten in Deutschland derzeit Debatten um die Nutzung erneuerbarer Energien (Leibenath & Otto 2013a), aber längst nicht jede Erneuerbare-Energien-Debatte ist auch eine Landschafts-Debatte. Dies sollte sich ändern. Entscheidungen, die in sektoralen Politikfeldern wie der Energie-, Verkehrs-, Agrar- oder Fiskalpolitik getroffen werden, sollten im Hinblick darauf hinterfragt werden, wie sie sich auf Landschaften – das heißt auf die konkret-räumlichen, örtlichen Beziehungsgeflechte zwischen Menschen und ihren physischen Umwelten – auswirken. Dabei werden manche Konflikte zwangsläufig stärker hervortreten als bisher, zum Beispiel zwischen globalen Klimaschutz- und lokalen Naturschutzzielen oder zwischen Konsum- und Mobilitätsansprüchen auf der einen Seite und landschaftlichen Idealvorstellungen auf der anderen Seite.
Diese Empfehlung zielt darauf ab, den Begriff der „landscape policy“ aus der Europäischen Landschaftskonvention stärker in Richtung von „landscape politics“ zu interpretieren, also gesellschaftliche Aushandlungsprozesse über Landschaften zu intensivieren und eventuell zu institutionalisieren. Aus meiner Sicht ist es eine offene Frage, ob Landschaftsplaner derartige Prozesse moderieren oder lieber als Anwälte inhaltlicher Anliegen darin agieren sollten.
Literatur
Bruns, D., Kühne, O. (2013): Landschaft im Diskurs. Konstruktivistische Landschaftstheorie als Perspektive für künftigen Umgang mit Landschaft. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (3), 83-88.
EGIU (Energiegenossenschaft Ingersheim und Umgebung e.V. i.G., 2010a): Fakten statt Emotionen. http://www.eg-ingersheim.de/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=26:positionen-und-stellungnahme-seite-1&id=12:positi onen&Itemid=40 (Abrufdatum 16.04.2013).
– (2010b): Landschaft. http://www.eg-ingersheim.de/index.php?option=com_content&view=article&id=17:landschaft&catid=17:windoekologie&Itemid=39 (Abrufdatum 16.04.2013).
Eisenmann, A. (2011): Zum Thema Windkraft in Ingersheim: Landschaftseingriff nicht zu rechtfertigen. Bietigheimer Zeitung 28.07.2011.
Gailing, L., Leibenath, M. (2013): The social construction of landscapes: Two theoretical lenses and their empirical applications. Landscape Research (online erschienen am 23.07.2013).
Grimm, E. (2011): Beelzebub. Ludwigsburger Kreiszeitung 16.07.2011.
Haecker, W.-D. (2010): Taugt nicht als Vorzeigeobjekt für die Energiewende. Bietigheimer Zeitung 08.09.2011.
Hahn, A. (2004): Landschaft konstruieren. In: Serbser, W., Inhetveen, H., Reusswig, F., Hrsg., Land – Natur – Konsum. Bilder und Konzeptionen im humanökologischen Diskurs, oekom, München, 53-65.
Hajer, M. (1995): The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process. Oxford University Press, Oxford.
Healey, P. (1997): Collaborative Planning. Macmillan, London.
Huber, K., Huber, W. (2010): Offener Brief von Karin und Wolfgang Huber. http://www.gegenwind-husarenhof.de/huber.html (Abrufdatum 24. 04.2013).
Kook, K. (2009): Landschaft als soziale Konstruktion. Raumwahrnehmung und Imagination am Kaiserstuhl. http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7117/pdf/Dissertation_Kook.pdf (Abrufdatum 02.03.2010).
Kühne, O. (2006): Landschaft und ihre Konstruktion. Theoretische Beispiele und empirische Befunde. Naturschutz und Landschaftsplanung 38 (5), 146-152.
– (2009): Grundzüge einer konstruktivistischen Landschaftstheorie und ihre Konsequenzen für die räumliche Planung. Raumforschung und Raumordnung 67 (5/6), 395-404.
Laclau, E., Mouffe, C. (1985): Hegemony & Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. Verso Press, London.
Leibenath, M. (2013): Konstruktivistische, interpretative Landschaftsforschung: Prämissen und Perspektiven. In: Leibenath, M., Heiland, S., Kilper, H., Tzschaschel, S., Hrsg., Wie werden Landschaften gemacht? Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Konstituierung von Kulturlandschaften, Transcript, Bielefeld, 7-37.
–, Otto, A. (2012): Diskursive Konstituierung von Kulturlandschaft am Beispiel politischer Windenergiediskurse in Deutschland. Raumforschung und Raumordnung 70, 119-131.
–, Otto, A. (2013a): Local debates about „landscape“ as viewed by German regional planners: Results of a representative survey in a discourse-analytical framework. Land Use Policy 32, 366– 374.
–, Otto, A. (2013b): Windräder in Wolfhagen – eine Fallstudie zur diskursiven Konstituierung von Landschaften. In: Leibenath, M., Heiland, S., Kilper, H., Tzschaschel, S., Hrsg., Wie werden Landschaften gemacht? Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Konstituierung von Kulturlandschaften, Transcript, Bielefeld, 205-236.
–, Otto, A. (eingereicht): Competing wind energy discourses, contested landscapes: Discursive constructions of landscapes in the wake of Germany’s energy transition. Journal of Environmental Policy & Planning.
Lippuner, R., Redepenning, M., Schneider, A. (2010): Ordnung der Vielfalt. Zur Konstruktion von Kulturlandschaften in Bildung, Tourismus und Politik. In: Welch Guerra, M., Hrsg., Kulturlandschaft Thüringen, Verlag der Bauhaus-Universität, Weimar, 134-154.
Müller, W. (2010a): Mach mit (1): Husarenhof-Bürgerinitiative zur Verhinderung einer Windkraftanlage. Kein Ökologie- und Ökonomie-Unfug am Standort Husarenhof/Lerchenhof. http://www.gegenwind-husarenhof.de/sonstiges/190510Info-Blatt1Ablehnung.pdf (Abrufdatum 23.04.2013).
– (2010b): Mach mit (3): BI „Gegenwind-Husarenhof“ zur Verhinderung einer Windkraftanlage (WKA). Öko- und Ökonomie-Unfug? Nein! http://www.gegenwind-husarenhof.de/sonstiges/210510InfoBlatt3%D6koUnfug.pdf (Abrufdatum 25.05.2013).
– (2010c): Mach mit (5): „Gegenwind Husarenhof“ – BI zur Verhinderung einer Windkraftanlage (WKA): Ablehnungsgründe. http://www.gegenwind-husarenhof.de/sonstiges/150510InfoBlatt5Ablehnungsgr%FCnde.pdf (Abrufdatum 24.04.2013).
Schieber, M. (2010): Leserbrief zum Thema Windrad in Ingersheim: Windrad und Sonnenkollektoren. Bietigheimer Zeitung 29.03.2010.
SHB (2010): Pressemitteilung. Windkraftanlage Ingersheim, Kreis Ludwigsburg. „180 Meter sind zu hoch!“ http://www.gegenwind-husarenhof.de/sonstiges/Pressemitteilung%20SHB%2012.8.2010.pdf (Abrufdatum 24.04.2013).
SPD (2011): SPD im Kreis Ludwigsburg bekräftigt Unterstützung des Ingersheimer Windrades [Pressemitteilung, 07.01.2011].
Throgmorton, J.A. (1992): Planning as persuasive story telling about the future: negotiating an electric power rate settlement in Illinois. Journal of Planning Education and Research 12, 17-31.
Wagenaar, H. (2011): Meaning in Action: Interpretation and Dialogue in Policy Analysis. Sharpe, Armonk (NY).
Wende, W., Wojtkiewicz, W., Marschall, I., Heiland, S., Lipp, T., Reinke, M., Schaal, P., Schmidt, C. (2012): Putting the plan into practice: Implementation of proposals for measures of local landscape plans. Landscape Research 37 (4), 483-500.
Wylie, J. (2007): Landscape (Key Ideas in Geography). Routledge, London.
Anschrift des Verfassers: Dr. Markus Leibenath, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Weberplatz 1, D-01217 Dresden, E-Mail M.Leibenath@ioer.de.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


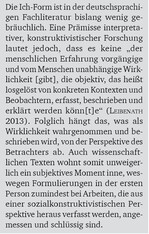
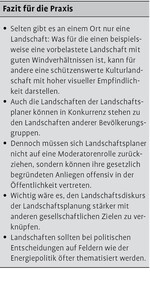
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.